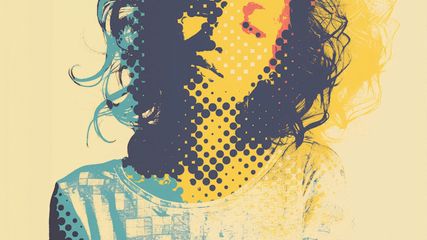<p class="article-intro">Die Arbeitswelt ist zurzeit einem massiven Wandel ausgesetzt. Neue Technologien ermöglichen zusehends flexiblere Arbeitsmodelle und der steigende Grad an Vernetzung weicht die Bindung vieler Arbeitnehmer an einen spezifischen Arbeitsort auf. Häufige Orts- und Arbeitswechsel sind in bestimmten Branchen mittlerweile Realität. Dies bringt neue Herausforderungen für die Versorgung von Personen mit psychiatrischen Erkrankungen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Einführung und Problematik</h2> <p>Die Definition und Betreuung von Risikogruppen stellen einen wichtigen (sozial-) psychiatrischen Ansatz dar, der insbesondere für Familien mit Kindern von Bedeutung ist. Für die spezifische Population der sogenannten Expats zeigen sich neben sicher vorhandenen Schutzfaktoren oder protektiven Prozessen besondere, auf den ersten klinischen Blick schwer erkennbare Risikofaktoren.<br /> In diesem Kontext ist der entwicklungspsychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgungsrealität bisher praktisch- klinisch wie wissenschaftlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Systematische Recherchen bei Medline (in den letzten 5 Jahren z. B. nur 6 Artikel für «Expatriate » and «Psychiatry»), PsychIndex, research gate oder Google-Scholar fördern nur einige wenige und zumeist auf den amerikanischen und asiatischen Bereich bzw. auf Militär- und Diplomatenkonstellationen zielende Ergebnisse zutage.<br /> Die psychotherapeutische und entwicklungspsychiatrische Versorgung von sogenannten Expats gehört zu den wenig bearbeiteten und gering ausgebauten Gebieten in Psychiatrie und Psychotherapie. Die relativ kurze Aufenthaltsdauer im Gastland, die hohe Fokussierung auf berufliche und Arbeitsaspekte, aber auch das relative Alter der Expats sind hier ebenso Gründe wie die Angst vor Stigmatisierung, versicherungstechnische Fragen und nicht zuletzt sprachlich-kulturelle Hindernisse. Anhand typischer Fallbeispiele aus der Schweiz wird ein spezielles Angebot dargestellt, das sich den Schwierigkeiten von Expat-Familien und ihren minderjährigen Kindern vor allem mit dem Fokus auf Lernund Leistungsstörungen, ADHS, Angst, Anpassungsstörungen und Depression widmet. Mögliche Ausbau- und Optimierungspotenziale in diesem Bereich werden dargestellt.</p> <h2>Definitionen</h2> <p>Der in der Wirtschaftswelt gebräuchliche Begriff Expat definiert sich bei Wikipedia (22.10.2019) so:<br /> «Eine klassische Definition des Expats bezieht sich auf – zumeist hochqualifizierte – Fachkräfte, die durch ihren Arbeitgeber für begrenzte Zeit ins Ausland entsandt werden, um in Zweigstellen oder ausgelagerten Projekten zu arbeiten. Wesentliche Merkmale sind dabei die Befristung (meist ein bis fünf Jahre), die Entsendung durch eine Organisation sowie die Aufrechterhaltung der Bindungen an das Heimatland bzw. an das entsendende Unternehmen. Das Ziel der entsendenden Organisation ist häufig Know-how-Transfer, Verbesserung der Kommunikation und Wunsch nach Kontrolle. Aus Sicht der Expatriates steht oft die berufliche oder persönliche Entwicklung im Vordergrund. Erfolgt die Initiative zum Auslandsaufenthalt nicht von einem Unternehmen, sondern von der jeweiligen Person selbst, wird in wissenschaftlichen Publikationen von selbstinitiierter Expatriation (self-initiated expatriation) gesprochen. Diese Führungskräfte werden als ‹ausländische Führungskräfte in lokalen Organisationen› (FELO – Foreign Executives in Local Organizations) bezeichnet.» Für die hier diskutierte Thematik wird praktischerweise nicht zwischen den Gruppen unterschieden.</p> <h2>Allgemeine und spezifische Risikokonstellationen</h2> <p>Nationale und multinationale Unternehmen mit Firmensitz(en) in grenznahen (Basel, Lausanne/Vaud) oder zentralen Regionen der Schweiz (Zürich, Zug etc.) bzw. Metropolen mit diversen internationalen Organisationen und Firmensitzen (Wien, Zürich) beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen Nationen. In der Schweiz arbeitet jeder vierte Arbeitnehmer für ein multinationales Unternehmen. Diese müssen im Rahmen ihrer beruflichen Entwicklung und Tätigkeit u. U. kurzfristig den Arbeits- und damit meistens auch den Wohnort wechseln oder werden von ausländischen Filialen versetzt. Meist betrifft diese Thematik Menschen in der Altersstufe zwischen 25 und 40 Jahren, die sich gleichzeitig in einer (frühen) Familienphase befinden.<br /> Die Expatriierung betrifft nicht nur den jeweiligen Arbeitnehmer, sondern häufig auch seine nahen Angehörigen und zumeist minderjährigen Kinder. Während über Migrationspopulationen und Flüchtlinge seit vielen Jahrzehnten intensiv geforscht wird und auch Kinder und Jugendliche aus binationalen Verbindungen als Risikogruppe bekannt sind, gibt es erstaunlich wenig Literatur und klinische Erfahrungsberichte aus dem Bereich der Expats, seien diese nun international oder national. Tabelle 1 skizziert die grundsätzlichen empirischen Unterschiede zwischen Expats und anderen Klientengruppen.<br /> In der Schweizer Versorgungsrealität zeigen sich Expat-Familien mit klassischen Migrationsproblemen, zumeist aber Familien mit latenten depressiven und phobischen Störungsbildern, mit neuropsychologischen Auffälligkeiten wie ADHS und Teilleistungsstörungen, aber auch mit Persönlichkeitsstörungen. Bei mangelnder Diagnostik und Intervention besteht insbesondere im Kindes- und Jugendalter die Gefahr der Chronifizierung und der Behinderung von Entwicklungsaufgaben.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Neuro_1905_Weblinks_lo_neuro_1905_s45_tab1_bilkehentsch.jpg" alt="" width="550" height="343" /></p> <h2>Problematik in Praxis und Klinik</h2> <p>In drei psychotherapeutisch und entwicklungspsychiatrisch orientierten Gemeinschaftspraxen (Praxisgemeinschaft am Kunsthaus, Zürich; Praxisgemeinschaft für Verhaltenstherapie, Baar; Praxis für Psychotherapie am Obertor, Winterthur) konnten seit 2015 im Rahmen spezialisierter, auf Expats zugeschnittener Angebote (circa 100 Klientenfamilien pro Jahr), die sich meist durch Mund-zu-Mund-Propaganda mitteilten, typische Störungsbilder (gehäuft auf Achse 1 und Achse 5 des MAS) gefunden werden:</p> <ol> <li>Anpassungsstörungen mit depressiver Störung (F43.25)</li> <li>Phobische Störungen (F40.x)</li> <li>Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrome (F90.x)</li> <li>Persönlichkeitsstörungen, insbesondere vom ängstlich-vermeidenden und vom narzisstischen Typus (F6xx)</li> <li>Suchterkrankungen bei hohem psychosozialem Funktionsniveau (F1xx)</li> <li>Mangelnde elterliche Aufsicht und Steuerung durch das berufliche Engagement der Eltern bzw. durch die kulturelle und sprachliche Isolierung der Eltern</li> <li>Abweichende Elternsituation (Dekompensation der Eltern, Depressivität der Mutter, Streit zwischen den Eltern)</li> </ol> <p>Der Leidensdruck, der jeweils zur Vorstellung führte, rührte vor allem von der zweiten Generation, also den sich in anderer Weise als die Eltern integrierenden Kindern und Jugendlichen der Familien. Elterlicherseits fanden sich oft eine Art «neglect» und eine Bagatellisierung.<br /> Die klinische Praxis zeigte, dass sich die Familien meistens nicht viele substantiierte Fragen stellen, bevor sie in die Schweiz ziehen. Der intellektuelle und emotionale Fokus liegt auf dem Beginn der neuen Arbeit, eine ggf. notwendige kulturelle Anpassung wird selten aktiv hinterfragt. Die Mehrheit der Familien wählt nicht absichtlich die Schweiz und hat meistens kaum Kenntnisse über das Land. Es handelt sich oft um die Suche nach einer finanziellen Sicherheit mit hoher Lebensqualität. Viele Familien haben bereits vorher ausserhalb ihres Herkunftslandes gewohnt und betrachten einen erneuten Umzug als eine bekannte «Kleinigkeit». In den meisten Konstellationen (mehr als 80 % ) handelt es sich erfahrungsgemäss um eine männliche Expat-Person, die die Ehefrau (teilzeitbeschäftigt, primär Hausfrau) und die minderjährigen Kinder mitbringt.<br /> Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist eine unklare Situation vieler Expat- Familien, die zunächst ihren Aufenthalt in der Schweiz auf einige Jahre planen, dann aufgrund der Arbeitssituation oder anderer Faktoren länger bleiben als geplant, aber wegen der fehlenden Integration und der mangelnden Bemühungen um diese (Sprache, Freundeskreis) keine zufriedenstellende Anpassung an hiesige Verhältnisse erreichen. Es entsteht bei vielen Expats und ihren Familien gewissermassen «ein Leben auf Abruf», mit dem einige besser und andere schlechter zurechtkommen. Dies belastet die betroffenen Personen ebenso wie die Angehörigen.</p> <h2>Schulische Systeme als Kulminationspunkt</h2> <p>In der Realität kollidieren insbesondere die unterschiedlichen Schulsysteme und die innerhalb der OECD-Länder hochgradig unterschiedliche Maturitätsquoten (in der Schweiz 20 % , in anderen Ländern bis zu dreimal höher) sowie die spezifische Sprachbarriere zum Hochdeutschen/ Schweizerdeutschen.<br /> Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen wird in Privatschulen untergebracht. Der Unterricht erfolgt meistens in englischer Sprache und ist für die Familie mit hohen Kosten verbunden. Die kognitive und emotionale Dissonanz der Bezugspersonen und der Familie besteht darin, dass die Eltern ein vordergründiges Sicherheitsgefühl bekommen, indem eine internationale Schule mit Renommee ein integriertes Angebot bietet (Unterricht, Interesse für das Kind, Aktivitäten). Die Kinder und Jugendlichen erleben aber im Gegensatz zu den Eltern eine Subkultur, die mit der schweizerischen Realität wenig zu tun hat (kaum Schweizer als Mitschüler, anderes System als die öffentliche Schule, kein Schweizerdeutsch als Sprache).</p> <h2>Zwei typische Kasuistiken</h2> <p><strong>Fall 1</strong><br /> Eine Familie aus Frankreich mit Wurzeln in Israel. 2 Kinder, 2 und 4, die Mutter ist mit dem 3. Kind schwanger. Keine Deutschkenntnisse. Sehr angespannte Paarsituation mit Gewalt durch den Vater gegen die Mutter. Starke Impulsivität beim Vater, Ablehnung der Behandlung. Schweres ADHS mit Dissozialität bei der 4-jährigen Tochter, soziale Isolierung der Mutter, Traumatisierung und Depression. Mangelnde elterliche Aufsicht durch den Vater (von 6.00 bis 21.00 Uhr abwesend, Arbeit am Wochenende sowie Gamesucht). Nach diagnostischer Phase Ablehnung der Medikation und Wunsch nach Coaching durch die Mutter. Abbruch auf Befehl des Vaters. In einem zweiten Schritt erneute Behandlung der Tochter und Kontaktaufnahme mit dem Vater. Motivationsaufbau bei der Mutter gegen die Gewalt, Vermittlung von Handlungsmöglichkeiten. Bearbeitung des Loyalitätskonflikt bei der Tochter und bei der Mutter. Erneuter Abbruch.</p> <p><strong>Fall 2</strong><br /> Schweizer-amerikanische Familie. Die Mutter ist aus den USA mit Wurzeln in Afrika. Der Vater hat die Mutter in den USA kennengelernt. 2 Kinder, 13 und 15. Umzug in die Schweiz. Integrationsschwierigkeiten bei der Mutter, kulturell und sprachlich, Enttäuschung und Frustration. Der 15-jährige Sohn entwickelt eine starke dissoziale Störung. Überforderung der Eltern, Ablehnung der Behandlung beim Sohn. Daher Begleitung der Eltern und Behandlung des Sohnes «aus der Ferne». Schritt für Schritt jedoch mehr Stabilität und letztendlich dank Integration in die öffentliche Schule Rückgang der Dissozialität.</p> <h2>Interventionsansätze</h2> <p>Aufgrund des zumeist hohen allgemeinen psychosozialen Funktionsniveaus bleibt eine Früherkennung seelischer oder entwicklungsneurologischer Störungen oft aus. Da in den meisten Fällen eine ambulante Diagnostik völlig ausreicht und eine stationäre Diagnostik und Therapie schweren Sonderfällen vorbehalten bleiben, könnte eine regionale Netzwerkbildung, auch unter Einbezug der schulpsychologischen Dienste, in diesem Bereich nützlich sein. Bei den Expat-Klienten stehen weniger allgemeine Risikofaktoren (Multifinalität) im Vordergrund, wie sie für psychiatrische Erkrankungen bekannt sind, sondern eher aus der sehr spezifischen familiären Situation heraus erwachsende typische Rahmenbedingungen (Equifinalität), die bei der Therapie- und Interventionsplanung zu berücksichtigen sind.</p> <h2>Spezifische Interventionen</h2> <p>Ist einmal eine ausführliche entwicklungspsychiatrische Diagnostik beim Kind oder Jugendlichen und seiner Familie erfolgt, so folgen die üblichen therapeutischen Ansätze den allseits akzeptierten Leitlinien und bedürfen gewisser Adaptationen an die sprachliche, kulturelle oder soziale Situation der Familie sowie an den begrenzten Aufenthaltsraum und die begrenzten Zeiten, in denen therapeutische Interventionen überhaupt durchgeführt werden können. In erster Linie besteht die Intervention aus Psychoedukation über die Funktionalität der Symptomatik bei den Kindern. Die Eltern involvieren sich auf unterschiedliche Weise, je nach Kultur und Herkunft (hyperinvolviert bis gar nicht im Sinne eines «Reparaturauftrages»). In den meisten Fällen gibt es eine Klagephase bei den Eltern (hoher Stress, mangelnde Integration, soziale Isolierung, Eheprobleme, Missverständnis der Problematik des Kindes) mit dem Wunsch nach einer sehr ausführlichen Abklärung mit rascher Behandlung. Die Kompetenzen der Behandler werden genau geprüft. Eine hohe kulturelle und sprachliche Anpassung wird von diesen schlicht erwartet, ebenso eine ausgeprägte Flexibilität bei der Terminabmachung sowie eine gute Erreichbarkeit. Es ist für die Eltern meistens sehr schwierig zu verstehen, dass die aktuelle Situation (beruflich, geografisch, kulturell) für die Entwicklung ihres Kindes nicht optimal ist.<br /> Die Familie wird in der diagnostischen und therapeutischen Resonanz meistens als stark beschäftigt, belastet und nicht selten als traumatisiert erlebt. Die klinische Exploration des Kindes/Jugendlichen sowie eine wohltuende und empathische Haltung sind sehr zentral, um seine Bedürfnisse zu verstehen. Später geht es darum, Copingstrategien mit der Familie zu erarbeiten, im Sinne einer assimilativen (Veränderung der Situation) bzw. akkommodativen Bewältigung (Anpassung).<br /> Auch stellt sich die Frage nach der Organisation einer Weiterbehandlung am nächsten Arbeitsort bzw. am «eigentlichen » Heimatort. In diesem Kontext zeigen sich dann doch die Unterschiede in den Versorgungssystemen, beispielsweise in Kanada, Frankreich, England oder den USA, sowie in den dort gültigen Versicherungssystemen. Etwas einfacher gestaltet sich die Situation bei Innerschweizer «Binnen- Expats», bei denen die Fortsetzung einer adäquaten Therapie allein schon aufgrund der guten Versorgungslage gewährleistet ist. Hier spielen dann auch regionale Versorgungsbesonderheiten und Versorgungsgepflogenheiten eine wichtige Rolle.</p> <h2>Expat-Situationen bei TherapeutInnen</h2> <p>Auch therapeutische Berufe zeichnen sich durch Flexibilität und ausbildungsoder arbeitsbedingte Ortswechsel aus. Die AutorInnen dieses Beitrags haben Eltern aus der Deutsch-Schweiz, der französischsprachigen Schweiz, aus Deutschland und den USA, sie haben in der Schweiz, in Österreich, Norwegen, Dänemark und Deutschland gearbeitet und gehören in gewisser Weise zu den oben erwähnten «self-initiated expatriates». Für eine empathische und die Ressourcen aktivierende Grundhaltung mag dies ebenso nützlich sein wie die konkrete Kenntnis administrativer oder schulischer Problemkonstellationen, auch für die unmittelbare Akzeptanz und das Arbeitsbündnis ist ein Expat- Status der Therapeutin oder des Therapeuten nützlich.</p> <h2>Zukunftsausblick</h2> <p>Auch wenn Telearbeit, AI, VR, virtuelle Büros, Skype und andere Kommunikationstechniken den unmittelbaren physischen Kontakt in der Arbeitswelt partiell ersetzen, so ist doch im Zuge der Globalisierung und weiteren Vernetzung nicht mit einer Abnahme der Zahl von Expats und ihren spezifischen psychosozialen und psychiatrischen Problemen zu rechnen.<br /> In diesem Kontext wäre es ratsam, spezifische Versorgungsangebote regional, national und später multinational zu entwickeln, um dieser – an sich leistungsfähigen und weitgehend gesunden – Risikopopulation die entsprechenden Angebote zu machen. Eine solide multiaxiale kinderund jugendpsychiatrische Diagnostik könnte je nach Fall bereits am Ausgangsort der Familie erfolgen, Überweisungen und Weiterbehandlungen könnten koordiniert werden und damit könnte eine im Einzelfall notwendige Behandlungskette installiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Schulverantwortliche und TherapeutInnen, letztlich aber die Familien selbst, die mit einem minderjährigen und ggf. besonders vulnerablem Familienmitglied in ein anderes Land ziehen, der Verantwortung dabei bewusst werden.</p> <p><br />Die Autoren danken Frau Prof. Dr. med. Kerstin von Plessen, Chefärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie, CHUV, Lausanne, für ihr Mitwirken und den wertvollen Input zu diesem Expertenbeitrag.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei den Verfassern</p>
</div>
</p>