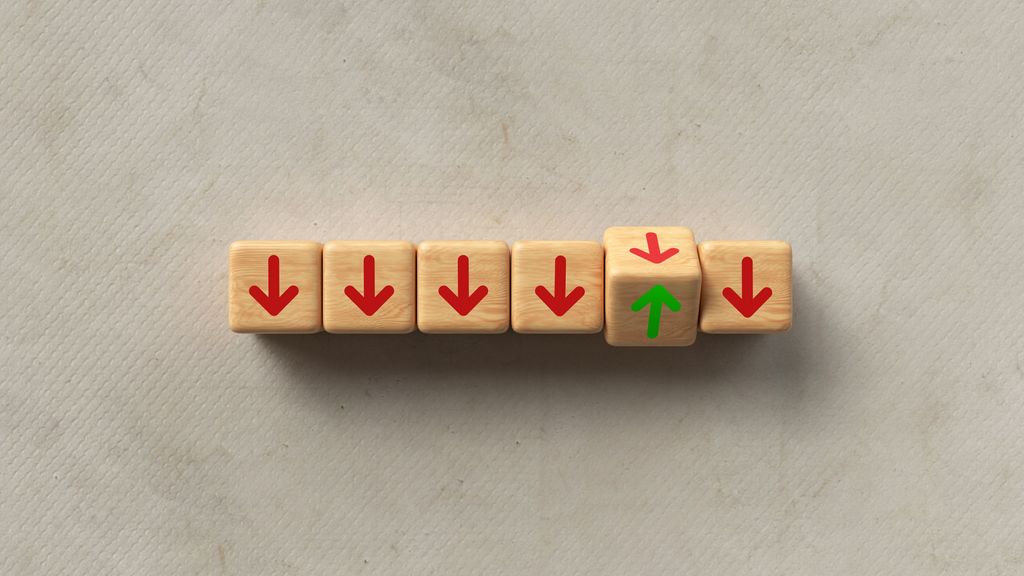
©
Getty Images/iStockphoto
Die amerikanische Opioidkrise: Auswirkungen für Europa?
Jatros
30
Min. Lesezeit
01.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mehr als 200 Teilnehmer nutzten beim traditionsreichen Substitutionsforum der Österreichischen Gesellschaft für arzneimittelgestützte Behandlung von Suchtkrankheit (ÖGABS) die Gelegenheit zur Fortbildung und zum Meinungsaustausch über neue Entwicklungen und aktuelle Aspekte in der Substitutionsbehandlung. Ausgangsthema waren diesmal die Opioidkrise in den USA und deren mögliche Auswirkungen auf die Situation und Zukunft der Substitutionsbehandlung in Europa.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Opioidkrise, die in den USA seit rund zwei Jahrzehnten besteht, zeigt noch immer zunehmende Tendenzen. Zwischen 2010 und 2016 stiegen die Heroinbezogenen Todesfälle in den USA um das 5-Fache an, berichtet Univ.-Prof. Dr. Alfred Springer, 1. Vorsitzender der ÖGABS. Allein zwischen 2015 und 2016 sei ein Anstieg um fast 20 % verzeichnet worden. Im Jahr 2016 seien 15 500 Personen an Heroin-bezogenen Todesfolgen verstorben.<br /><br /> Gründe, die zu diesen Auswüchsen der Opioidkrise führten, sieht Prof. Springer in den grundsätzlichen Schwächen des US-Gesundheitssystems: mangelhafte Versicherungsleistung, hohe Therapiekosten, hohe Medikamentenpreise. Hinzu kommen strukturelle Schwächen des Behandlungsangebots in den USA, die die Akzeptanz und Haltekraft der Therapieangebote beschränken:</p> <ul> <li>Praktizierende Ärzte dürfen nur Buprenorphin/ Naloxon-Kombinationen verschreiben.</li> <li>Methadon darf nur in „Opioid Treatment Programs“ abgegeben werden.</li> <li>Das Angebot an Opiatagonisten ist unzureichend.</li> <li>Die Behandlung ist teuer.</li> <li>Die Dichte an Behandlungsstätten ist gering.</li> </ul> <p>All diese Aspekte tragen, so Prof. Springer, dazu bei, dass Patienten und Abhängige auf akzeptablere und billigere Optionen des Schwarzmarkts ausweichen.</p> <h2>Die Auswirkungen auf Europa</h2> <p>Trends aus den USA finden oft auch mit einiger Verzögerung ihren Weg nach Europa. Hierzulande stellt nach Meinung von Prof. Springer der außermedizinische Gebrauch von opioidhaltigen Arzneimitteln aktuell kein vergleichbares Problem dar; weder was den Anteil der von diesen Stoffen abhängigen Personen an der Suchtklientel betrifft noch hinsichtlich einer drohenden Zunahme von Überdosierungs- Zwischenfällen und Todesfolgen. Eine akute Bedrohung sieht Dr. Thomas Pietschmann, Drug Research Section des United Nations Office on Drugs and Crime, auch für Europa nicht. Die nordamerikanische Opioidkrise sei gekoppelt an die dortigen Verschreibungspraktiken, den Anstieg des Heroinhandels und zunehmend auch an den Schmuggel von synthetischen Opioiden wie Fentanyl-Analoga. Dem stünden striktere Verschreibungspraktiken in Europa sowie ein einfacherer Zugang zum Gesundheitssystem – auch für Randgruppen – gegenüber, sodass der reinen Schmerzbehandlung die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankungen zuvorkommen würde. Zeitgleich sei ein starker Anstieg der Opiumproduktion in Afghanistan zu beobachten und dadurch in den kommenden Jahren mit der Verfügbarkeit von billigem Heroin in Europa zu rechnen. Es ist daher davon auszugehen, dass eine drastische Zunahme des Konsums von Opioiden in Europa in den nächsten Jahren nicht stattfinden wird.</p> <h2>Neue Perspektiven: Hydromorphon</h2> <p>Die Situation bezüglich der Behandlung Opioidabhängiger stellt sich in Österreich relativ positiv dar: Fast zwei Drittel befinden sich in einer Substitutionstherapie („In treatment“-Raten zwischen 53 und 61 % je nach Region).<sup>1</sup> Für die Behandlung sind hierzulande fünf Wirkstoffe zugelassen: D-, L-Methadon, Levomethadon, Buprenophin, Buprenophin/Naloxon und Morphin retard, wobei Letzteres insgesamt am häufigsten eingesetzt wird und in sieben von neun Bundesländern sogar an der Spitze der verordneten Arzneistoffe steht. Die Palette an Therapieoptionen ist somit wesentlich größer als in den meisten anderen europäischen Ländern. Nichtsdestotrotz sehen Experten, so Dr. Hans Haltmayer in seinem Vortrag, auch hierzulande in der Erweiterung der zur Verfügung stehenden Substitutionswirkstoffe um eine i.v. Applikationsoption einen Vorteil. Alle in Österreich einsetzbaren Optionen werden ausschließlich oral eingenommen. Alternative Applikationswege wären daher für jene Patienten wünschenswert, die – aus den verschiedensten Gründen – von dem Angebot der oralen Substitutionsmedikamente nicht ausreichend profitieren.<br /> Interessant erscheinen in diesem Zusammenhang daher die Ergebnisse der SALOME-Studie<sup>2</sup> zur Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit i.v. Hydromorphon (HDM), einem reinen Opiatagonisten. Die Daten dieser doppelblinden, randomisierten, sechsmonatigen Studie zeigten, dass HDM genauso effektiv war wie Diacetylmorphin (DAM). Zudem konnten die Studienteilnehmer die Substanzen in ihrer Wirksamkeit nicht voneinander unterscheiden: 48,5 % der Patienten im HDM-Arm dachten, sie erhalten DAM, und 64,3 % im DAM-Arm dachten, sie erhalten HDM. HDM weist eine Vielzahl von Vorteilen auf. Neben klinischen Vorteilen (z.B. bessere Verträglichkeit) und der geringeren Stigmatisierung im Vergleich zu anderen Substanzen zur Substitution unterliegt HDM nicht den strengen strafrechtlichen Regelungen wie Heroin. Es wird vielmehr als zur Schmerzbehandlung zugelassenes Arzneimittel gehandelt und unterliegt hinsichtlich Verkehrsfähigkeit und Gebarung denselben Regelungen wie Morphin. Diese Vorteile machen HDM daher zum geeigneten Kandidaten zur Erweiterung der oralen Substitutionstherapie um eine i.v. Alternative, vor allem für jene Patienten, die nicht in ein orales Substitutionsprogramm gebracht oder in diesem gehalten werden können.</p> <h2>Europäische Kontroverse zu Opioidagonisten</h2> <p>Über die Situation der Opioidsubstitution in Europa aus Sicht der Betroffenen referierte beim Substitutionsforum Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe. Laut dem Europäischen Drogenbericht 20173 haben in der EU 2015 ca. 650 000 Opioidkonsumenten eine Substitutionsbehandlung erhalten. Dies entspricht einem Rückgang von 2010 bis 2015 von insgesamt 6 % . Die Verteilung innerhalb Europas fiel dabei sehr unterschiedlich aus. Während in manchen Ländern (Spanien, Ungarn, Niederlande, Portugal) ein starker Rückgang von mehr als 25 % beobachtet wurde, stieg in anderen die Zahl deutlich an (Lettland +157 % , Finnland +67 % , Griechenland +61 % ). Ebenso unterlagen die Erreichungsgrade einer großen Variabilität und reichten von 10 bis 30 % in Ländern wie Lettland, Polen, Ungarn und Tschechien bis 80 % in Frankreich. In Deutschland und Österreich erzielt man dabei eine mittlere Reichweite von knapp 30–55 % .<br /><br /> Betrachtet man die eingesetzten Medikamente, so werden europaweit etwa zwei Drittel der Patienten mit Methadon substituiert, 35 % mit Buprenorphin. Injizierbares Diamorphin oder Methadon, retardiertes Morphin, Levomethadon oder Codein kommen nur in 2 % der Fälle zum Einsatz. Anders als in Österreich und Deutschland steht also der relativ breiten Palette an Therapieoptionen eine geringe Anzahl an eingesetzten Präparaten gegenüber. Europäische Patientenorganisationen setzen sich daher für die Ausweitung der Palette und Substitutionsmedikamente ein. So wäre eine deutlich individuellere Behandlung möglich, die Behandlungsprävalenz könnte deutlich gesteigert und die Behandlungsergebnisse könnten in Bezug auf eine Erhöhung der Haltequote und eine Senkung des Beikonsums signifikant verbessert werden. Als Hemmschuh gelten allerdings die in Europa bestehenden Vorbehalte gegenüber Substitutionsmedikamenten. Besonders die Gruppe der Vollagonisten sei mit negativen Zuschreibungen behaftet. Es werden daher alle beteiligten Player – von den Ärzten über die Patienten, die pharmazeutische Industrie und die Krankenkassen bis hin zu den Politikern – gefordert sein, um das gesamte Potenzial der Substitutionsmedikamente im Sinne der Patienten im europäischen Raum zur Anwendung zu bringen.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 21. Substitutionsforum der Österreichischen Gesellschaft
für arzneimittelgestützte Behandlung von Suchtkrankheit,
5.–6. Mai 2018, Mondsee
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> GÖG/ÖBIG: Epidemiologiebericht Sucht 2017. 2017 <strong>2</strong> Oviedo-Jokes E et al.: JAMA Psychiatry 2016; 73(5): 447- 55 <strong>3</strong> EMCDDA: Europäischer Drogenbericht 2017. 2017</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Phytotherapie bei Angsterkrankungen und assoziierten Beschwerden
Pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr Bedeutung in der Psychiatrie. Insbesondere bei Angsterkrankungen und Depressionen stellen Phytotherapeutika eine sinnvolle Alternative zu ...
Machine Learning zur Verbesserung der Versorgung ausländischer Patient:innen
Die zunehmende Diversität aufgrund von Migration bringt spezifische Herausforderungen hinsichtlich Kommunikation, kultureller Deutung von Symptomen sowie institutioneller Strukturen mit ...
Stellungnahme zum Konsensus Statement Schizophrenie 2023
In dem Konsensus Statement Schizophrenie 20231 wurde die Sachlage zur Diagnostik und Therapie schizophrener Erkrankungen in 19 Kapiteln erarbeitet. Doch besteht im Bereich der ...


