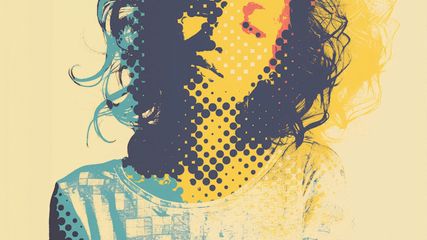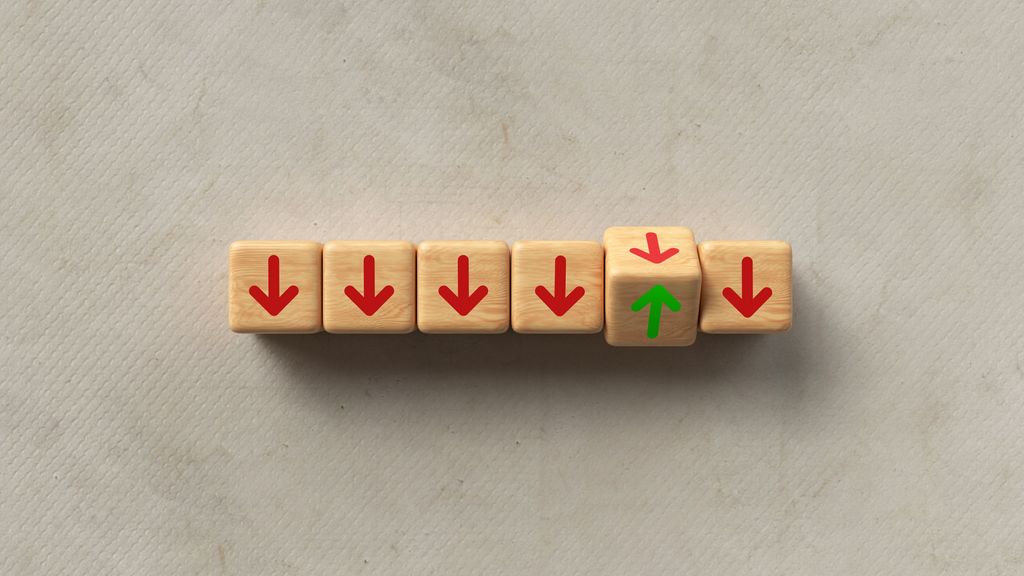
©
Getty Images/iStockphoto
Adulte ADHS und Suchterkrankungen
Jatros
Autor:
Mag. Dr. Laura Brandt
Institut für Angewandte Psychologie: Arbeit, Bildung, Wirtschaft<br>Universität Wien<br>E-Mail: laura.brandt@univie.ac.at
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Es besteht nach wie vor ein Mangel an Anerkennung und Verständnis hinsichtlich der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), besonders im Erwachsenenalter, weshalb oftmals keine korrekte Diagnosestellung und Behandlung erfolgen. Die Prävalenz der ADHS beträgt bis zu 25 % bei Personen mit substanzgebundenen sowie -ungebundenen Süchten (z.B. Glücksspielsucht). Compliance sowie Erfolg bei der Behandlung von Suchterkrankungen sind wesentlich abhängig von einer frühzeitigen, umfassenden Diagnostik und einer adäquaten Behandlung vorliegender Komorbiditäten wie der ADHS.</p>
<p class="article-content"><div id="s53KP.html" xml:lang="de-DE"> <div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das gleichzeitige Auftreten von Suchterkrankungen und (unbehandelter) ADHS verschlechtert die Prognose der Betroffenen.</li> <li>Compliance sowie Erfolg bei der Behandlung von Suchterkrankungen sind wesentlich abhängig von einer frühzeitigen, umfassenden Diagnostik und einer adäquaten Behandlung der ADHS.</li> <li>Optimale Behandlungsprogramme können nur dann durchgeführt werden, wenn alle Komorbiditäten adäquat diagnostiziert werden.</li> <li>Eine adäquate Behandlung der ADHS und anderer Komorbiditäten ist zudem eine unumgängliche (Grund-)Bedingung, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und letztlich die hohen sozialen Kosten, mit denen ADHS und Abhängigkeitserkrankungen verbunden sind, zu reduzieren.</li> </ul> </div> </div> <h2>Adulte ADHS</h2> <p>Beschreibungen der adulten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) finden sich in der psychiatrischen Literatur seit 1976. Aktuell wird angenommen, dass die ADHS mit einer Prävalenz von 3–7 % bei Kindern und 2–5 % bei Erwachsenen eine der häufigsten psychiatrischen Störungen des Kindesalters ist, die bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben (Kooij et al. 2010). Die ADHS beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte soziale Schichten oder Begabungsniveaus. Es besteht nach wie vor ein Mangel an Anerkennung und Verständnis betreffend ADHS, besonders im Erwachsenenalter, weshalb oftmals keine korrekte Diagnosestellung und Behandlung erfolgen, obwohl effektive Behandlungsoptionen verfügbar sind (Adler 2008).<br />Kernsymptome der ADHS sind in allen Lebensphasen Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität. Bei Erwachsenen besonders deutlich sind ein geringes Selbstbewusstsein, emotionale Labilität, Desorganisation im Lebensalltag, ein hohes Aktivitätsniveau bei gleichzeitig auftretenden Motivationsproblemen, Stressüberempfindlichkeit, Schwierigkeiten bei der Temperamentskontrolle sowie eine Tendenz zum „sensation seeking“. In der aktuellen Fassung des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) wurden die 18 im DSM-IV beschriebenen Kernsymptome teilweise um Kriterien für die Lebensbereiche Erwachsener ergänzt. Zudem wurde die Altersgrenze für das erste Auftreten von Symptomen von vormals 7 Jahren auf 12 Jahre erhöht sowie die Zahl der für die Diagnose erforderlichen Symptome für Patienten ab 17 Jahren von 6 auf 5 Symptome reduziert. Diese Änderungen erlauben die Berücksichtigung von ADHS-Symptomen, die erst mit Beginn der Adoleszenz eindeutig identifiziert werden können.<br />Die adulte ADHS ist assoziiert mit Arbeitslosigkeit, niedrigerer Produktivität bei Berufstätigkeit, Irritabilität und niedriger Frustrationstoleranz, einem höheren Risiko für Unfälle, höheren Substanzkonsum- und -abhängigkeitsraten und einem vermehrten Risiko für andere psychiatrische Komorbiditäten – insbesondere wenn sie unbehandelt bleibt (Kooij et al. 2010). Es wird geschätzt, dass zwei Drittel aller Kinder und bis zu 90 % der adulten klinischen Population mit ADHS eine oder mehrere komorbide Störungen aufweisen (Yoshimasu et al. 2017). Die häufigsten Komorbiditäten bei Erwachsenen sind in Abbildung 1 dargestellt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1704_Weblinks_s53.jpg" alt="" width="1417" height="1009" /></p> <h2>ADHS und substanzbezogene Störungen</h2> <p>ADHS ist mit einem früher beginnenden Substanzkonsum, einer schwereren Abhängigkeit, mehr psychiatrischen Diagnosen, einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen Suizidversuch und mehr Hospitalisierungen assoziiert (Arias et al. 2008; Pérez de los Cobos et al. 2011). Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass substanzabhängige Personen mit einer komorbiden ADHS eine höhere Rückfallrate nach einer erfolgreichen Entwöhnung haben (Carroll, Rounsaville 1993). Als Ursachen für den vermehrten Substanzkonsum bei Personen mit einer ADHS werden die erhöhte Impulsivität, der Anschluss an problematische Peergroups, soziale Probleme infolge von Schulabbrüchen, Arbeitsplatzverlust und familiären Problemen sowie der Versuch einer Selbstbehandlung diskutiert. <br />Die geschätzten Prävalenzraten der ADHS in Stichproben von Patienten mit einer Substanzkonsumstörung schwanken zwischen 2 % (Hannesdóttir et al. 2001) und 83 % (Matsumoto et al. 2005). Eine Metaanalyse basierend auf den Ergebnissen aller Studien, die bis 2010 publiziert wurden und bestimmte Qualitätskriterien erfüllten, kam zu dem Ergebnis, dass rund 23 % aller Personen mit einer Substanzkonsumstörung eine komorbide ADHS aufweisen (van Emmerik-van Oortmerssen et al. 2012). Es zeigte sich dabei kein Effekt des Geschlechts auf die ADHS-Prävalenz, obwohl auf Basis von Ergebnissen aus der Allgemeinbevölkerung zu erwarten wäre, dass Männer etwa doppelt so häufig wie Frauen von einer adulten ADHS betroffen sind (Fayyad et al. 2007). Dieses Ergebnis wurde dahingehend interpretiert, dass der ADHS und Substanzkon­sumstörungen ähnliche Risikofaktoren (wie genetische Vulnerabilität) zugrunde liegen, und zwar gleichermaßen bei Frauen und Männern.</p> <h2>ADHS und Glücksspielstörung</h2> <p>Gleichzeitigem Auftreten von ADHS und nicht substanzbezogenen Suchterkrankungen wird aktuell vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei ist die Glücksspielstörung die am häufigsten untersuchte Erkrankung. Zudem ist sie die einzige nicht substanzbezogene Suchterkrankung, die als Diagnose in DSM (seit 1980; Code: 312.31) und ICD (seit 1991; Code: F63.0) erfasst ist. In der rezenten Fassung des DSM wurde die Glücksspielstörung (vormals bezeichnet als pathologisches Glücksspiel) vom Abschnitt „Impulskontrollstörungen“ in das Kapitel „Sucht und zugehörige Störungen“ verschoben. Dies basiert auf der Beobachtung, dass die Glücksspielstörung den substanzbezogenen Störungen in Bezug auf die klinische Präsentation, Veränderungen im Gehirn, Komorbidität, Physiologie und (erfolgreiche) Behandlungsmethoden ähnelt.<br />Die vormalige Einordnung als Impulskontrollstörung in DSM-IV sowie aktuell noch in ICD-10 suggeriert, dass die ADHS und die Glücksspielstörung in Bezug auf verschiedene Aspekte des essenziellen Charakteristikums „Impulsivität“ überlappen. Dies indiziert eine ähnliche Ätiologie sowie eine gehäufte Komorbidität. Darauf weisen auch die vorliegenden Studien hin, die den Zusammenhang der beiden Störungen untersucht haben und eine ADHS-Prävalenz von rund 25 % bei Personen mit einer Glücksspielstörung aufzeigen (Grall-Bronnec et al. 2011). Die Datenlage bezüglich der Komorbidität der Glücksspielstörung und der ADHS (speziell adulter ADHS) ist allerdings nach wie vor mangelhaft.<br />Mit dem Ziel, die Ergebnisse bisheriger Studien zu replizieren, untersuchten Brandt et al. (2017) 80 Patienten (20 % Frauen) mit einem problematischen Glücksspielverhalten, die sich zum Zeitpunkt der Studie in Behandlung befanden, anhand eines standardisierten und strukturierten Interviews. Im Einklang mit vorhergehenden Studien hatten anamnestisch 43 % der Teilnehmenden eine ADHS im Kindesalter und bei 11 % blieb diese bis ins Erwachsenenalter bestehen. Dabei zeigten Personen mit einer adulten ADHS schwerwiegendere Glücksspielprobleme als Patienten ohne eine ADHS-Vorgeschichte. Zudem waren sie schwerer psychiatrisch belastet (durchschnittliche Anzahl psychiatrischer Komorbiditäten: 3,8), verglichen mit Patienten mit einer ADHS-Vorgeschichte in der Kindheit (ohne adulte ADHS) und Patienten ohne ADHS-Vorgeschichte.<br />Die psychiatrische Belastung in der Stichprobe war insgesamt hoch. Über 70 % der untersuchten Personen hatten mindestens eine komorbide Störung und 35 % wiesen sogar drei oder mehr Komorbiditäten auf. Substanzabhängigkeit war ein signifikanter Prädiktor für das Vorliegen einer ADHS-Vorgeschichte: Bei Patienten mit einer Substanzabhängigkeit war die Wahrscheinlichkeit, an einer komorbiden ADHS zu leiden, viermal so hoch. Von allen Personen, die eine ADHS-Krankheitsgeschichte hatten (n=34), hatten nur knapp 9 % jemals eine Medikation erhalten und keiner der Patienten erhielt zum Zeitpunkt der Untersuchung eine pharmakologische ADHS-Behandlung.</p> <h2>Frühes Erkennen und adäquate Behandlung der adulten ADHS</h2> <p>Das gleichzeitige Vorliegen einer adulten ADHS und einer Suchterkrankung ist mit Faktoren assoziiert, die sich negativ auf die Prognose der Betroffenen auswirken. Die vorliegenden Studienergebnisse weisen auf den hohen Stellenwert der Mitberücksichtigung einer ADHS-Vorgeschichte sowie der adulten ADHS bei der Behandlung von Patienten mit einer Suchterkrankung hin. Für ein frühzeitiges Erkennen der ADHS empfiehlt sich als erster Schritt der Einsatz von Screening-Instrumenten, wie der Selbstbeurteilungsskala der Erwachsenen-ADHS (ASRS v1.1; frei zum Download verfügbar unter <a href="http://www.zentrales-adhs-netz.de/fileadmin/ADHS/Fuer_Therapeuten/Materialien/Diagnostik_Erw/Screening-Test_mit_Selbstbeurteilungsskala.pdf">http://www.zentrales-adhs-netz.de/fileadmin/ADHS/Fuer_Therapeuten/Materialien/Diagnostik_Erw/Screening-Test_mit_Selbstbeurteilungsskala.pdf</a>). Diese sind äußerst ökonomisch und liefern wichtige Hinweise, um bei Bedarf einen umfassenden Diagnoseprozess einleiten zu können.<br />Für die pharmakologische Behandlung der ADHS werden Stimulanzien als First-Line-Therapie empfohlen; ca. 70 % der Betroffenen sprechen positiv darauf an (National Institute of Health and Care Excellence, NICE, 2008; Wilens et al. 2008; Heal et al. 2009). Die am häufigsten verschriebenen Pharmazeutika umfassen die Stimulanzien Methylphenidat-Hydrochlorid, Dexamphetaminsulfat und eine Amphetamin/Dexamphetamin-Kombination (Kaye, Darke 2012). Es wird teilweise argumentiert, dass die Behandlung mit Stimulanzien nicht empfehlenswert ist, wenn Substanzmissbrauch bzw. eine Abhängigkeit vorliegt, und zwar wegen des Risikos des Missbrauchs oder der Weitergabe der Medikation (Marsh et al. 2000; Williams et al. 2004). Es liegen allerdings keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege hierfür vor (Kaye, Darke 2012). Vielmehr zeigen sich in der Praxis bei adäquater, indizierter pharmakologischer ADHS-Behandlung eine erhöhte Behandlungscompliance sowie eine Stabilisierung der Substanzkonsumstörung. Fraglos ist ein Monitoring der Patienten bezüglich des Missbrauchs der Medikamente von zentraler klinischer Bedeutung; allerdings darf dies nicht dazu führen, dass betroffenen Personen die Medikation vorenthalten wird. Ein früher Beginn der (medikamentösen) ADHS-Behandlung ist zudem gesundheitsökonomisch und -politisch höchst relevant, aufgrund der sozialen Beeinträchtigungen durch die Erkrankung, des hohen Risikos, andere psychische Erkrankungen zu entwickeln, sowie der hohen gesellschaftlichen Kosten (Bundesministerium für Gesundheit 2013).<br />Eine standardisierte Diagnostik durch Experten wie klinische Psychologen oder Psychiater und eine adäquate Behandlung der ADHS sowie anderer psychiatrischer Komorbiditäten sind Grundvoraussetzungen, um eine Stabilisation der Suchterkrankung zu erreichen, die Lebensqualität der betroffenen Personen zu erhöhen und letztendlich auch die hohen Kosten, die durch Suchterkrankungen und ADHS für die Gesellschaft entstehen, zu senken.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...
«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...