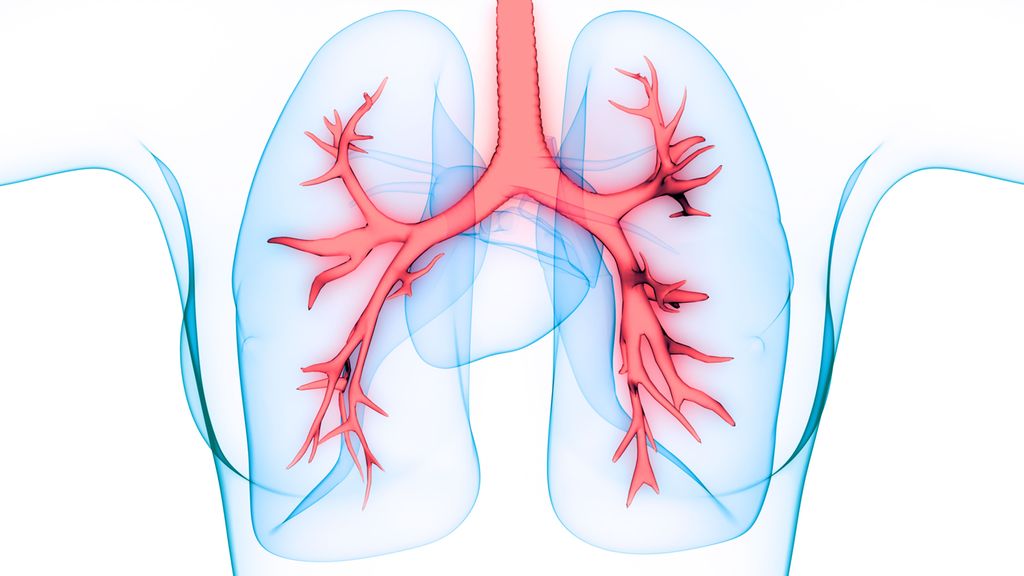
©
Getty Images/iStockphoto
Zwei Höhepunkte aus vielen: pulmonale Hypertonie und interstitielle Lungenerkrankungen
Leading Opinions
Autor:
Claudia Benetti
Medizinjournalistin<br/> <br/> Quelle:<br/> Gemeinsame Jahresversammlung der SGP, SGPP, SGT und SGPH, 16. u. 17. April 2015, Lugano
30
Min. Lesezeit
10.06.2015
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die diesjährige Jahresversammlung der Schweizer Pneumologen in Lugano wartete auch in diesem Jahr wieder mit einem reich befrachteten Programm auf. Der Tagungspräsident Dr. med. Andrea Azzola, Lugano, konnte namhafte nationale und internationale Experten gewinnen, die in gewohnt praxisnaher Art ein umfassendes Update zu den Kernthemen der Pneumologie boten. Wir haben für Sie einige Rosinen herausgepickt.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Für PAH-Patienten (Klasse I nach WHO) und CTEPH-Patienten (Klasse IV) nach WHO gibt es einen von der WHO und NICE 2013 erarbeiteten Behandlungsalgorithmus.</li> <li>Bei PAH-Patienten mit positivem Vasoreaktivitätstest ist eine medikamentöse Therapie indiziert.</li> <li>Bei Patienten mit PAH wirkt sich ein überwachtes Training auf Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und Hämodynamik aus.</li> <li>CTEPH-Patienten sind auf ihre Operabilität zu testen; für inoperable Patienten steht mit Riociguat seit Kurzem auch eine zugelassene medikamentöse Therapie zur Verfügung.</li> <li>Viele Patienten mit einer pulmonalen Hypertonie haben auch Atemstörungen im Schlaf mit einer nächtlichen Hypoxämie. Sie profitieren von einer nächtlichen Sauerstofftherapie (3l/min).</li> <li>Mit Pirfenidon und Nintedanib stehen möglicherweise auch in der Schweiz bald Therapien für interstitielle Lungenkrankheiten zur Verfügung.</li> <li>Die duale Bronchodilatation mit einer LABA/LAMA-Kombination bei COPD ist wirksamer als Monotherapien.</li> </ul> </div> <h2>Pulmonale arterielle Hypertonie</h2> <p>Die pulmonale Hypertonie (PH) ist definiert als Anstieg des mittleren pulmonal-arteriellen Drucks (PAPm) auf ≥25mmHg in der Rechtsherzkatheteruntersuchung und wird gemäss WHO in fünf Gruppen eingeteilt (Tab. 1).<sup>1</sup><br /> Die pathogenetischen Mechanismen der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH) umfassen Vasokonstriktion, Proliferation/Remodeling, Thrombosen sowie genetische und Umwelteinflüsse, die zu einem stetig grösseren Ungleichgewicht zugunsten von Proliferation und Vasokonstriktion gegenüber Apoptose und Vasodilatation führen. Von den pathologischen Veränderungen sind alle Wandschichten der Lungenarterien betroffen mit einer Proliferation von Intima, Media und Adventitia sowie einer Thrombozytenadhäsion und Entzündung des Endothels. Das verbleibende Lumen wird dadurch laufend kleiner und der rechte Ventrikel muss immer mehr leisten, um gegen den steigenden Druck anzukommen. Das Ziel der Therapie muss deshalb die Aufhebung dieses Ungleichgewichts, also das Öffnen der Gefässe sein, um das Herz zu entlasten und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Leading Opinions_Innere_1503_Weblinks_Seite18.jpg" alt="" width="606" height="952" /></p> <p><strong>Therapie</strong><br /> Die Behandlung muss individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten werden. „Für PAH-Patienten (Klasse I nach WHO) steht eine spezifische medi­kamentöse Therapie zur Verfügung“, erklärte die leitende Ärztin PD Dr. med. Silvia Ulrich vom Universi­täts­spital Zürich. Nur für diese Patien­ten gibt es auch ei­nen evidenz­basierten dreistufigen Be­handlungsalgorithmus: 1. Allgemeine Massnahmen und supportive Therapie, 2. Überweisung an ein spezialisiertes Zentrum, 3. Vaso­reaktivitätstest.<br /> Die allgemeinen Massnahmen umfassen Schwangerschaftsverhütung, Pneumokokken- und Grippeimpfung sowie psychosoziale Unterstützung. Zusätzlich wird für PAH-Patienten seit Kurzem ein überwachtes Training empfohlen. Dieses verbessert schon nach drei bis vier Wochen nachweislich die Leistungsfähigkeit, die Lebensqualität und die Hämodynamik. In der Schweiz wird demnächst in Zürich-Wald erstmals ein solches Training im Rahmen eines speziellen Programmes angeboten. Als unterstützende Therapien empfehlen die Guidelines eine Reihe von Massnahmen, wie zum Beispiel:<sup>2</sup></p> <ul> <li>Diuretika bei Rechtsherzinsuffizienz (I/C)</li> <li>Mineralokortikoide bei Rechtsherzinsuffizienz (IIa/B)</li> <li>langfristige Sauerstofftherapie bei idiopathischer und hereditärer PAH und einem pO2 <8kPA (I/C)</li> <li>orale Antikoagulation bei idiopathischer und hereditärer PAH sowie bei PAH in Zusammenhang mit Appetitzüglern (IIa/C)</li> <li>Wiederherstellen des Sinusrhythmus bei Vorhofflimmern (IIa/C)</li> <li>Digoxin bei arterieller Tachykardie (IIb/C)</li> <li>Korrektur von Anämie und Eisenmangel (IIa/B)</li> </ul> <p>„Nebst diesen Massnahmen ist die Überweisung an einen Spezialisten in einem multidisziplinären Zentrum angezeigt“, betonte Ulrich. Hier werden bei Bedarf weitere Abklärungen vorge­nommen, wie beispielsweise ein Vaso­reaktivitätstest. Der Test kann mit verschiedenen Substanzen gemacht werden, am häufigsten wird Stickstoff verwendet. Er ist als positiv zu werten, wenn nach 10 Minuten Inhalation von Stickstoff (10–20ppm) der pulmonal-arterielle Druck um min­- destens 10mmHg sinkt und unter 40mmHg fällt. „Etwa 12 % der PAH-Patienten reagieren auf den Test positiv und bei diesen ist die Behandlung mit einem Kalziumkanalblocker angezeigt. Allerdings hält der positive Effekt dieser Therapie bei <50 % der Patienten langfristig an, weshalb es wichtig ist, diese Patienten regelmässig zu kon­trollieren“, so Ulrich. <br /> Des Weiteren stehen bei Patien­- ten mit einem positiven Testergebnis Prosta­zyklinanaloga wie Epoprostenol, Iloprost und Treprostinil, Endothelin­rezeptor-Antagonisten wie Ambrisentan, Bosentan und Macitentan, PDE-5- Hemmer wie Sildenafil, Tadalafil und Vardenafil sowie der sGC-Stimulator Riociguat zur Verfügung. „Für alle diese Substanzen ist ein Nutzen belegt. Trotzdem gibt es immer Patienten, die die therapeutischen Ziele nicht erreichen und mit einer Wirkstoffkombination behandelt werden müssen“, erläuterte die Pneumologin. In der Schweiz erhalten bereits 50 % der PAH-Patienten eine Kombinationstherapie. Eine Heilung bringt jedoch noch keine dieser Behandlungen. <br /> Patienten mit PH und einer weiteren Lungenkrankheit (Klasse III; Tab. 1) haben ein hohes Risiko für Exazerba­tionen, Hospitalisationen und sinkende Leistungsfähigkeit. „Ihre Prognose ist sehr schlecht“, sagte Ulrich. Bei einem milden Schweregrad wie etwa bei einer COPD mit FEV<sub>1</sub> ≥60 % empfehlen die Guidelines die gleiche Behandlung wie bei einer PAH. Bei einem schwereren Verlauf, wie etwa bei einer COPD mit FEV<sub>1</sub> <60 % , empfehlen die Leitlinien zu prüfen, ob die Patienten für eine Vasodilatation unter Expertenaufsicht oder eine Lungentransplantation geeignet sind.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Leading Opinions_Innere_1503_Weblinks_Seite21.jpg" alt="" width="605" height="473" /></p> <p><strong>CTEPH</strong><br /> Eine zugelassene pharmakologische Therapien gibt es seit Kurzem auch für CTEPH-Patienten (Klasse IV, Tab. 1). Die Substanz Riociguat hat ihren Nutzen in der PATENT-1-Studie unter Beweis gestellt.<sup>3</sup> „Bei CTEPH-Patienten sollte jedoch immer eine Operation als Option geprüft werden“, betonte Prof. Dr. med. Isabelle Schmitt-Opitz, Oberärztin an der Klinik für Thoraxchir­urgie, Universitätsspital Zürich. Die chirurgische Behandlung führt bei geeigneten Patienten zu einer deutlichen klinischen und funktionellen Verbesserung und vermag, insbesondere wenn früh im Krankheitsverlauf operiert wird, eine Vaskulopathie zu verhindern und die Mortalität deutlich zu senken. Die pulmonale Endarterektomie (PEA) ist unter den chirurgischen Therapien die Behandlung der ersten Wahl. „Für junge Patienten ohne Komorbiditäten, die sich für eine PEA nicht eignen oder bei denen eine PEA nicht den gewünschten Behandlungserfolg bringt, kann zudem die Lungentransplantation eine Option sein“, so Opitz.<br /> <br /><strong> Schlafapnoe ist bei Lungenhochdruck häufig</strong><br /> Prof. Dr. med. Robert Thurnheer vom Kantonsspital Münsterlingen riet, bei Patienten mit PH vermehrt auf eine mögliche Schlafapnoe (OSA) zu achten. Zwischen den beiden Erkrankungen gibt es verschiedene Beziehungen. Die PH kann durch ein OSA verursacht werden (PH Klasse III), es können Komorbiditäten vorliegen, wie bei­- spielsweise COPD oder Adipositas, die über eine Hypoventilation zu einer PH und Atemstörungen im Schlaf führen können, und schliesslich kann die PH auch zu einem OSA führen. „Die Prävalenz einer PH bei OSA-Patienten liegt je nach Studie zwischen 17 % und 79 % , allgemein anerkannt ist heute allerdings, dass sie etwa 20 % beträgt“, so Thurnheer. Ein pathogenetisch entscheidender Faktor ist die nächtliche Hypoxämie. Es konnte gezeigt werden, dass sehr viele Patienten mit PH eine nächtliche Hypoxämie haben und dass zwischen nächtlicher Sauerstoffsättigung und pulmonalem Druck eine deutliche Korrelation besteht.<sup>4</sup> „Je tiefer die Sättigung in der Nacht, desto höher ist der Druck“, so Thurnheer. „Da die Sättigung am Tag meistens normal ist, wird die nächtliche Hyp­oxämie in der Praxis massiv unterschätzt.“ In einer soeben publizierten Zürcher Studie konnte gezeigt werden, dass bei PH-Patienten mit nächtlichen Atemstörungen und optimaler medikamentöser Therapie mittels nächtlicher Sauerstofftherapie (NOT; 3l/min) eine deutliche Verbesserung erreicht wer­­­- den kann.<sup>5</sup> Bereits eine Woche NOT verbesserte den 6-Minuten-Gehtest und die Hämodynamik signifikant. Die „number needed to treat“ für die Verbesserung von NYHA III/IV zu NYHA I/II beträgt 5.<br /> Bei Patienten mit PH und OAS können mittels CPAP der pulmonal-arterielle Druck und der pulmonale Gefässwider­stand signifikant gesenkt werden.<sup>6</sup> Bei Patienten mit PH und Hypoventilation kann mithilfe der nicht invasiven Ventilation eine signifikante Verbesserung des pulmonal-arteriellen Drucks, der hämodynamischen Parameter und des 6-Minuten-Gehtests erreicht werden.<sup>7</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Leading Opinions_Innere_1503_Weblinks_Seite22.jpg" alt="" width="492" height="508" /></p> <h2>Neue Therapieoptionen bei ILF</h2> <p>Die interstitiellen Lungenkrankheiten (ILD) umfassen eine Gruppe von rund 200 schweren und seltenen Lungenparenchymerkrankungen, darunter auch die idiopathische Lungenfibrose (ILF). Die Prognose für ILD-Patienten ist sehr schlecht. Einige Entitäten sind sogar mit einer höheren Sterblichkeit assoziiert als viele Krebserkrankungen. Trotz intensiver Suche gab es bis vor Kurzem keine spezifischen Therapien. „Mit Pirfenidon und Nintedanib haben wir nun zwei vielversprechende Subs­- tanzen“, erklärte Prof. Dr. med. Luca Richeldi, Universitätsspital Sout­hamp­ton, England. Pirfenidon (Esbriet<sup>®</sup>) ist in Europa seit 2011 und in den USA seit wenigen Monaten auf dem Markt und dürfte auch in der Schweiz bald die Zulassung erhalten. Das Medikament hat eine antifibrotische und entzündungshemmende Wirkung und greift in verschiedene pathophysiologische Mechanismen der Erkrankung ein. In der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten ASCEND-Studie<sup>8</sup> mit insgesamt 555 ILF-Patienten nahm die Vitalkapazität bei den Patienten, die mit Pirfenidon behandelt wurden, deutlich weniger ab. Auch die Mortalität konnte im Vergleich zur Placebogruppe in der Studie signifikant gesenkt werden. Wie Richeldi ausführte, reduzierte sich das Risiko für Krankheitsprogression und Tod unter Pirfenidon um insgesamt 43 % gegenüber der Kontrollgruppe (Abb. 1). Das Medikament wurde relativ gut vertragen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehörten Übelkeit, Verdauungsbeschwerden und Hautausschlag.<br /> Noch nicht zugelassen ist der Tyrosinkinaseinhibitor Nintedanib. Die beiden klinischen Studien INPULSIS I und II liefern jedoch vielversprechende Daten. Eingeschlossen waren insgesamt 1066 Patienten mit einer um 50 % eingeschränkten Vitalkapazität. Gemäss Richeldi verlangsamte Nintedanib die weitere Progression der Krankheit gegenüber Placebo deutlich. In der INPULSIS-II-Studie reduzierte die Substanz zudem die Zahl der Exazerbationen. In beiden Studien war auch ein Trend zu weniger Todesfällen zu sehen. Die Verträglichkeit war gut. Häufigste beobachtete Nebenwirkung war Diarrhö.</p> <h2>Korrekte Diagnose bei ILD wird wichtig</h2> <p>Wie Dr. med. Romain Lazor, CHUV, Lausanne, ausführte, zeigte eine Studie, dass Nintedanib auch die Anzahl der Exazerbationen bei ILD reduzieren konnte. „Es ist durchaus möglich, dass uns mit Nintedanib bald ein Medikament zur Prävention von Exazerbationen bei ILD zur Verfügung steht“, führte er aus. „Akute Exazerbationen sind bei ILD-Patienten eine häufige Todesursache. Sie werden oft mit Steroiden behandelt. Die Wirkung ist jedoch nicht belegt“, sagte Lazor und riet, hoch dosierte Steroide nur sehr zurückhaltend einzusetzen. <br /> Der Krankheitsverlauf kann durch die Behandlung von Komorbiditäten nachweislich verzögert werden.<br /> „Mit den neuen Möglichkeiten, die sich mit Pirfenidon und Nintedanib abzeichnen, rückt auch die Diagnose der ILD stärker in den Fokus“, erläuterte Prof. Dr. med. Thomas Geiser, Chefarzt Pneumologie, Universitätsspital Bern. Denn eine korrekte Diagnose sei für ein effektives Management zentral. Die Anamnese liefert meist schon erste Hinweise auf eine ILD. Häufige Merkmale sind Dyspnoe, Husten und Rasselgeräusche. Eine positive Familienanamnese, Exposition gegenüber Noxen und die Einnahme bestimmter Medikamente können weitere Anhaltspunkte sein. Zur Abklärung gehört immer auch ein Routinelabor mit BSR, Blutbild, Leber- und Nierenparameter und CRP. „Oft wird die Diagnose erst spät gestellt, weil die Dyspnoe initial dem Alter, einer Herzerkrankung oder, v.a. bei Rauchern, einem Emphysem zugeschrieben wird. Es ist deshalb wichtig, an eine ILD zu denken und bei klinischem Verdacht frühzeitig ei­- nen Spezialisten in einem interdis­zipli­nären Zentrum zu konsultieren“, betonte Geiser. Wegen der vielen Enti­tä­- ten ist die Differenzialdiagnose bei ILD nicht ganz einfach und oft nur mit ei­­- ner Bronchoskopie und/oder einer Com­- putertomografie überhaupt möglich.</p> <h2>COPD: LABA/LAMA-Kombinationen effektiver als Monotherapien</h2> <p>Die GOLD-Gruppe empfiehlt für die Behandlung der COPD neu in allen Krankheitsstadien eine Bronchodilatation sowie bereits ab Schweregrad B den Einsatz eines lang wirksamen Beta-2-Sympathomimetikums (LABA) oder eines lang wirksamen Muskarinantagonisten (LAMA). Eine duale Bronchodilatation mit einer LABA/LAMA-Kombination wird nur als Zweitlinientherapie aufgeführt. „Das kann sich jedoch schon bald ändern“, erklärte Dr. med. Andrea Azzola, Leitender Arzt Pneumologie, Ospedale Civico, Lugano.<br /> Daten aus dem IGNITE-Programm belegen nämlich: Die LABA/LAMA-Kombination ist den Monotherapien überlegen.<sup>9</sup> Die Kombination Inda­­cate­- rol/Glycopyrronium (Ultibro<sup>®</sup> Breez-haler<sup>®</sup>) etwa ist hinsichtlich der Lungenfunktion (FEV1) gegenüber den Monotherapien deutlich von Vorteil. Sie schneidet auch signifikant besser ab als die ICS/LABA-Fixkombination (Salmeterol/Fluticason) und die freie Kombination von Tiotropium und Formoterol.<sup>10, 11</sup> Die Studien weisen ausserdem auf einen Vorteil der Kombination hinsichtlich der Exazerbationen hin.12 „Die Verträglichkeit von LABA/LAMA-Kombinationen ist gut, die Sicherheit von LAMA- und LABA-Monotherapien zudem gut belegt“, so Azzola. <br /> In der Schweiz sind zurzeit die LABA/LAMA-Kombination Indacaterol/Glycopyrronium (Ultibro<sup>®</sup> Breezhaler<sup>®</sup>) und Umeclidinium/Vilanterol (Anoro<sup>®</sup> Ellipta<sup>®</sup>) auf dem Markt. In Kürze zu­gelassen werden soll Aclidinium/ Formoterol. Andere Kombinationen wie Tiotropium/Olodaterol und For­mo­terol/Glycopyrrolat werden derzeit in Phase-III-Studien geprüft. Die beste Evidenz gibt es gemäss Azzola aktuell für Indacaterol/Glycopyrronium. In den Studien mit dieser Kombination waren insgesamt mehr als 11 000 Patienten eingeschlossen.</p> <h2>Allergisches Asthma: Kann Omalizumab gestoppt werden?</h2> <p>Seit Herbst 2014 empfehlen die GINA-Guidelines<sup>14</sup> bei schwerem allergischem Asthma auf der Behandlungsstufe 5 als bevorzugte Therapie den rekombinanten, humanisierten mono­klonalen IgE-Antikörper Omalizumab (Xolair<sup>®</sup>). Wirksamkeit und Sicherheit von Omalizumab wurden an mittlerweile >10 000 Patienten mit schwerem allergischem Asthma nachgewiesen und das Medikament wurde weltweit >130 000 Patienten verordnet. „Eine wichtige Frage, die sich uns heute stellt, ist, ob wir die Therapie auch wieder stoppen können“, führte Prof. Dr. med. Jörg Leuppi, Chefarzt, Kantonsspital Baselland, Liestal, aus.<br /> <br /> Eine kürzlich durchgeführte Beobach­tungsstudie zeigt, dass 13 Monate nach Absetzen der Therapie mit Omalizumab bei 55,7 % der Patienten die Asthmakontrolle verloren ging.<sup>15</sup> Mehr als 70 % dieser Patienten sprachen jedoch auf eine neuerliche Therapie mit Xolair<sup>®</sup> wieder an. Eine andere randomisierte, placebokontrollierte Studie untersuchte die Exazerbationshäufigkeit, wenn die Therapie nach 5 Jahren Behandlung beendet wird.<sup>16</sup> Die Studie zeigte: Bei 67 % der Patienten, die weiter Omalizumab erhielten, kam es zu keiner Verschlechterung, in der Pla­cebogruppe waren es 47 % . „Welche Patienten nach Therapieende ein Risiko für Exazerbationen haben, wissen wir allerdings noch nicht, dies muss erst in Studien untersucht werden“, so Leuppi.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Medizinjournalistin<br/>
<br/>
Quelle:<br/>
Gemeinsame Jahresversammlung der
SGP, SGPP, SGT und SGPH,
16. u. 17. April 2015, Lugano
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Simonneau G et al: Updated clinical classification of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2013; 62(25 Suppl): D34-41<br /><strong>2</strong> Grünig E et al: [Supportive therapy in pulmonary arterial hypertension]. Dtsch Med Wochenschr 2014; 139(Suppl 4): S136-141<br /><strong>3</strong> Ghofrani HA et al; PATENT-1 Study Group: Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2013; 369: 330-340<br /><strong>4</strong> Hildenbrand FF et al: Daytime measurements underestimate nocturnal oxygen desaturations in pulmonary arterial and chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Respiration 2012; 84: 477-484<br /><strong>5</strong> Ulrich S et al: Effect of nocturnal oxygen and acetazolamide on exercise performance in patients with pre-capillary pulmonary hypertension and sleep-disturbed breathing: randomized, double-blind, cross-over trial. Eur Heart J 2015; 36: 615-623<br /><strong>6</strong> Sajkov D et al: Continuous positive airway pressure treatment improves pulmonary hemodynamics in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 152-158<br /><strong>7</strong> Held M et al: Functional impact of pulmonary hypertension due to hypoventilation and changes under non­invasive ventilation. Eur Respir J 2014; 43: 156-165<br /><strong>8</strong> King TE et al; ASCEND Study Group: A phase 3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; 370: 2083-2092<br /><strong>9</strong> Rabe KF et al: Comparison of a combination of tiotropium plus formoterol to salmeterol plus fluticasone in moderate COPD. Chest 2008; 134: 255-262<br /><strong>10</strong> Vogelmeier CF et al: Efficacy and safety of once-daily OVA149 compared with twice-daily salmeterol-fluticasone in patients with chronic obstructive pulmonary disease (ILLUMINATE): a randomized, double-blind, parallel group study. Lancet Respir Med 2013; 1: 51-60<br /><strong>11</strong> Buhl R et al: Efficacy and safety of once-daily QVA149 compared with the free combination of once-daily tio­tropium plus twice-daily formoterol in patients with moderate-to-severe COPD (QUANTIFY): a randomised, non-inferiority study. Thorax 2015; 70: 311-319<br /><strong>12</strong> Wedzicha JA et al: Analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared with glycopyrronium and tiotropium (SPARK): a randomised, double-blind, parallel-group study. Lancet Respir Med 2013; 1: 199-209<br /><strong>13</strong> Köhnlein T et al: Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic ob­structive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014; 2: 698-705<br /><strong>14</strong> www.ginasthma.org/documents/1<br /><strong>15</strong> Molimard M et al: Observational study in severe asthmatic patients after discontinuation of omalizumab for good asthma control. Respir Med 2014; 108: 571-576<br /><strong>16</strong> Busse et al: Präsentiert an der internationalen Konferenz der European Respiratory Society in München 2014</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wenig genützte Chance: COPD-Therapie abseits der Medikamente
Neben der medikamentösen Behandlung spielen im Management der COPD nicht-medikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dies betrifft vor allem die pulmonale Rehabilitation, die ...
Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg
Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...


