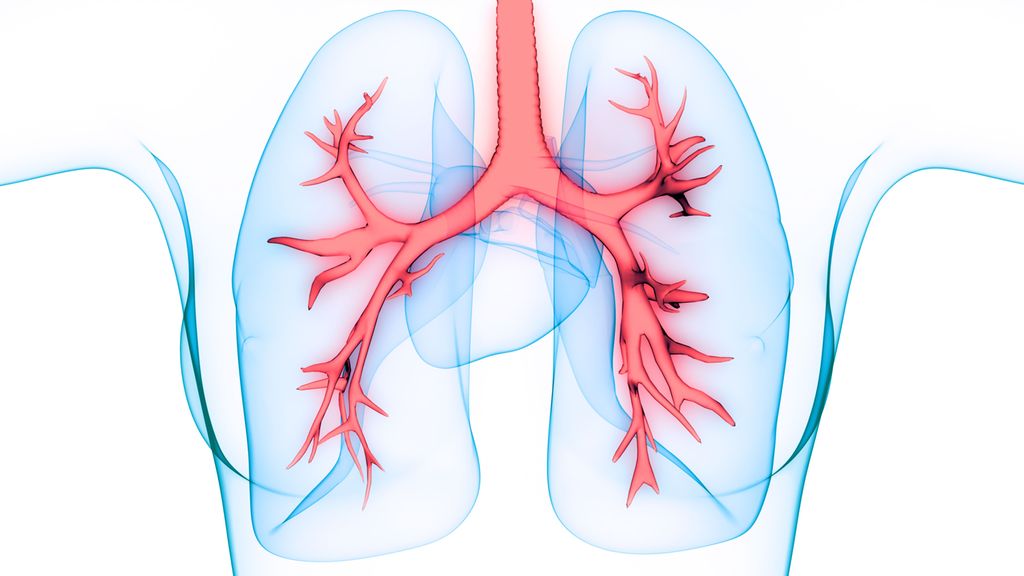
©
Getty Images/iStockphoto
Wie beeinflussen die Therapie der COPD und die des Lungenkarzinoms einander?
Jatros
Autor:
Prof. Dr. Christian Schumann
Klinik für Pneumologie, Thoraxonkologie, <br/>Schlaf- und Beatmungsmedizin<br>Klinikverbund Kempten-Oberallgäu<br>E-Mail: christian.schumann@kv-keoa.de
30
Min. Lesezeit
04.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Nicht selten treten COPD und Lungenkarzinom gemeinsam auf; ihre Behandlung bedarf daher eines aufeinander abgestimmten therapeutischen Managements. Dieser Artikel bietet eine Darstellung der verschiedenen Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind, und geht insbesondere auf Konvergenzen, Parallelen und Divergenzen in der Versorgung der betroffenen Patienten ein.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>COPD und Lungenkarzinom sind nicht heilbare, aber teilweise behandelbare Erkrankungen; in späten Stadien kann die Prognose vergleichbar schlecht sein.</li> <li>Häufig gemeinsames Auftreten beider Erkrankungen; systemische Auswirkungen von Erkrankung und Therapie stellen einen wichtigen therapeutischen Ansatz dar.</li> <li>Besonders hervorzuheben sind bei guter Prognose die Nikotinkarenz und die Beachtung der Komorbiditäten sowie bei schlechter Prognose die supportive und palliative Therapie.</li> <li>Inwieweit die antiinflammatorische Therapie einen Einfluss auf die Behandlung des Lungenkarzinoms hat, ist noch nicht geklärt.</li> </ul> </div> <p>Die COPD ist eine obstruktive Atemwegserkrankung mit chronischer pulmonaler und systemischer Inflammation, die geprägt ist durch rezidivierende Exazerbationen und einen unaufhaltsamen Verlust an FEV1 in der Lungenfunktion. Hauptursache ist das Rauchen.<br />Das Lungenkarzinom ist in den meisten Fällen eine nicht heilbare Krebserkrankung. Dennoch sind längere Krankheitsverläufe möglich. Fortschritte in der Diagnostik und Therapie lassen gerade in den letzten Monaten und Jahren Hoffnung zu, dass mehr Patienten immer länger mit der Erkrankung leben können. Rauchen ist auch für Lungenkrebs die wesentliche Ursache.</p> <h2>Behandlungsziele</h2> <p>Bei der COPD steht die Reduktion der Belastungsdyspnoe im Fokus der Therapie, die ein quälender Begleiter der Patienten ist und sie täglich an die Erkrankung erinnert. In den letzten Jahren ist die Erkenntnis gewonnen worden, dass die gleichzeitige Mitbehandlung der relevanten Begleiterkrankungen der COPD, v.a. kardiovaskulärer, metabolischer und psychischer Komorbiditäten, einen günstigen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und die Mortalität haben kann.<br />Beim Lungenkarzinom lautet die primäre Frage: „Ist eine Heilung möglich?“ Sie kann nur für die frühen Stadien bejaht werden. Daneben stellt sich die Frage nach der Verlängerung des Lebens, also der Überlebenszeit mit der Krebserkrankung, die wesentlich schwieriger zu beantworten ist. Die allermeisten Patienten wünschen sich mehr Überlebenszeit, aber nicht um jeden Preis. Der Erhalt der Lebensqualität ist aus der besonderen Sicht der Patienten und Angehörigen ausschlaggebend. Bestehen bei Erstdiagnose bereits schwere tumorbedingte Symptome, so ist das primäre Ziel der Behandlung eine rasche Besserung dieser Beschwerden. Die Komorbiditäten beim Lungenkarzinom, vergleichbar mit denen bei der COPD, sind oft limitierend für ein intensives, multimodales Behandlungskonzept.<br />In der Betrachtung beider Erkrankungen, die zu einem Großteil (ca. 50 % ) zusammen auftreten, lassen sich also gemeinsame Behandlungsziele definieren:<br />• Linderung krankheitsspezifischer Symptome<br />• Erhalt der Lebensqualität<br />• Verlängerung des Überlebens</p> <h2>Gibt es Überlappungen in der Behandlung?</h2> <h2>Raucherentwöhnung</h2> <p>Historische Daten beschreiben bereits den Zusammenhang zwischen frühzeitigem Rauchstopp und weniger Verlust an FEV1 in der Lungenfunktion. Bei der COPD ist der Vorteil durch eine Raucherentwöhnung unumstritten, gemeinhin jedoch schwer umzusetzen. Ohne ein strukturiertes Programm zur Raucherentwöhnung schaffen es die meisten Patienten nicht und werden rückfällig.<br />Beim Lungenkarzinom ist aufgrund der meist „todbringenden“ Diagnose der Rauchstopp zunächst nicht das wichtigste therapeutische Ziel für Patient und Arzt. Eine differenzierte Betrachtung der Szenarien jedoch zeigt eine Chance auf: Rauchstopp kann in bestimmten Situationen doch gelingen.<br />Wenn beim <span class="Copy-italic">Lungenkrebs-Screening</span> ein suspekter Befund in der Computertomografie des Thorax vorliegt, besteht – wie Studiendaten zeigen – eine hohe Motivation für Raucherentwöhnung. Dies kann eine individuelle Chance darstellen, endgültig mit dem Rauchen aufzuhören, auch wenn sich in der Folge der Krebsverdacht nicht erhärtet.<sup>1, 2</sup><br />Bei der Behandlung des <span class="Copy-italic">Frühkarzinoms</span> mit einem kurativen Therapieansatz haben aktive Raucher ein höheres Risiko: Bei einer Lungenoperation haben Raucher eine erhöhte Mortalität und pulmonale Komplikationsrate als Nieraucher oder ehemalige Raucher. Insbesondere eine präoperative Nikotinkarenz wirkt sich günstig aus.<sup>3, 4</sup><br />Beim<span class="Copy-italic"> lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Lungenkarzinom</span> ist die Motivation für eine Raucherentwöhnung initial nach Diagnosestellung am höchsten. Bereits wenige Monate später lässt der initial psychologisch günstig erscheinende Moment (infolge der fatalen Diagnose Krebs) wieder nach.<sup>5, 6</sup><br /><span class="Copy-italic">Warum ist nun die Raucherentwöhnung eine mögliche Behandlungsoption beim Lungenkarzinom?</span> Beim Screening und auch beim Frühkarzinom hat die Raucherentwöhnung präventiven Charakter. Das Auftreten von Malignomen und therapieassoziierten Komplikationen kann reduziert werden und ist ein sinnvolles Ziel. In der metastasierten Situation kann der Rauchstopp einen Einfluss auf die Mortalität bezüglich der Krebserkrankung nehmen, insbesondere wenn ein chronischer Verlauf vermutet wird. Dies kann insbesondere bei initial sehr gutem Ansprechen mit deutlicher Reduktion der Tumormassen oder prätherapeutisch hoher Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Ansprechen der Fall sein. Hier sind die neuen Behandlungsmöglichkeiten im Bereich der immunonkologischen Therapie, aber auch der zielgerichteten Therapie bei Vorliegen von molekularen Alterationen typische Beispiele. Nicht selten sind mehrjährige Verläufe möglich.<br />Besonders deutlich werden die Parallelen der beiden Erkrankungen in der Prognose, wenn wir die sehr schwere COPD (GOLD 4 mit FEV1 <30 % vom Soll) und das Stadium IV des Lungenkarzinoms isoliert betrachten. Das mediane Überleben kann jeweils auf ca. 30 Monate limitiert sein (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1702_Weblinks_s14.jpg" alt="" width="2150" height="1503" /></p> <h2>Behandlung der Komorbiditäten</h2> <p>Nicht nur bei der COPD, sondern auch beim Lungenkarzinom können die Begleit­erkrankungen relevant sein. Immer häufiger sehen wir aufgrund der Innovationen in der Therapie beim Lungenkarzinom mehrjährige Behandlungsverläufe. Organdysfunktionen können ein limitierender Faktor sein. Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz und Leberfunktionsstörungen lassen nicht jede Chemotherapie zu. Aber auch zielgerichtete Substanzen und Immuntherapien sind bei multimorbiden Patienten teils kontraindiziert oder mit deutlich mehr Toxizität assoziiert. So kommt es, auch Studiendaten nach, beim Lungenkarzinom vermehrt zu nicht krebsbedingter Mortalität. Neben der Verbesserung des Outcomes beim Lungenkarzinom liegt in der ganzheitlichen Therapie mit Berücksichtigung der Begleiterkrankung inklusive der COPD noch ein großes Potenzial zur Verbesserung von Lebensqualität und Gesamtüberleben.</p> <h2>Antiinflammatorische Therapie</h2> <p>Bei der COPD sind inhalative Steroide, selektive Phosphodiesterase-Inhibitoren und systemische Steroide die Grundlage der chronischen und der akuten antiinflammatorischen Therapie. In Studien konnte durch Anwendung von inhalativen Steroiden eine Reduktion der Exazerbationsrate erreicht werden, die bestimmend für die Mortalität ist.<br />Beim Lungenkarzinom spielen antiinflammatorische Konzepte bislang keine Rolle. Interessant ist aber, dass sich in einigen Studien zur COPD Hinweise auf die Reduktion der Lungenkrebsrate unter einer Therapie mit inhalativen Steroiden ergeben haben. Diese stammen häufiger aus Registerdaten mit längerem Follow-up. Dabei scheint eine höhere Dosis inhalativer Steroide umso effektiver zu sein; in randomisierten Studien konnte das nicht eruiert werden, oft ist der Beobachtungszeitraum hier wesentlich kürzer und die Studien sind nicht geeignet, um einen derartigen Effekt zu zeigen.<sup>7</sup><br /><span class="Copy-italic">Raucher mit COPD haben ein circa dreifach höheres Lungenkrebsrisiko als Nichtraucher mit COPD.</span> Grundlage der antiinflammatorischen Therapie zur Reduktion des Lungenkarzinomrisikos bei COPD kann das pathophysiologische Konzept sein, dass bei der COPD bereits protektive Enzymsysteme in der Aktivität vermindert bzw. aufgebraucht sind. Ein fortwährender Einfluss inhalativer Noxen, wie z.B. das Rauchen, ist ein zusätzlicher proinflammatorischer Trigger der Karzinogenese und erhöht das Lungenkrebsrisiko nochmals.</p> <h2>Supportive Therapie</h2> <p>Vermeidung und Behandlung der <span class="Copy-italic">Kachexie</span> ist ein grundsätzlich anerkanntes Behandlungskonzept für beide Erkrankungen, verbessert die Lebensqualität und kann Einfluss auf das Überleben haben.<br />Die <span class="Copy-italic">Langzeitsauerstofftherapie</span> ist vielfach indiziert und wird gemäß den aktuellen Leitlinien und Empfehlungen bei COPD und in Parallelität dazu beim Lungenkarzinom angewandt.</p> <h2>Palliative Therapie</h2> <p>Die <span class="Copy-italic">Schmerztherapie</span> wirkt sowohl beim Lungenkarzinom (metastasenbedingt) als auch bei der COPD (ossäre Komplikationen) symptomlindernd und kann zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Auch die Reduktion von Dyspnoe in der terminalen Lebensphase ist ein Ziel der Opiattherapie beider Erkrankungen.<br />Die <span class="Copy-italic">nicht invasive Beatmung (NIV)</span> ist bei der COPD als Intervention bei akuter Hyperkapnie, z.B. im Rahmen einer Exazerbation, wie auch als Heimbeatmung bei chronischer Hyperkapnie etabliert. Beim Lungenkarzinom wird die NIV in der Terminalphase zur Symptomlinderung eingesetzt, meist in Kombination mit Opiaten.<br />Die <span class="Copy-italic">interventionellen Behandlungsmöglichkeiten</span> (z.B. Lungenvolumenreduktion beim Lungenemphysem) können beim Lungenkarzinom in Einzelfällen (gute Prognose) angewandt werden. Das Ziel sind immer eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Reduktion der Dyspnoe. Die Indikation und Durchführung derartiger Eingriffe sollte sorgfältig geprüft werden. Dies kann in einem interdisziplinären Thoraxboard erfolgen. Eine Anbindung an ein in solchen Eingriffen erfahrenes Zentrum ist erforderlich. Aber auch interventionelle Verfahren bei endobronchialem Tumorbefall sind stets abzuwägen und in der Hand des erfahrenen Pneumologen gut etabliert. So können Retentionspneumonien, Stenosen der zentralen Atemwege und Tumorblutungen mit rascher Verbesserung der Symptomatik durch mechanische oder thermische Verfahren oder Stenting behandelt werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Zeliadt SB et al: Attitudes and perceptions about smoking cessation in the context of lung cancer screening. JAMA Intern Med 2015; 175(9): 1530-1537 <strong>2</strong> Tammemägi MC et al: Impact of lung cancer screening results on smoking cessation. J Natl Cancer Inst 2014; 106(6): dju084 <strong>3</strong> Mason DP et al: Impact of smoking cessation before resection of lung cancer: a Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Surgery Database study. Ann Thorac Surg 2009; 88(2): 362-370 <strong>4</strong> Groth SS et al: Impact of preoperative smoking status on postoperative complication rates and pulmonary function test results 1-year following pulmonary resection for non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2009; 64(3): 352-357 <strong>5</strong> Leone FT et al: Treatment of tobacco use in lung cancer: diagnosis and mangement of lung cancer, 3<sup>rd</sup> ed: American College of Chest Phys­icians ecidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013; 143(5 Suppl): e61S-e77S <strong>6</strong> Sanderson Cox L et al: Tobacco use outcomes among patients with lung cancer treated for nicotine dependence. J Clin Oncol 2002; 20(16): 3461-3469 <strong>7</strong> Raymakers A et al: Do inhaled corticosteroids protect against lung cancer in patients with COPD? A systematic review. Respirology 2017; 22: 61-70</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


