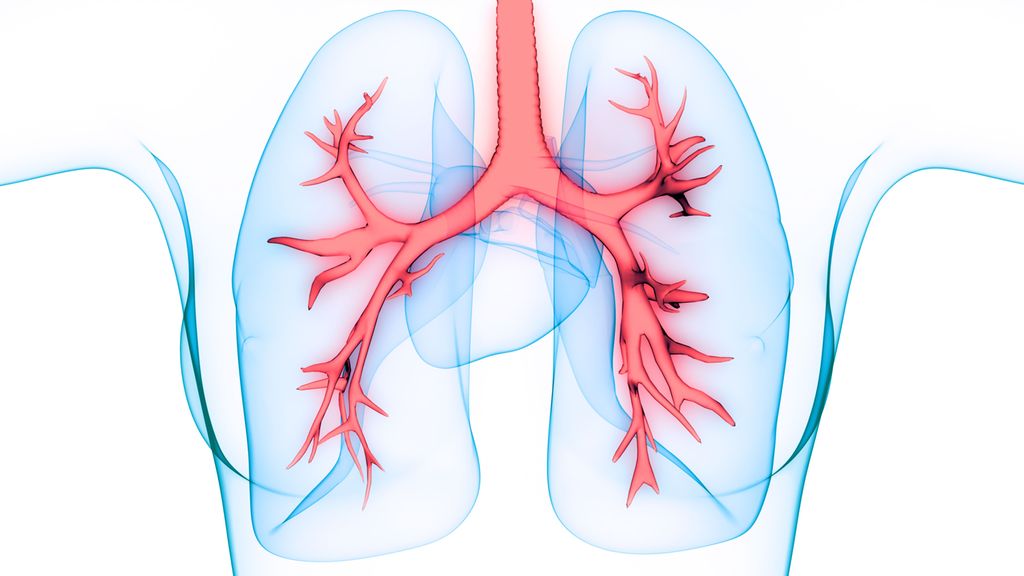
©
Getty Images/iStockphoto
Spiroergometrische Untersuchung bei Hobby- und Leistungssportlern
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Matthias Krüll
Facharzt für innere Medizin, Pneumologie, Infektiologie, Taucharzt (GTÜM e. V.), Notarzt<br> Medical Director BMW Berlin Marathon und SCCEvents GmbH<br> CEO Institut für Allergie- und Asthmaforschung Berlin, IAAB<br> E-Mail: kruell@pneumologie-berlin.de
30
Min. Lesezeit
15.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In der pneumologischen und kardiologischen Sprechstunde ist die Dyspnoe, vor allem bei Belastung, eines der Hauptsymptome und verantwortlich für eine teils erhebliche Einschränkung der Lebensqualität der betroffenen Patienten. Mittels einer Spiroergometrie lassen sich die Ursachen dieser Limitierungen in den allermeisten Fällen herausarbeiten.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Spiroergometrie ist die valideste Technik zur Erfassung der kardiopulmonalen Gesamtbelastbarkeit.</li> <li>Sie ist immer dann sinnvoll, wenn die aerobe Kapazität eine limitierende Einflussgröße für den Wettkampferfolg darstellt.</li> <li>Nur mit dieser Technik ist eine individuelle Trainingssteuerung möglich.</li> <li>Sie ist allerdings sehr komplex in der Durchführung aufgrund des hohen apparativen Aufwandes sowie in der Auswertung aufgrund der Vielzahl an gewonnenen Daten.</li> </ul> </div> <p>Die Spiroergometrie ist eines der wichtigsten diagnostischen Verfahren zur qualitativen und quantitativen Abschätzung der kardiopulmonalen (Ausdauer-)Leistungsfähigkeit und gibt einen guten Überblick über das Zusammenspiel von Lunge bzw. Atmung, kardiovaskulärem System, Muskulatur und Stoffwechsel unter Belastung.<sup>1</sup><br /> Sie liefert wesentliche differenzialdiagnostische Hinweise auf die möglichen Ursachen einer unklaren Belastungsdyspnoe. In den meisten Fällen kann eine kardiopulmonale Leistungsuntersuchung (CPX, Spiroergometrie) helfen, abzuschätzen, ob sich hinter der geschilderten Symptomatik eine relevante kardiale oder pulmonale Funktionsstörung oder ein periphermuskuläres Defizit (Trainingsmangel) verbirgt.<br /> Im (Hobby- und Leistungs-)Sport sind die Ergebnisse der Spiroergometrie vor allem dann zur Trainingsteuerung nützlich, wenn die aerobe Kapazität für den Wettkampferfolg eine limitierende Einflussgröße darstellt. Auf Basis der gewonnenen Daten ergeben sich Hinweise zur Bewegungsökonomie sowie zu Verhältnis und Menge der metabolisierten Energielieferanten.<br /> Der Fokus liegt vor allem auf einer Bestimmung der maximalen Sauerstoffaufnahme (V’O<sub>2max</sub>) bezogen auf das Körpergewicht sowie der ventilatorischen Schwellen VT1 (ehemals „respiratorische AT“) und VT2 (ehemals „respiratorischer Kompensationspunkt“, RCP).<sup>2, 3</sup> Ergänzt werden die Daten durch eine Bestimmung der Laktatwerte auf den einzelnen Belastungsstufen.<br /> Über die routinemäßige Atemgasanalyse hinausgehende, ergänzende Untersuchungstechniken (Intra-Breath-Atemmanöver) ermöglichen Aussagen bezüglich atemmechanischer Limitierungen (dynamische Flusslimitierung und Überblähung) unter Belastung. Jede Spiroergometrie sollte zudem durch Blutgasanalysen ergänzt werden.<br /> Die mittlerweile als „Goldstandard“ eingesetzte grafische Umsetzung der gewonnenen Daten als „9-Felder-Grafik“ nach Wasserman trägt wesentlich dazu bei, den Überblick über die Vielzahl an Informationen und Daten zu behalten und eine Systematik und Standardisierung in der Auswertung zu erreichen (Abb. 1).<sup>4</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1903_Weblinks_jatros_pneumo_1903_s9_abb1_kruell.jpg" alt="" width="800" height="501" /></p> <h2>Physiologie</h2> <p>Die Spiroergometrie ist ein diagnostisches Verfahren, bei welchem durch Messung der in- und exspiratorischen Atemgase und -volumina sowie der Atem- und Herzfrequenz während zunehmender körperlicher Aktivität die Leistungsfähigkeit und das Zusammenspiel der Atmung, des Gasaustausches, der peripheren Sauerstoffausschöpfung und des kardiovaskulären Systems untersucht werden. Aus den gemessenen Werten lässt sich eine Reihe weiterer Parameter errechnen (respiratorischer Quotient, Atemäquivalente, Atemzugvolumen, Atemeffizienz, Sauerstoffpuls/Schlagvolumen u. a. m.). Da die Leistungsfähigkeit der Atmung nicht durch den Atemtrakt alleine gewährleistet wird, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel von Herz, Kreislauf, muskuloskelettalem Status (Trainingszustand) und Stoffwechsel („Zellatmung“), geben die gewonnenen Ergebnisse somit einen qualitativen und quantitativen Überblick über das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Organsysteme und damit die Gesamtleistungsfähigkeit des Körpers.<sup>5</sup><br /> Die bekannteste Kenngröße für die Ausdauerleistungsfähigkeit ist die maximale Sauerstoffaufnahme, V’O<sub>2max</sub>. Sie kann bei einem hochtrainierten Ausdauersportler bis zu 90 ml/min/kg Körpergewicht betragen, bei einem 30-jährigen gesunden untrainierten Mann liegt sie zwischen 35 und 45 ml/ min/kg. Bei Frauen sind die Werte aufgrund der geringeren Muskelmasse meist um 10– 15 % niedriger. Von einer V’O<sub>2max</sub> kann allerdings nur dann gesprochen werden, wenn auch eine maximale körperliche Ausbelastung erfolgt ist. Da dies jedoch ein Aspekt ist, der durch vielerlei Faktoren („Tagesform“, Mitarbeit, metabolische Beanspruchung u. v. a. m.) bestimmt wird, ist sie zur Beurteilung von Trainingseffekten nur wenig geeignet, hierfür eignen sich besser die zu bestimmenden Schwellen VT1 und VT2.</p> <h2>Ablauf der Untersuchung</h2> <p>Vor der Untersuchung sollte das Vorhandensein möglicher absoluter Kontraindikationen für die Durchführung der Untersuchung geprüft werden, auch sollte während der Untersuchung sorgfältig auf potenzielle Abbruchkriterien geachtet werden.<sup>6</sup> Die Spiroergometrie kann mittels Rampenoder Stufenprotokoll durchgeführt werden. Eine Ausbelastung sollte beim Rampenprotokoll innerhalb von 12–15 Minuten erfolgen, um einer frühzeitigen muskulären Ermüdung vorzubeugen. Es wird meist bei den rein „medizinischen“ Spiroergometrien eingesetzt. Zudem lassen sich anhand der im Rampenprotokoll gewonnenen Daten die ventilatorischen Schwellen besser ableiten.<br /> Ein Stufenprotokoll wird bei den klassischen „Leistungsanalysen“ mit sport- und trainingswissenschaftlichen Fragestellungen durchgeführt. Hierbei sollten im Vorfeld mit dem Sportler die Dauer und die Intensität der Leistungsstufen abgestimmt werden, um eine optimale Ausbelastung zu erzielen, üblicherweise liegt die Dauer der einzelnen Stufen bei 3–5 Minuten. Am Ende jeder Stufe sollte eine Laktatanalyse erfolgen.<br /> Ergänzt werden diese Informationen durch zusätzliche Messmanöver wie der „Intra-Breath-Messung“ sowie (kapilläre) Blutgasanalysen, um die alveolo-arterielle Sauerstoffdruckdifferenz (AaDO<sub>2</sub>) und die arterio-endtidale (= alveoläre) Partialdruck- Differenz für CO<sub>2</sub> (P[a-ET]CO<sub>2</sub>) bestimmen zu können.<sup>5</sup><br /> Ein erster Schritt der Analyse sollte sein, zu prüfen, ob eine vollständige kardiovaskuläre und pulmonale Ausbelastung erfolgt ist. Aufgrund der großen Datenmenge hat es sich bewährt, die Auswertung nach einem standardisierten Schema durchzuführen, um keine relevanten Aspekte zu vergessen oder zu übersehen.<br /> In den Feldern 2, 3 und 5 werden die kardiovaskulären Belastungsdaten abgebildet, in den Feldern 1 und 7 die ventilatorischen, in Feld 4 Aspekte aus beiden Systemen. In den Feldern 6 und 9 werden die Daten des Gasaustauschs unter Belastung erfasst (siehe auch Abb. 1).<br /> Zeichen einer kardialen Limitation sind neben entsprechenden Veränderungen im EKG das Erreichen eine Plateaus oder gar ein Abfall des Sauerstoffpulses (Menge der Sauerstoffaufnahme/Herzschlag), eine reduzierte maximale Sauerstoffaufnahme V’O<sub>2max</sub> oder auch eine reduzierte V’O<sub>2</sub> an der VT1. Bei chronischer, vor allem rechtskardialer Insuffizienz oder auch pulmonaler Hypertonie ist zudem eine pathologische Steigerung der V’E/V’CO<sub>2</sub> nachweisbar (= Atemeffizienzstörung, Menge an Luft, die ventiliert werden muss, um einen Liter CO<sub>2</sub> abzuatmen, Feld 4).<br /> Zeichen einer pulmonalen Limitierung sind neben einem verminderten maximalen Atemminutenvolumen (V’E<sub>max</sub> von bis zu 200 l/min) auch eine Einschränkung der Atemreserve („breathing reserve“, BR). Als solche bezeichnet man hierbei die Differenz zwischen dem maximal vorhergesagten und dem tatsächlich erreichten AMV. Ein „tiefes Ausschöpfen“ der BR (< 25 % ) bis zur atemmechanischen Grenze ist allerdings in gewissem Maße „trainierbar“ und somit kein verlässliches Maß einer pulmonalen Limitierung im (Hoch-)Leistungssport.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Raschka C, Nitsche L: Praktische Sportmedizin. Thieme 2016; 77-92 <strong>2</strong> Westhoff M et al.: Positionspapier der AGSpiroergometrie zu ventilatorischen und Laktatschwellen. www.ag-spiroergometrie.de; 2011 <strong>3</strong> Wasserman K et al.: Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. J Appl Physiol 1973; 35: 236-43 <strong>4</strong> Whipp BJ et al.: Parameters of ventilator and gas exchange dynamics during exercise. J Appl Physiol 1982; 52: 1506-13 <strong>5</strong> Kroidl RF et al.: Kursbuch Spiroergometrie. Thieme 2014; 3. Auflage <strong>6</strong> Trappe HJ, Löllgen H: Leitlinien zur Ergometrie. Z Kardiol 2000; 89: 821-37</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


