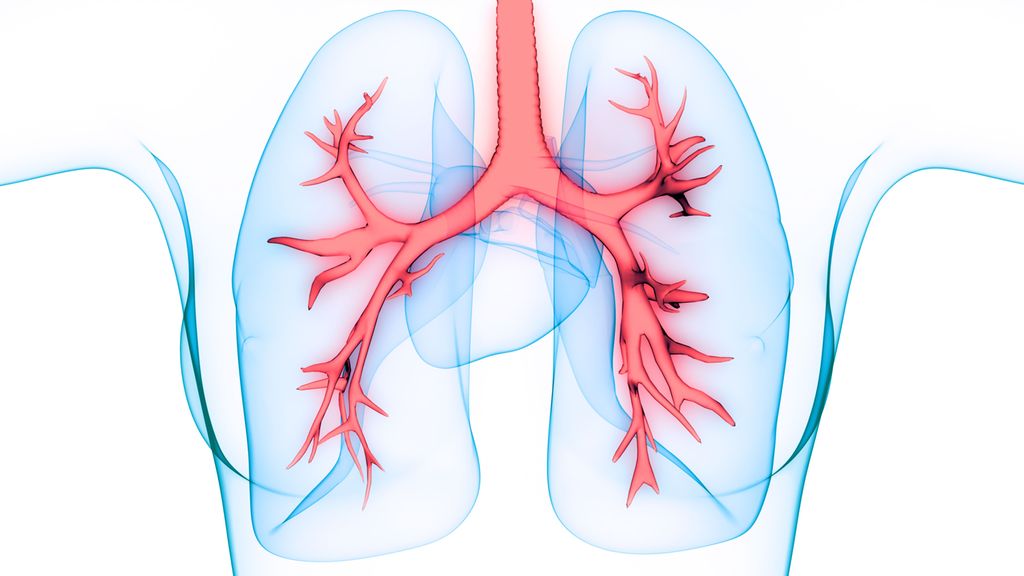
©
Getty Images/iStockphoto
Raucherentwöhnung während der stationären Rehabilitation
Jatros
Autor:
Mag. Karin Salcher
Psychologischer Dienst<br> AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt<br> E-Mail: karin.salcher@auva.at
30
Min. Lesezeit
16.05.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In der Rehabilitationsklinik Tobelbad (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA) werden an der Abteilung für Berufskrankheiten in erster Linie Patienten mit Erkrankungen der Lunge und der Atemwege, aber auch mit (drohenden) berufsbedingten Hauterkrankungen rehabilitiert. Bei diesen Betroffenen stellt Rauchen einen Hochrisikofaktor dar, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, im Rahmen der stationären Rehabilitation gezielt Hilfestellung in der Tabakentwöhnung anzubieten.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Kombination aus psychologischen Interventionen und Medikation erzielt die besten Langzeiterfolge in der Tabakentwöhnung.</li> <li>Die durchschnittlichen Erfolgsraten von Studien in der Tabakentwöhnung liegen in etwa zwischen 25 und 35 %.</li> <li>Da viele Faktoren einen möglichen Rauchstopp beeinflussen können, erfordert die Begleitung eines Rauchers im Veränderungsprozess Fachwissen, Empathie, Geduld und Zeit.</li> </ul> </div> <p>Infolge des Tabakkonsums entstehen enorme gesundheitliche Schäden. Die vielfältigen Risiken und Auswirkungen des Zigarettenrauchs auf die Gesundheit sind in zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt. Das Rauchen von Tabak ist ein multifaktorielles Problem, das neben dem Einfluss von kulturellen und sozialen Mechanismen vor allem mit (neuro)biologischen und psychologischen Faktoren im Zusammenhang steht. Bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der physischen Abhängigkeit ist in erster Linie die (Aus)Wirkung des Nikotins im Gehirn entscheidend und in weiterer Folge spielen verschiedene Lern- und Gedächtnisprozesse eine Rolle, welche zur psychischen Nikotin- und Tabakabhängigkeit führen. Darüber hinaus wird das Rauchen von persönlichen, emotionalen, kognitiven und sensorischen Prozessen beeinflusst und verstärkt. Die Psychologie verfügt über wissenschaftlich fundierte Modelle und Methoden, die Erklärungsansätze der Suchtentstehung liefern und auch in der Praxis der Nikotin- und Tabakentwöhnung Anwendung finden. Die höchste langfristige Erfolgsquote in der Tabakentwöhnung wird durch eine Kombination aus psychologischen Interventionen und Medikation erzielt. Dem entsprechen die aktuellen Empfehlungen nationaler und internationaler Leitlinien zur Tabakentwöhnung.</p> <h2>Tabakentwöhnung und Rehabilitation</h2> <p>Mit der bereits im Jahr 2008 erfolgten Neukonzipierung der Raucherentwöhnung in der Rehabilitationsklinik Tobelbad sollte eine Maßnahme installiert werden, die den aktuellen Standards entspricht und mit der die bestehenden Ressourcen in der Klinik genützt werden können. Ein wesentlicher Punkt der Überlegungen war, dass mit der Maßnahme alle in der Abteilung für Berufskrankheiten stationär behandelten Raucher und Raucherinnen erreicht werden, unabhängig von ihrer aktuellen Änderungsmotivation. Dabei sollten die jeweiligen Bedürfnisse und Ziele der Patienten Berücksichtigung finden.</p> <h2>Verhaltensänderung als Prozess</h2> <p>Das theoretische Grundgerüst des Konzeptes bildet das „transtheoretische Modell der Verhaltensänderung“ („Stages of change“) nach Prochaska und DiClemente. Demzufolge geht man davon aus, dass jede Verhaltensänderung ein stufenweiser Prozess ist, in welchem eine Person, die raucht, unterschiedliche Phasen durchläuft, bis sie tatsächlich rauchfrei ist. Die Stufen müssen nicht linear durchlaufen werden, die Zeitdauer, in der sich eine Person auf der jeweiligen Stufe befindet, divergiert. Es ist auch möglich, dass Stufen mehrmals durchlaufen werden.</p> <p><strong>Absichtslosigkeit</strong> <br />Keine Intention, das Rauchverhalten zum aktuellen Zeitpunkt und in der nächsten Zeit (den nächsten 6 Monaten) zu verändern.</p> <p><strong>Absichtsbildung</strong> <br />Innerhalb der nächsten 6 Monate wird eine Veränderung in Erwägung gezogen (z. B. gedanklich), ohne aktuell konkrete Schritte zu planen.</p> <p><strong>Vorbereitung</strong> <br />Ein Rauchstopp wird immer konkreter und zeitnaher (in den nächsten 30 Tagen) angedacht. Es werden erste Schritte der Veränderung eingeleitet (z. B. einzelne rauchfreie Tage).</p> <p><strong>Handlung</strong> <br />Die Person ist (seit weniger als 6 Monaten) rauchfrei. Der Stufe der Handlung folgen die Stufen der Aufrechterhaltung (mehr als 6 Monate rauchfrei) und der Stabilisierung. <br />Das transtheoretische Modell stellt damit eine hilfreiche Stütze dar, Raucher und Raucherinnen nach individueller Änderungsbereitschaft der jeweiligen Stufe zuzuteilen, um in weiterer Folge stufenorientiert und damit gezielter beraten zu können. Das Ziel ist die Erhöhung der jeweiligen Veränderungsmotivation, um von einem der oben genannten Stadien ins nächste zu kommen.</p> <h2>Darstellung Raucherentwöhnung</h2> <p>Besonders auch jene große Gruppe, die sich auf der Stufe der „Absichtslosigkeit“ befindet, galt es in der Maßnahmenentwicklung zu erreichen. Fehlende Bereitschaft zur Verhaltensänderung kann durch verschiedene Mechanismen wie mangelnde Information und Verleugnung verstärkt werden. Es wurde deutlich, dass durch eine informative, psychoedukative Gruppenmaßnahme („Raucherseminar“) ein niederschwelliges Angebot installiert werden kann. In diesem können die Patienten auch über Möglichkeiten der psychologischen und medizinischen Unterstützung während ihres Aufenthaltes informiert werden (Abb. 1). Berücksichtigt werden musste vor allem, dass erzeugter Druck „von außen“ (z. B. automatische Zuteilung zum Seminar) psychologische Reaktanz, also gewissen Widerstand, begünstigt und verstärkt. Dem wird mit offener Kommunikation und Aufklärung im Rahmen der Aufnahme entgegengewirkt. Auch im Raucherseminar wird die Selbstbestimmung des Einzelnen betont und die Patienten werden ermutigt, aktiv am Seminar teilzunehmen. Sollte ein Patient zum Zeitpunkt des Aufenthaltes keinen Aufhörwillen bzw. keine Bereitschaft zeigen, sich näher mit dem Rauchverhalten auseinanderzusetzen, ist ausschließlich die Teilnahme am Raucherseminar vorgesehen. Die Erfahrung zeigt, dass während der Rehabilitation vielfältige Faktoren die jeweilige Motivation der Patienten beeinflussen können. Die meisten melden sich am Ende des Seminars bei der zuständigen Psychologin und zeigen Interesse an den angebotenen weiteren Maßnahmen. Die weiterführende Beratung erfolgt in psychologischen Einzelgesprächen, in denen die individuelle Raucheranamnese erhoben wird, persönliche Ziele für den Aufenthalt besprochen und gegebenenfalls festgelegt werden. Interveniert wird in erster Linie kognitivverhaltenstherapeutisch und auf Basis der Methode der motivierenden Gesprächsführung. Bei bestehender Nikotinabhängigkeit, welche mit dem Fagerström-Test erhoben wird, beim Auftreten von Nikotinentzugssymptomen (auch bei vorhergehenden Rauchstoppversuchen) oder entsprechendem Interesse der Betroffenen erfolgt die medizinische Raucherberatung bei einer der zuständigen Ärztinnen. Diese entscheidet dann, ob und welche unterstützende Medikation eingeleitet wird. Begleitend besteht die Unterstützungsmöglichkeit durch Akupunktur. Für deren Wirksamkeit in der Tabakentwöhnung liegt zwar noch kein eindeutiger wissenschaftlicher Nachweis vor, jedoch gibt es individuelle positive Erfahrungen und Rückmeldungen der Patienten.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1902_Weblinks_jatros_pneumo_1902_s24_abb1_salcher.jpg" alt="" width="800" height="456" /></p> <p> </p> <h2>Evaluation<sup>1 </sup></h2> <p>Für die aktuelle Evaluation wurde eine retrospektive Erhebung durchgeführt, mit dem vorrangigen Ziel, die langfristige Abstinenzquote der Personen zu erfassen, die während ihres Aufenthaltes an der Raucherentwöhnung teilgenommen haben. Dazu wurde den ehemaligen Patienten und Patientinnen im August/September 2018 ein vierseitiger Fragebogen zugeschickt. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, folgte ein Erinnerungsschreiben nach zwei Wochen. Insgesamt wurden 224 Fragebögen ausgeschickt und zunächst 141 Personen (62,9 % Rücklaufquote) in die Analyse eingeschlossen. Zusätzlich zur einfachen Ergebnisermittlung erfolgte die Berechnung der Abstinenzquote nach dem strengen Russell-Standard. Diese Intention-to-treat-Analyse dient einer verbesserten wissenschaftlichen Vergleichbarkeit, wobei auch jene Personen in die Berechnung eingehen, die ihren Fragebogen nicht retourniert haben (n = 83). Bei dieser methodisch konservativen Vorgehensweise werden diese Personen als „Raucher“ gewertet, da angenommen wird, dass jene Patienten, die noch rauchen, weniger Bereitschaft zeigen, an der Erhebung teilzunehmen, und den Fragebogen nicht retournieren.</p> <h2>Beschreibung der Teilnehmer</h2> <p>83,1 % der Befragten sind männlich. Dies entspricht in etwa der tatsächlichen Geschlechterverteilung in der Abteilung für Berufskrankheiten. Das durchschnittliche Alter beträgt 58,9 Jahre, und die Patienten haben angegeben, dass sie im Mittel 33,2 Jahre rauchen bzw. geraucht haben. <br />Von den Teilnehmern sind 96,4 % auf den Stationen für Erkrankungen der Lunge und Atemwege gewesen und nur 3,6 % auf der Station für Hauterkrankungen. Dieses Ungleichgewicht ist zum einen durch den zeitlichen Aspekt erklärbar, da die Station für Hauterkrankungen erst seit 2015 besteht, zum anderen durch die geringere Bettenzahl für Hautpatienten. Dennoch zeigte die getrennt berechnete Rücklaufquote, dass diese bei den Hautpatienten deutlich niedriger war (33,3 %). Offensichtlich besteht bei den Patienten mit chronischen Lungen- und Atemwegserkrankungen durch die wiederholten Aufenthalte in der Rehabilitationsklinik auch eine größere persönliche Bindung und damit eine erhöhte Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen. Diesen Eindruck untermauert, dass sich viele dieser Patienten zusätzlich telefonisch gemeldet haben, um über den aktuellen Raucher-/Nichtraucherstatus zu sprechen, sich zu vergewissern, dass ihr Fragebogen angekommen ist, und Ähnliches. 40,6 % der Befragten sind mehr als fünfmal stationär in Behandlung gewesen, 38,4 % zwei- bis fünfmal und 21 % geben an, einmal stationär in der Rehabilitationsklinik gewesen zu sein.</p> <h2>In Anspruch genommene Unterstützung</h2> <p>Fast die Hälfte der Befragten (48,9 %) hat neben dem Raucherseminar zusätzlich die psychologische und medizinische Einzelberatung in Anspruch genommen. 29,2 % haben die Kombination Raucherseminar und psychologische Einzelberatung genützt, 5,8 % die Kombination Raucherseminar und medizinische Einzelberatung. 10,9 % der Patienten haben nur das Raucherseminar, 3,6 % nur die psychologische Einzelberatung und 1,5 % nur die medizinische Einzelberatung konsumiert. <br />An medikamentöser Unterstützung wurde in der medizinischen Raucherberatung Nikotinersatztherapie in Form von Nikotindepotpflaster (6,5 %), Nikotinkaugummi (2,9 %), Nikotinspray (8 %), Nikotinlutschpastillen (0,7 %) oder Nikotininhalator (3,6 %) bzw. eine Kombination aus Nikotindepotpflaster mit kurzwirksamem Nikotinersatz verschrieben. 15,2 % der Befragten haben eine medizinische Unterstützung in Form von Vareniclin erhalten und 0,7 % in Form von Bupropion.</p> <h2>Wirksamkeit</h2> <p>Am Ende des stationären Aufenthaltes sind 56,6 % der Patienten vollständig rauchfrei. Diese Abstinenzrate deckt sich mit dem Ergebnis einer Erhebung im Jahr 2010, deren Gültigkeit damals mit dem gemessenen Kohlenmonoxidwert der Ausatemluft objektiviert wurde. Zum Zeitpunkt der Erhebung haben von 141 Patienten 58,2 % angegeben, Nichtraucher zu sein. Davon sind 43,9 % zwischen einem und fünf Jahren und 24,4 % länger als fünf Jahre rauchfei. 13,4 % der Nichtraucher haben angegeben, zwischen sechs Monaten und einem Jahr rauchfrei zu sein, und 18,3 % sind weniger als sechs Monate rauchfrei. Berücksichtigt man nur jene Nichtraucher, die zum Erhebungszeitpunkt länger als sechs Monate rauchfrei sind, ergibt sich eine Quote von 53,2 % (n = 126). Ergänzend wurde die Abstinenzrate nach Empfehlungen der Russell-Standard-Kriterien errechnet. Werden auch die „vermuteten Raucher“ in die Berechnung miteingeschlossen, beträgt die Abstinenzrate 36,6 %. Für die langfristige Abstinenzrate (> 6 Monate rauchfrei) lässt sich immer noch ein Wert von 32,1 % ermitteln (Abb. 2)! Die durchschnittlichen Erfolgsraten von Studien in der Tabakentwöhnung liegen in etwa zwischen 25 und 35 % (nach sechs bis zwölf Monaten). Vor diesem Hintergrund kann das vorliegende Evaluationsergebnis als sehr zufriedenstellend eingestuft werden.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1902_Weblinks_jatros_pneumo_1902_s26_abb2_salcher.jpg" alt="" width="2151" height="856" /></p> <p> </p> <h2>Herausforderungen in der Tabakentwöhnung</h2> <p>Die Nikotin- und Tabakabhängigkeit als chronische Erkrankung hat zur Folge, dass es grundsätzlich eine hohe Rückfallrate in der Tabakentwöhnung gibt. Wenigen Rauchern und Raucherinnen gelingt bereits beim ersten Versuch eine anhaltende Abstinenz. Bei vielen ist aber der Wunsch, etwas an ihrem Rauchverhalten zu verändern, durchaus mit diesbezüglichen Bemühungen verbunden. Von den 59 Personen, die angegeben haben, aktuell zu rauchen, berichteten 61,4 %, dass es seit ihrem letzten Aufenthalt rauchfreie Phasen gegeben hat, und 70,7 %, dass sie früher mehr geraucht haben. Da viele der Patienten mit chronischen Erkrankungen der Lunge und der Atemwege wiederholt zu stationären Aufenthalten in die Rehabilitationsklinik kommen, ergibt sich die Möglichkeit, wiederholt Interventionen zu setzen. Es wurde in dieser Evaluation auch geprüft, ob es Unterschiede in der Verteilung der Nichtraucher in Abhängigkeit zur Anzahl der bisherigen Aufenthalte gibt, und es zeigte sich, dass sich statistisch signifikant mehr Nichtraucher als erwartet in der Gruppe der Patienten mit mehr als fünf stationären Aufenthalten finden. Gewiss gibt es verschiedene Erklärungsansätze für diesen Unterschied, aber wahrscheinlich wirkt es sich günstig aus, wenn Patienten das Angebot der Raucherentwöhnung wiederholt nutzen können. Die offenen Rückmeldungen sind sowohl von Rauchern als auch von Nichtrauchern überwiegend positiv. Zudem halten es 95,7 % der Teilnehmer für wichtig, dass im Rahmen der Rehabilitation eine Raucherentwöhnung angeboten wird.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Mit der Raucherentwöhnung steht den Patienten der Rehabilitationsklinik eine fachlich fundierte Unterstützung zur Verfügung, welche sowohl die psychologischen als auch die biologischen Konsequenzen der Nikotin- und Tabakgewöhnung berücksichtigt. Angesichts der vielen Faktoren, die einen möglichen Rauchstopp beeinflussen können, erfordert die Begleitung eines Rauchers am Weg zur Rauchfreiheit neben Fachwissen auch Empathie, Geduld und Zeit. Die Nikotin- und Tabakentwöhnung stellt eine notwendige, herausfordernde und vor allem lohnende Maßnahme dar.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>• Batra A, Buchkremer G: Tabakentwöhnung. Ein Leitfaden für Therapeuten. Kohlhammer, Stuttgart 2004 • Chenot JF, Keller S: Nikotinstopp – was hilft dabei. Allgemeine Medizin 2004; 80: 113-8 • Cornuz J et al.: Tabakentwöhnung. Schweiz Med Forum 2004; 4: 764-70 • Kröger C, Lohmann B: Tabakkonsum und Tabakabhängigkeit (Fortschritte in der Psychotherapie, Band 31). Göttingen: Hogrefe, 2007 • Kröger C et al.: Projektbericht. Effektivität von Tabakentwöhnung in Deutschland (2011): www.bundesgesundheitsministerium. de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/ Drogen_und_Sucht/Berichte/Projektbericht_ Effektivitaet_von_Tabakentwoehnung_in_ Deutschland.pdf (Tag des Abrufes 3. 5. 2018) • Meingassner S, Stummer AM: Psychologische Strategien in der Behandlung der Tabakabhängigkeit. Psychologie in Österreich 2008; 3 & 4: 326-34 • Miller W, Rollnick S: Motivierende Gesprächsführung. Freiburg im Breisgau: Lambertus, 2015 • Müller M: Neurobiologie der Nikotinsucht. Gehirn & Geist 2013; 6: 50-1 • Prochaska J, DiClemente C: Stages and process of self-change in smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983; 51: 390-5 • Ruprechter-Grofe P, Sander R: Ausgeraucht. Mein neues Leben ohne Zigarette. Wien: Leykam, 2019 • West R et al.: Outcome criteria in smoking cessation trials: proposal for a common standard. Addiction 2005; 100: 299-303</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


