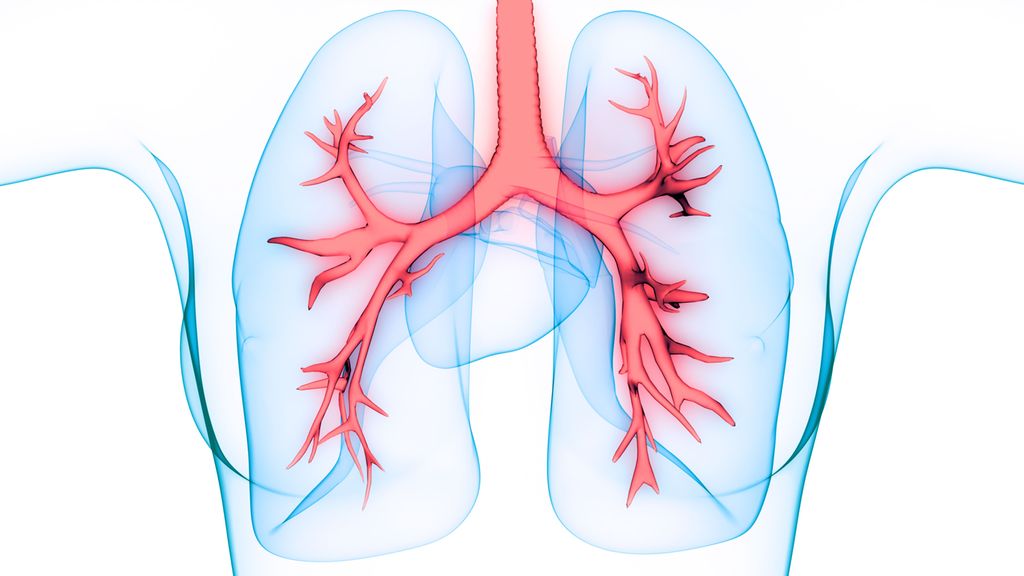
©
Getty Images/iStockphoto
Highlights des 14th Central European Lung Cancer Congress
Jatros
Autor:
Dr. Andrea Mohn-Staudner
OWS, 2. Interne Abteilung, Sanatoriumstraße 2, 1140 Wien<br/> Quelle: Translational Lung Cancer Research 2014; 3(5) (online ISSN 2226-4477)
30
Min. Lesezeit
05.03.2015
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">2014 fand der Central European Lung Cancer Congress (CELCC) in Wien vom 29. 11. bis 2. 12. und damit am Ende des „Lung Cancer Awareness Month“ statt. Der Schwerpunkt des diesjährigen Kongresses lag neben der molekularen Diagnostik und den zielgerichteten Therapien vor allem auch im Bereich der Implementierung des Screenings und der Entwicklung von länderübergreifenden Kooperativen und auf einem speziellen chinesisch-zentraleuropäischen Symposium.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Screening von Lungenkrebs: Die Modalitäten zur Erhöhung der Effizienz und Hintanhaltung möglicher negativer Effekte sind in Ausarbeitung.</li> <li>Eine Verstärkung der Kooperation von zentraleuropäischen Regionen mit hohem Raucheranteil in der Bevölkerung soll die Prävention, Diagnostik und Therapie des Lungenkarzinoms verbessern.</li> <li>Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von zielgerichteten Therapien auch in anderen Histologien wie dem Plattenepithelkarzinom, dem kleinzelligen Karzinom oder auch dem Mesotheliom.</li> </ul> </div> <h2>Lungenkrebsscreening</h2> <p>Diese wissenschaftliche Sitzung wurde durch Helmut Prosch (AKH Wien) mit der Vorstellung und Diskussion der Daten zum National Lung Screening Trial (USA 2011) eingeleitet. Unter Einschluss von 50.000 Teilnehmern konnte dieses erstmals nachweisen, dass durch Screening mittels Low-Dose-CT eine Reduktion der Mortalität bei Lungenkrebs um 20 % und eine Reduktion der allgemeinen Mortalität in der gescreenten Population um 6,75 % erreichbar sind. 3 Jahre nach der Publikation ist einer Umfrage nach das Screening in Hochrisikogruppen innerhalb der USA weitgehend implementiert. In Europa sind vergleichbare Studien noch im Laufen und die Haltung ist konservativer, da die Studie auch weitere Fragen aufgeworfen hat und potenzielle negative Effekte vermieden werden müssen. Dies sind die Punkte, die zur Diskussion stehen:</p> <ol> <li>Möglichkeiten einer weitergehenden sinnvollen Patientenselektion durch Definition des Risikos (Alter, Raucheranamnese, Beruf, familiäre Disposition, Komorbiditäten).<sup>1</sup> Im National Lung Screening Trial (NLST) waren Personen mit einem geschätzten Risiko zwischen 2 und 20 % eingeschlossen. Aktuell wird ein neues Modell zur Risikoabschätzung in der laufenden britischen Studie (UKLS) angewendet und nur Personen mit einem geschätzten Risiko von mindestens 5 % , innerhalb der nächsten 5 Jahre an einem Bronchialkarzinom zu erkranken, werden eingeschlossen. Es wird erwartet, dass damit die Prävalenz von Lungenkarzinomen in der gescreenten Population deutlich erhöht werden kann.</li> <li>Management von gefundenen Knoten z.B. durch Verfeinerung der radiologischen Kriterien: Das Risiko für einen malignen Herd, der weiterer Diagnostik bedarf, ist abhängig von der Größe, der Dichte und dem klinischen Verhalten, ein solcher war in 2 % der Fälle detektierbar.<sup>2, 3</sup></li> <li>Verbesserung der nicht invasiven Diagnostik vor Einbindung der Chirurgen mit Video-assistierter Thorakoskopie (VATS); generell werden eine interdisziplinäre Diskussion sowie ein multimodales Vorgehen empfohlen.</li> <li>Ein potenzieller Schaden durch die kumulative Strahlendosis</li> <li>Belastung der Patienten, auch durch das Auffinden von wahrscheinlich benignen Knoten, das damit verbundene Zuwarten und weitere radiologische Kontrollen</li> <li>Kosteneffizienz: Dazu gibt es bisher nur ungenügende Daten (NEJM 2014; 371(19): 1769).</li> <li>Umgang mit Nichtrauchern in Regionen, wo die Inzidenz in dieser Gruppe hoch ist, z.B. in China</li> </ol> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Jatros_Onko_1501_Weblinks_Seite65.jpg" alt="" width="967" height="438" /></p> <p>Vertreter aus Tschechien, Ungarn und Deutschland berichteten dann über ihre spezifischen Erfahrungen. Als positiver Aspekt wurde die Rolle des Screenings zur Erkennung asymptomatischer Fälle hervorgehoben und ein Prescreening mittels Lungenfunktion vorgeschlagen. Außerdem finden sich indirekte Vorteile wie ein exaktes Staging durch die invasive Diagnostik und die Erhöhung der Wahrnehmung des Problems Lungenkrebs vor allem in den zentraleuropäischen Ländern mit einem hohen Raucheranteil.<br /> So wie die drei bereits abgeschlossenen europäischen negativen Studien (MILD, DANTE, DLCST) sind auch jene noch im Laufen befindlichen „underpowered“, um bezüglich der Reduktion der Mortalität ein signifikantes Ergebnis zu liefern. Es wird aber erwartet, dass durch ein Pooling der Daten die Evidenz unterstützt wird und viele offene Fragen beantwortet werden können.<br /> Als zukünftiges gemeinsames Projekt wurde die „Central European Lung Cancer Screening Task Force“ vorgestellt. Dabei geht es darum, Regionen mit einer hohen Lungenkrebsinzidenz zu involvieren, um die Mortalität zu senken und an vorderster Front bei Screening und Prävention mitzuarbeiten. Es sollen eine Infrastruktur mit Zentren erhöhten Umsatzes aufgebaut, ein standardisiertes CT-Screening mit Vorgaben für die Vorgangsweise bei entdeckten Läsionen und eine Definition für Risikogruppen etabliert werden. Damit verbunden sind auch Raucher-Entwöhnungsprogramme sowie ein Lungenkrebsregister, Schulungsprogramme, internationale Kooperation und Forschungsprojekte.</p> <h2>Chinesisch-zentraleuropäisches Symposium</h2> <p>In dieser Session wurde besonders auf die Situation in China eingegangen, wo das Bronchialkarzinom in der Mortalität an erster Stelle der Krebserkrankungen steht und in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Inzidenz gezeigt hat. Im Gegensatz zu den westlichen Ländern sind hier neben den Rauchern auch mehr Nichtraucher betroffen, ein Ergebnis der hohen Feinstaubbelastung in der häuslichen Umgebung (offenes Feuer, Passivrauch) und in den großen Städten. Wie auch in den westlichen Ländern hat das Adenokarzinom als histologischer Subtyp das Plattenepithelkarzinom überholt, aus vergleichbaren Gründen. Ein bedeutender Unterschied besteht in der Inzidenz von EGFR-Mutationen, diese finden sich bei unselektionierten Patienten in 28 % der Fälle, bei klinisch selektionierten Gruppen von Chinesen (Nieraucher, Adeno-Ca) findet man sie in bis zu 75 % , die Rate an ALK-1-Rearrangements ist mit ca. 5 % auch etwas höher als in unseren Regionen. Dementsprechend spielen die Implementation von Mutationstestungen und die zielgerichtete Therapie in China eine vorherrschende Rolle. Die chinesische Regierung hat Programme zur Tabakkontrolle und zur Kontrolle der Luftverschmutzung gestartet, bei 600.000 neuen Fällen pro Jahr wird von den Kollegen aber auch eine rasche Umsetzung einer flächendeckenden Mutationstestung und standardisierter klinischer Management-Protokolle durch die behandelnden Ärzte gefordert.<br /> Abschließend erfolgte noch eine Vorstellung der in China durch die 2007 gegründete „Chinese Thoracic Oncology Group“ (CTONG) abgeschlossenen und laufenden Studien. In der Liste finden sich bekannte z.T. auch internationale oder panasiatische Projekte wie IPASS, OPTIMAL und FASTACT-2. Diese und weitere Studien in verschiedenen Settings untersuchen vor allem die Rolle und Wirksamkeit von EGFR-TKI, in Zukunft werden auch weitere, dzt. noch ungewöhnliche Targets (PIK3CA, MET, ALK/ROS1, <em>KRAS, NRAS, BRAF</em>) mit einbezogen.</p> <h2>Lungenkrebs in Zentraleuropa</h2> <p>Die Sitzung wurde mit der „Petr Zatloukal Memorial Lecture“ von Jean Klastersky, dem ehemaligen Direktor der MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer), eingeleitet. Er betonte die hervorragende Rolle der supportiven und palliativen Therapie in der Behandlung des Lungenkarzinoms. Diese Maßnahmen sind sehr vielfältig und sollten besser definiert und auch monitiert werden. Er stellte auch heraus, dass ein wahrer Fortschritt im Kampf gegen den Lungenkrebs nicht nur durch die Entwicklungen im Bereich der zielgerichteten Therapie, sondern vor allem durch Prävention und supportive Therapie zu erreichen ist.<sup>4, 5</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Jatros_Onko_1501_Weblinks_Seite66.jpg" alt="" width="647" height="380" /></p> <p>Tatjana Cufer berichtete dann über das Lungenkrebsregister in Slowenien, eines der ältesten Register weltweit. Es wird seit 1950 geführt und basiert auf der Bevölkerung. Es wird ein jährlicher Report erstellt und alle 5 Jahre publiziert, die letzte Auswertung erfolgte 2010. Entsprechend ihrer Erfahrung empfiehlt sie spitalsabhängige Register, da sie für die Evaluierung besser geeignet sind und rascher aktualisiert werden können. Es findet sich ein hoher Anteil an Patienten im metastasierten (51 % ) oder lokal fortgeschrittenen (25 % ) Stadium, histologisch ist das Adenokarzinom vorherrschend, die molekulare Diagnostik gut implementiert und die Überlebensdaten für frühe und fortgeschrittene Stadien sind vergleichbar mit jenen in randomisierten Studien. Als Beispiel für die Auswertungen wurde die Rate an Mutationen genannt, wobei sich in Slowenien ein Anteil von 13 % mit aktivierender EGFR-Mutation und von 5 % ALK-Rearrangement findet, was z.B. auch den Verhältnissen in Österreich und Tschechien entspricht, wie Maximilian Hochmair und Juraj Kultan in ihren Präsentationen zeigen konnten.<br /> <br /> Auch Tschechien führt ein Lungenkrebsregister, wobei ca. 6.500 Fälle pro Jahr registriert wurden, mit steigender Inzidenz, vor allem bei Frauen. In der OECD-Statistik für jugendliche Raucher liegt Tschechien an zweiter Stelle hinter Österreich. In der Diskussion wurde die Aktivität unserer Nachbarn anerkannt, da es in Westeuropa keine vergleichbaren Register gibt. Daher wurden im Rahmen der „Central European Initiative Against Lung Cancer“ kooperative Forschungsprojekte zu diesem Thema vorgestellt. Es handelt sich dabei um die österreichische Registrierungsstudie für NSCLC mit EGFR-, ALK- oder ROS1-Mutationen von Martin Filipits sowie die Datensammlung über das Management von Stadium-III-Patienten von Milada Zemanova (CZ) und Karin Dieckmann (AT).</p> <h2>State of the Art</h2> <p>In den weiteren Sessions wurden zu den Themen Rolle und Ansprüche der Pathologie, lokal fortgeschrittenes und metastasiertes NSCLC, Mesotheliom und kleinzelliges N. bronchi umfassende Reviews zum State of the Art und zu den Entwicklungen in der näheren Zukunft dargestellt und diskutiert. Auch dabei war die Suche nach prädiktiven Biomarkern zur Optimierung der Patientenselektion und damit Erhöhung der Wirksamkeit der Therapien das vorherrschende Thema.<br /> Insgesamt war der Kongress in der Vorweihnachtszeit gut besucht und hat in der kurzen Zeit viele interessante Aspekte behandelt.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: OWS, 2. Interne Abteilung,
Sanatoriumstraße 2,
1140 Wien<br/>
Quelle: Translational Lung Cancer Research 2014;
3(5) (online ISSN 2226-4477)
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Kovalchik SA et al: Targeting of low-dose CT screening according to the risk of lung-cancer death. N Engl J Med 2013; 369(3): 245-54<br /><strong>2</strong> www.acr.org/Quality-Safety/Resources/LungRADS<br /><strong>3</strong> Manos D et al: The Lung Reporting and Data System (LU-RADS): a proposal for computed tomography screening. Can Assoc Radiol J 2014; 65(2): 121-34<br /><strong>4</strong> Klastersky JA: Supportive care is a constant state of changing: we need to adjust for it. Curr Opin Oncol 2014; 26(4): 371<br /><strong>5</strong> Hui et al: Definition of supportive care: does the semantic matter? Curr Opin Oncol 2014; 26(4): 372-379</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


