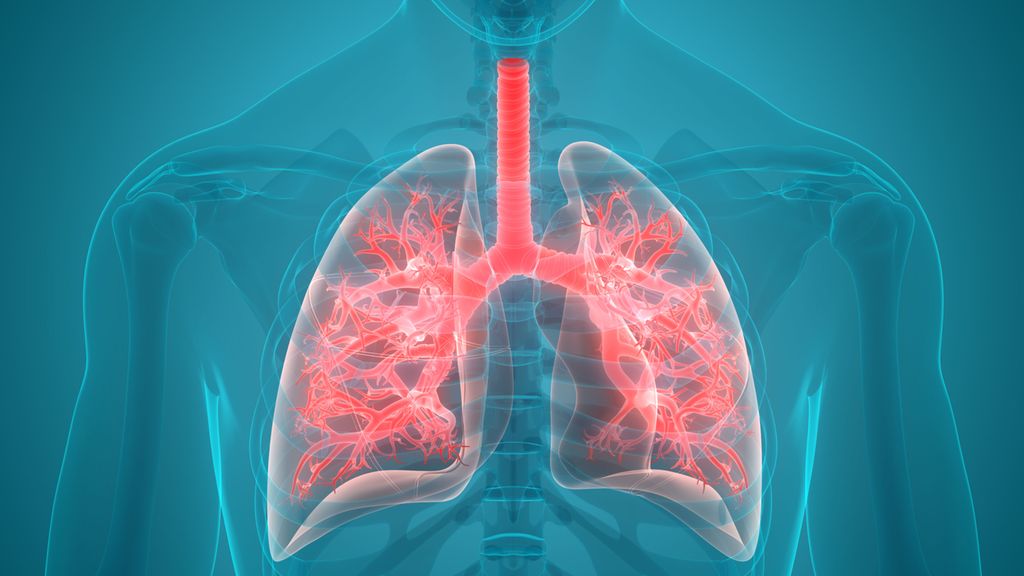
©
Getty Images/iStockphoto
Hält sich Österreich an das WHO-Rahmenübereinkommen zur Tabakkontrolle?
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger
Institut für Umwelthygiene<br> Medizinische Universität Wien<br> <a href="http://www.aerzteinitiative.at" target="-blank">www.aerzteinitiative.at</a>
30
Min. Lesezeit
08.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">180 Vertragsstaaten haben das WHO-Rahmenübereinkommen zur Tabakkontrolle (FCTC) ratifiziert <a href="http://www.aerzteinitiative.at/Rahmenkonvention.html" target="_blank">(http://www.aerzteinitiative.at/Rahmenkonvention.html)</a>. Auch Österreich hat sich 2005 völkerrechtlich verbindlich verpflichtet, das FCTC durchzuführen. Dennoch hinkt man mit der Umsetzung wesentlicher Punkte hinterher.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Nach den Begriffsdefinitionen in Artikel 1 ermutigt Art. 2 zu strengeren Maßnahmen und Art. 3 beschreibt als Ziel, die Verbreitung von Tabakkonsum und Passivrauchen stetig und wesentlich zu vermindern. Dementsprechend werden in Art. 4 als Leitlinien der Schutz aller vor dem Passivrauchen, die Reduzierung des Tabakgebrauchs und die Verhinderung des Einstiegs genannt. Art. 5 enthält allgemeine Verpflichtungen: die laufende Aktualisierung und Überprüfung nationaler Programme (5.1), wirksame Gesetze, ihren Vollzug und ihre Finanzierung (5.2).</p> <h2>Meldung von Verstößen</h2> <p>Österreich hat bisher halbherzige Tabakgesetze erlassen und die Meldung von Verstößen den Opfern aufgebürdet. Auch das Tabakgesetz 2015 hat den Vollzug nicht verbessert: Die Exekutive erhielt wieder kein Recht zur Ausstellung von Strafmandaten und andere Kontrollorgane dürfen nichts kosten. Denn der Gesetzgeber stellt dazu fest: <em>„Da nur bei dringendem Verdacht offensichtliche (‚ins Auge springende‘) Verstöße aufgezeigt werden, sind weder haftungsrechtliche Folgen für die Kontrollorgane noch eine zeitliche Mehrbelastung gegeben.“</em> Eine Finanzierung der Tabakkontrolle aus Mitteln der Tabaksteuer hat der Finanzminister abgelehnt.</p> <h2>Staatliche Maßnahmen</h2> <p>Nach Art. 5.3 sollten die staatlichen Maßnahmen vor kommerziellen und sons­tigen eigennützigen Interessen der Tabak­industrie geschützt werden. Aber Vertreter der Tabakindustrie und ihres Vertriebs­systems beeinflussen weiterhin Minister und andere Entscheidungsträger in Österreich, weil Gespräche mit ihnen geheim geführt und keine Protokolle darüber angelegt werden, die öffentlich einsehbar wären.<br /> Art. 6 gibt (detailliert seit den 2014 von den Vertragsparteien akzeptierten Leitlinien) Anweisungen zur Senkung des Ta­bakkonsums durch Preis- bzw. Steuerpolitik sowie durch Einfuhr- und Verkaufsbeschränkungen. Österreich hat bisher wesentliche Erhöhungen der Tabaksteuer vermieden, die vor allem auf Jugendliche positive Auswirkungen hätten. Auch sozial benachteiligte Gruppen, die der Aufklärung weniger zugänglich sind, würden von einer deutlichen Tabakpreissteigerung profitieren. Eine Senkung des Tabakkonsums durch Verbot der Zigarettenautomaten und Reduzierung der Tabakverkaufsstellen wurde hierzulande überhaupt noch nicht in Angriff genommen, ebenso wenig nicht preisbezogene Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach Tabak (Art. 7).</p> <h2>Schutz vor Passivrauchen</h2> <p>Eine entscheidende Bedeutung für den Erfolg der Tabakkontrolle hat Art. 8: Schutz vor Passivrauchen. Die Vertragsstaaten haben anerkannt, dass Passivrauchen Tod, Krankheit und Invalidität verursacht, und sich verpflichtet, Arbeitsräume und öffentlich zugängliche Räume zu 100 % rauchfrei zu machen. Schon auf der 2. Konferenz der Vertragsparteien (CoP-2) 2007 wurden die Richtlinien dazu beschlossen und 2009 empfahl die EU eine Umsetzung bis 2012, was nur von 3 Ratsmitgliedern (Jurásková, Raši und Stöger) nicht unterstützt wurde. In diesem Punkt, der für die Eindämmung der Tabakepidemie essenziell ist und daher auf den größten Widerstand des Tabakkartells stößt, sind Österreich, Tschechien und die Slowakei bis heute besonders rückständig. Eines der 3 Länder, in dem die reaktionären Kräfte und der Einfluss der Tabaklobby besonders stark sind, könnte daher der „Aschenbecher der EU“ werden. Österreich nimmt in den Tobacco Control Rankings der Europäischen Krebsligen schon seit 2007 den letzten Platz ein, hat die Durchsetzung einer rauchfreien Gastronomie auf Mai 2018 verschoben und vertraut darauf, dass ein Vollzug, der bisher nicht funktioniert hat, 2018 wie durch ein Wunder wirksam wird.</p> <h2>(Schad-)Stoffmessungen</h2> <p>Art. 9 behandelt die Messung der Inhaltsstoffe und der Emissionen von Tabakerzeugnissen, was nach CoP-6 auch Wasserpfeifen, rauchfreien Tabak und E-Zigaretten (auch ohne Nikotin) umfasst. Das ist einer der wenigen Punkte, in denen das österreichische Gesundheitsminis­terium für den Entwurf des Tabakgesetzes 2016 den Rat medizinischer Experten eingeholt hat. Dementsprechend lag für die Abstimmung ein relativ guter Gesetzesvorschlag zur Umsetzung der EU-Tabakprodukt-Direktive vor, den am 29. April 2016 im österreichischen Parlament auch Tabakindustrie und -handel sowie eine reaktionäre Oppositionspartei nicht mehr aufhalten konnten. Das mit 110 zu 36 Stimmen beschlossene Gesetz betrifft im Wesentlichen die Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Emissionen von Tabakerzeugnissen an amtliche Stellen und die Veröffentlichung toxischer Bestandteile (Art. 10), die Verpackung und Etikettierung sowie die Warnhinweise (Art. 11), die der EU-Direktive (TPD-II) folgen. Österreich hat auch das „Schmuggelprotokoll“ (Art. 15, CoP-5) ratifiziert, muss aber in der Praxis seine Schmuggelbekämpfung noch verbessern, wofür zweckgebundene Tabaksteuern ebenso herangezogen werden könnten wie für Aufklärung, Information, Schulung und Bewusstseinsbildung (Art. 12), für die in Österreich bisher nur ein sehr bescheidenes Budget zur Verfügung steht. Tabakprävention wird praktisch nur in der Steiermark finanziert, auf Bundesebene beschränkt sich die Tabakkontrolle im Wesentlichen auf Raucherberatung. Medienkampagnen dienten bisher eher der Imageverbesserung des jeweiligen Ressortchefs und eine gesetzlich festgelegte TV-Sendezeit von 90 Minuten pro Monat, wie sie z.B. in der Türkei besteht, um über die Gefahren von Tabak, Nikotin, Passivrauchen etc. aufzuklären, dürfte in Österreich ohne Zweckbindung von Tabaksteuern ein Wunschtraum bleiben.</p> <h2>Verbot von Werbung in Trafiken</h2> <p>Beim Verbot von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring (Art. 13) ist Österreich vor allem in Trafiken noch rückständig. Die meisten anderen EU-Mitglieder haben Zigarettenautomaten samt ihrer Werbung verboten, erlauben auch am Verkaufsort keine Tabakwerbung und keine Zurschausellung von Tabakwaren oder beschränken den Verkauf auf Trafiken ohne Außenwerbung, die erst ab 18 Jahren betreten werden dürfen. In Österreich dürfen Tabakhändler Kinder mit Süßwaren, Softdrinks, Kaugummi, Comic-Heften und dergleichen in ihr Geschäft locken und dort dem Tabakrauch und der Tabakwerbung aussetzen. Darüber hinaus wird auch noch außerhalb der Trafiken auf Tausenden Automaten geworben. In Wien erkaufte sich der Tabakkonzern Japan Tobacco International mit nur 20.000 Euro die Nachrüstung von über 18.000 Papierkörben mit Aschenrohren und die Installation von rund 1.200 freistehenden Aschenrohren in Form überdimensionaler Zigaretten, die den Raucher an jeder Haltestelle daran erinnern, sich noch rasch einen „Tschick“ anzuzünden, bevor der Bus oder der Zug kommt.</p> <h2>Präventionsmaßnahmen</h2> <p>Um die Vorbeugung der Tabakabhängigkeit ist es in Österreich schlecht bestellt und Diagnose, Beratung und Behandlung (Art. 14) erfolgt flächendeckend nur über das Rauchfreitelefon. In der Schweiz wird auch die Ausbildung zum Rauchertherapeuten aus dem Tabakpräventionsfonds finanziert, der aus der Tabaksteuer gespeist wird. Der Allgemeinmediziner kann dort 45 Minuten pro Quartal Beratungszeit für einen gesunden Raucher als Kassenleistung anbieten, der Facharzt sogar 90 Minuten.<br /> Österreich hat weder den Verkauf an Minderjährige noch die Zurschaustellung von Tabakwaren, die Lockmittel und die Automaten gemäß Art. 16 verboten. Nur mehr 3 von 27 EU-Ländern haben kein Verbot des Verkaufs von Tabakwaren an 16- und 17-Jährige. In Österreich wird nicht einmal der Verkauf an unter 16-Jährige geahndet und einige Bundesländer haben noch gar keine gesetzlichen Grundlagen für Testkäufe durch Kinder unter behördlicher Aufsicht geschaffen.<br /> Die Förderung von alternativen Tätigkeiten (Art. 17) für Tabakbauern und -arbeiter spielt in Österreich keine Rolle, wohl aber die für Einzelverkäufer; diese wurde in Österreich völlig vernachlässigt, sodass die Abhängigkeit der Trafikanten und der Monopolverwaltung von den ausländischen Tabakkonzernen aufrechterhalten wurde. Wie die von Trafikanten getragenen Proteste gegen Tabakkontrolle und EU-Direktiven zeigten, benützt die Tabakindustrie diese Gruppe (ebenso wie Funktionäre der Wirtschaftskammer, Fachbereich Gastronomie) zur Durchsetzung ihrer Geschäftsinteressen.<br /> Schutz der Umwelt und Gesundheit bei Tabakanbau und Herstellung (Art. 18) betrifft Österreich nur indirekt, indem Tabakwaren importiert werden, die zum Teil umweltzerstörend wirken und von Kindern sowie unter gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen produziert werden. Österreich hat sich auch kaum für Informationsaustausch und Weiterentwicklung des Zivil- und Strafrechtes zu Haftungsfragen inklusive Schadenersatz durch Tabakfirmen engagiert (Art. 19). Eine Dissertation und eine Diplomarbeit zu diesen Themen waren den juristischen Karrieren der beiden Autoren meines Wissens nach eher hinderlich.<br /> Die Bereitstellung von Daten und die Forschung sowie epidemiologische Überwachung (Art. 20) werden in Österreich kaum gefördert. Lieber wird Auftragsforschung bei abhängigen Stellen finanziert, welche die politisch gewünschten Ergebnisse liefern. Dagegen muss z.B. die Statis­tik Austria, die durch ein Gesetz vor politischen Übergriffen geschützt ist, sparen. Analysen zur Tabakkontrolle, die einem internationalen „peer review“ standhielten, wurden von der EU, aber bisher nicht von österreichischen Fonds unterstützt.<br /> Berichte aus Österreich an die Konferenz (CoP) dürften über das FCTC-Sekretariat eingegangen sein (Art. 21), wurden aber in Österreich nicht veröffentlicht, sodass die Vermutung naheliegt, dass sie schöngefärbt wurden und ein „shadow report“ einer NGO erforderlich wäre. Die übrigen Artikel des Vertrages behandeln vorwiegend den Informationsaustausch zwischen den Parteien, die Koordination durch das Sekretariat und rechtliche Fragen.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Zusammenfassend ist zu folgern, dass Österreich wesentliche Artikel des Vertrages (z.B. Art. 5–8) noch nicht erfüllt und der internationalen Entwicklung hinterherhinkt. Besonders besorgniserregend ist der Rückstand gegenüber Nord- und Westeuropa, aber auch gegenüber Nachbarländern wie Italien oder Ungarn. Das wurde am 5. April 2016 bei einem Symposium deutlich, zu dem die Kommission Klima und Luftqualität der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eingeladen hatte.</p> </div></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


