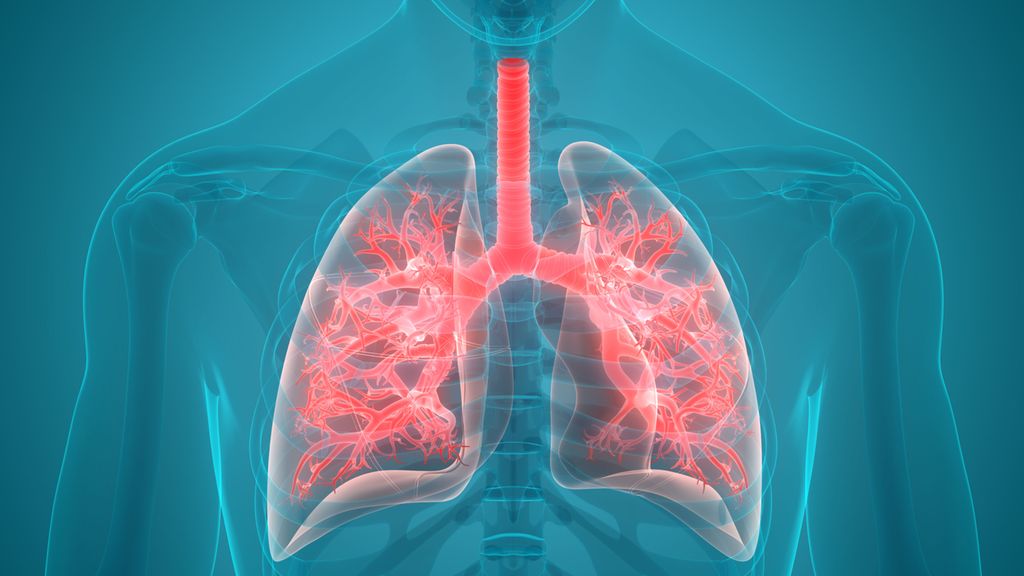
©
Getty Images/iStockphoto
10 Fragen und 10 Antworten zum pulmonalarteriellen Druck
Jatros
Autor:
Prim. Univ-Prof. Dr. Horst Olschewski
Autor:
Priv.-Doz. OA Dr. Gabor Kovacs
Klinische Abteilung für Lungenkrankheiten<br> Universitätsklinikum für Innere Medizin<br> Medizinische Universität Graz<br> Ludwig-Boltzmann-Institut für Lungengefäßforschung<br> E-Mail: gabor.kovacs@lvr.lbg.ac.at
30
Min. Lesezeit
10.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Blutdruckmessung gehört zu den wichtigsten Untersuchungen, die wir bei unseren Patienten durchführen und Bluthochdruck ist vermutlich die häufigste lebensbedrohliche Krankheit, die Ärzte weltweit behandeln. Im Folgenden möchten wir auf 10 wichtige aktuelle Fragen bezüglich des pulmonalarteriellen Druckes in Ruhe und bei Belastung eingehen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Der Blutdruck ist nicht nur im systemischen Kreislauf von großer Bedeutung, sondern auch im kleinen Kreislauf. Die Erhöhung des pulmonalarteriellen Mitteldruckes (mPAP) auf ≥25mmHg wird laut aktueller Leitlinie als pulmonale Hypertonie (PH) definiert.<sup>1</sup> Neben den pulmonalen Druckwerten in Ruhe stehen allerdings auch die während Belastung gemessenen Werte im Fokus des wissenschaftlichen Interesses.</p> <h2>1. Wie hoch ist der pulmonalarterielle Druck bei gesunden Menschen?</h2> <p>Eine Metaanalyse der Rechtsherzkatheterdaten aus den wissenschaftlichen Publikationen der letzten 70 Jahre zeigt, dass der pulmonalarterielle Mitteldruck unabhängig von Körperposition, Geschlecht und geografischer Herkunft ist und auch vom Alter nur wenig beeinflusst wird. Er beträgt bei gesunden Probanden 14,0±3,3mmHg.<sup>2</sup> Wenn wir die übliche Formel (Mittelwert + 2x Standardabweichung) für die Obergrenze des Normalen anwenden, liegt die Höchstgrenze des normalen mPAP deshalb bei 20mmHg.</p> <h2>2. Was sind die wichtigsten Ursachen einer pulmonalen Druckerhöhung?</h2> <p>Die Erhöhung des pulmonalarteriellen Drucks (PAP) kann auf vier verschiedene Ursachen (bzw. auf deren Kombination) zurückgeführt werden. Die häufigste Ursache ist eine Linksherzerkrankung (z.B. systolische oder diastolische Herzinsuffizienz, Vitium). Diese führt zur Erhöhung des pulmonalvenösen Druckes und in weiterer Folge zur Erhöhung des PAP. Die zweithäufigste Ursache ist eine Lungenerkrankung bzw. eine chronische Hypoxie (z.B. aufgrund von COPD, Lungenfibrose, Obesitas-Hypoventilationssyndrom, weltweit betrachtet auch bei Bewohnern großer Höhen festzustellen etc.). Diese Erkrankungen und Zustände können durch multiple Mechanismen (Gefäßrarefizierung, chronische Hypoxie-induzierte pulmonale Vasokonstriktion etc.) zur Erhöhung des PAP führen. Drittens werden bei ca. 4 % der Lungenembolien die intrapulmonalen Gerinnsel nicht vollständig aufgelöst, sondern führen zu einer chronischen thromboembolischen PH. Und viertens kann sich die pulmonalarterielle Druckerhöhung auch durch eine primäre Erkrankung der Lungenarterien entwickeln. Hierbei spricht man von einer pulmonalarteriellen Hypertonie (PAH), welche aber selbst wieder in viele weitere Gruppen untergliedert ist.</p> <h2>3. Ist die Erhöhung des mPAP im Bereich zwischen 20 und 25mmHg relevant?</h2> <p>Ein mPAP zwischen 20 und 25mmHg liegt nicht mehr im normalen Bereich, erfüllt aber nicht die aktuell gültigen Kriterien einer pulmonalen Hypertonie. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass die Erhöhung des mPAP über 20mmHg ein unabhängiger Prädiktor für die Mortalität ist.<sup>3</sup> Zusätzlich zeigte eine große amerikanische Studie mit über 20 000 Patienten, dass der Anstieg des mPAP bereits ab 19mmHg mit einer Verschlechterung der Prognose einhergeht.<sup>4</sup></p> <h2>4. Hat eine milde pulmonale Druckerhöhung eine therapeutische Konsequenz?</h2> <p>Da hinter einer leichten pulmonalarteriellen Druckerhöhung sehr häufig eine kardiale oder eine pulmonale Grunderkrankung steht, sollen diese Erkrankungen abgeklärt und möglichst optimal behandelt werden. Es konnte bis jetzt nicht gezeigt werden, dass eine gezielte Therapie wie bei PAH bei diesen Patienten sinnvoll ist. Evidenz dafür gibt es nur für Patienten mit einer manifesten PAH, weil nur solche Patienten in die kontrollierten Studien eingeschlossen wurden. Aktuelle Studien zielen darauf ab, bestimmte Patientengruppen (z.B. Patienten mit Sklerodermie) mit einem leicht erhöhten mPAP (aber noch <25mmHg) zu identifizieren, die ebenfalls von einer solchen Therapie profitieren könnten. Die Hypothese ist, dass bei diesen Patienten eine milde pulmonale Druckerhöhung als Vorstufe einer PH angesehen werden kann und eine Therapie in diesem Stadium die Prognose verbessert.</p> <h2>5. Ist der pulmonale Druck der wichtigste hämodynamische Parameter im kleinen Kreislauf?</h2> <p>Der pulmonale Druck ist sicherlich der wichtigste Parameter der pulmonalen Zirkulation bis zu einem Wert von ca. 26mmHg. Oberhalb dieses Wertes hat die konkrete Höhe des Drucks keine große prognostische Bedeutung mehr. Stattdessen entscheidet der pulmonale Blutfluss (Herzzeitvolumen) über die weitere Prognose. Zur Bestimmung des Blutflusses gilt weiterhin der Rechtsherzkatheter als Goldstandard. Zusätzlich ist der rechtsatriale Druck für die Prognose von großer Bedeutung. Daneben ist der pulmonalarterielle Verschlussdruck, welcher dem linksatrialen Druck entspricht, sehr wichtig, denn er gibt Information über die linksventrikuläre Funktion. Die Messung des pulmonalarteriellen Verschlussdrucks und des Herzzeitvolumens ist auch für die Berechnung des pulmonalen Gefäßwiderstandes wichtig. Ein deutlich erhöhter pulmonaler Gefäßwiderstand ist Teil der Definition der pulmonalarteriellen Hypertonie.</p> <h2>6. Wie hoch ist der normale PAP bei Belastung?</h2> <p>Anhand großer Studien kann festgestellt werden, dass die Höhe des PAP während Belastung bei gesunden Menschen praktisch linear ansteigt und vom Alter und der Belastungsstufe abhängig ist.<sup>2</sup> Der mPAP überschreitet normalerweise nicht die 30mmHg-Grenze, solange das Herzzeitvolumen unter 10l/min ist.<sup>5, 6</sup> Aus einer anderen Sicht betrachtet, soll die Steilheit des pulmonalarteriellen Mitteldruckanstiegs bei Gesunden weniger als 3mmHg pro 1l/min Herzzeitvolumenanstieg betragen.<sup>7</sup></p> <h2>7. Was sind die wichtigsten Ursachen einer pathologischen Belastungshämodynamik bei Patienten ohne manifeste PH?</h2> <p>Hier können die gleichen Ursachen genannt werden wie bei der Ruhehämodynamik, das heißt, eine Herz- oder eine Lungenerkrankung, eine chronische thromboembolische Erkrankung oder eine primär pulmonal-vaskuläre Erkrankung führen zum pathologischen Anstieg des pulmonalen Druckes während Belastung. Die Belastung kann diese strukturellen Störungen demaskieren.</p> <h2>8. Ist eine pathologische Belastungshämodynamik prognostisch relevant?</h2> <p>Es gibt kleinere Studien, die darauf hinweisen, dass eine pathologische Belastungshämodynamik prognostisch relevant ist. Eine kleine Studie bei Patienten mit Sklerodermie wies darauf hin, dass Patienten mit einem pathologischen Anstieg des pulmonalen Drucks während Belastung weniger lang überlebten als jene mit einer normalen pulmonalen Belastungshämodynamik.<sup>8</sup> Andere Studien haben die rechtsventrikuläre Funktion mithilfe von Belastungsuntersuchungen analysiert. Es konnte nachgewiesen werden, dass Patienten mit einer erhaltenen rechtsventrikulären kontraktilen Reserve eine bessere Prognose haben als Patienten mit einer eingeschränkten kontraktilen Reserve.<sup>9, 10</sup> Große prospektive Studien wurden in diesem Bereich allerdings noch nicht durchgeführt.</p> <h2>9. Hat eine pathologische Belastungshämodynamik eine therapeutische Konsequenz?</h2> <p>Auch hierzu sind lediglich kleinere, monozentrische Studien vorhanden, die darauf hindeuten, dass mit einer PAH-Therapie die Belastungshämodynamik verbessert werden kann.<sup>11, 12</sup> Größere, multizentrische Studien liegen derzeit leider nicht vor. Es ist auch unklar, ob die Besserung der Belastungshämodynamik tatsächlich mit einem prognostischen Vorteil verbunden ist.</p> <h2>10. Sollte der Begriff „pulmonale Belastungshypertonie“ wieder eingeführt werden?</h2> <p>Die Definition der PH hatte vor 2008 einen „Belastungsteil“. Dieser bezeichnete Patienten mit einem mPAP >30mmHg während Belastung. Diese Definition wurde beim 4. PH-Weltkongress verlassen, weil klar wurde, dass der pulmonale Druckanstieg während Belastung stark vom Alter und von der Belastungsstufe abhängig ist.<sup>2</sup> Die aktuell vorliegenden Daten reichen noch nicht aus, um eine neue Definition einzuführen. Wichtige Studien, welche die Bedeutung der pulmonalen Belastungshämodynamik prospektiv und multizentrisch untersuchen, sind im Laufen. Die Ergebnisse dieser Studien werden zur Entscheidung dieser Frage wesentlich beitragen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Galie N et al.: Eur Respir J 2015; 46: 903-75 <strong>2</strong> Kovacs G et al.: Eur Respir J 2009; 34: 888-94 <strong>3</strong> Douschan P et al.: Am J Respir Crit Care Med 2018; 197(4): 509-16 <strong>4</strong> Maron BA et al.: Circulation 2016; 133: 1240-8 <strong>5</strong> Kovacs G et al.: Eur Respir J 2017; 50(5). pii: 1700578 <strong>6</strong> Herve P et al.: Eur Respir J 2015; 46: 728-37 <strong>7</strong> Naeije R et al.: Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: 576-83 <strong>8</strong> Stamm A et al.: Eur Respir J 2016; 48: 1658-67 <strong>9</strong> Grunig E et al.: Circulation 2013; 128: 2005-15 <strong>10</strong> Chaouat A et al.: Eur Respir J 2014; 44: 704-13 <strong>11</strong> Kovacs G et al.: Arthritis Rheum 2012; 64: 1257-62 <strong>12</strong> Saggar R et al.: Arthritis Rheum 2012; 64: 4072-7</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


