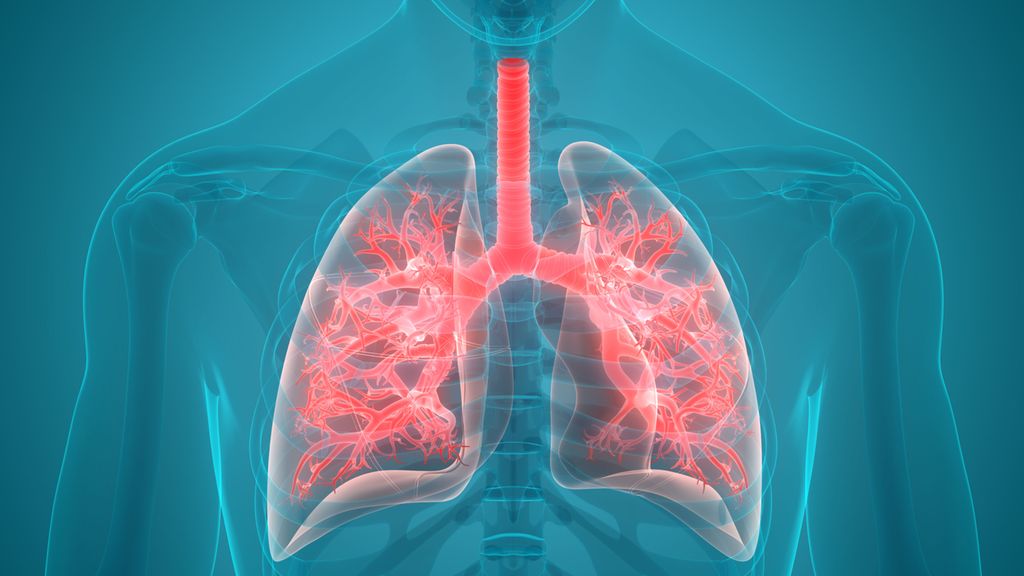
©
Getty Images/iStockphoto
Evaluation der respiratorischen Situation
Jatros
Autor:
Marlies Wagner, MSc
Klinische Abteilung für Pädiatrische Pulmonologie und Allergologie<br> Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde<br> Medizinische Universität Graz<br> E-Mail: marlies.wagner@medunigraz.at
30
Min. Lesezeit
14.03.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Eine periphere Muskelschwäche führt zu klinischen Auffälligkeiten, die leicht quantifizierbar sind. Im Gegensatz dazu ist eine Atemmuskelschwäche viel subtiler und meist viel schwieriger zu evaluieren. In diesem Artikel werden Möglichkeiten und Vorgangsweisen zur zeitgerechten Diagnosestellung einer Atemmuskelschwäche dargestellt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Einleitung</h2> <p>Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die spinale Muskelatrophie (SMA) und kongenitale Muskelkrankheiten (CMD) gehören zu den häufigsten neuromuskulären Erkrankungen im Kindesalter. Die Evaluation der respiratorischen Situation ist hierbei notwendig, um das sukzessive Versagen der Atempumpe rechtzeitig feststellen zu können. Zudem müssen atemunterstützende Maßnahmen bereits zu einem frühen Zeitpunkt eingeleitet werden, um einerseits präventiv gegen akutes Atemversagen vorzugehen und andererseits lebensbedrohliche Situationen wie respiratorische Infekte gut vorbereitet durchzustehen.</p> <h2>Problematik bei neuromuskulären Erkrankungen</h2> <p>Es kommt zu einem Atempumpversagen, da die Last der Atempumpe (z. B. durch einen respiratorischen Infekt) die Kapazität der Atemmuskulatur übersteigt und keine kompensatorische Steigerung der Atmung möglich ist. Diese wäre jedoch notwendig, um die Situation auszugleichen. Bei einer neuromuskulären Erkrankung wird die Atemmuskulatur prinzipiell schon um das Zwei- bis Dreifache mehr belastet. Der steife Brustkorb, das Bestehen von Mikroatelektasen und der mechanische Nachteil durch die Skoliose verursachen die gesteigerte Belastung der Atemmuskulatur.</p> <h2>Klinische Anamnese</h2> <p>Hierbei geht es zum Einen um die allgemeine Muskelschwäche und die Leistungsfähigkeit generell. Zum Anderen werden die subjektive Veränderung der Sprechlautstärke und der Hustenkraft, die Speichelproduktion sowie der bisherige Ablauf von respiratorischen Infekten erfasst. Dazu zählen Häufigkeit, Schwere und Sekretmanagement bei respiratorischen Infekten in der Vergangenheit. Komorbiditäten wie Skoliosen und kardiale Beteiligungen sind ebenfalls zu erheben.</p> <h2>Schlafanamnese</h2> <p>Der Schlaf stellt im Allgemeinen durch veränderte mechanische Komponenten und das veränderte Ventilations-Perfusions- Verhältnis eine Risikosituation dar. Einerseits kommt es zu einem erhöhten Atemwegswiderstand, andererseits sind die funktionelle Residualkapazität, die Aktivität der interkostalen Muskulatur, die muskuläre Aktivität im Bereich der oberen Atemwege, der zentrale Atemantrieb und die Chemosensitivität vermindert. Daher ist es notwendig, Schlafstörungen, Atempausen, Schnarchen, morgendlichen Kopfschmerz und Tagesmüdigkeit abzufragen.</p> <h2>Besonderheiten in der Pädiatrie</h2> <p>Durch den Beginn einer neuromuskulären Erkrankung während der frühen Kindheit ist das Wachstum von Lunge und Brustkorb eingeschränkt. Dies führt in weiterer Folge sehr früh zu Thorax-Deformitäten. Die Durchführung von Tests, die die Mitarbeit des Patienten erfordern (z. B. Lungenfunktionsdiagnostik), ist bei Säuglingen und Kleinkindern nicht möglich.</p> <h2>Atemmuskeltests</h2> <p>Man unterscheidet bei den Atemmuskeltests invasive und nicht invasive Tests. Zu den nicht invasiven Tests gehört die Beurteilung des Atemmusters.<br /> Zur Analyse der Bewegung im Bereich des Thorax und des Abdomens kann die <strong>optoelektronische Plethysmografie (OEP)</strong> herangezogen werden. Mithilfe von Elektroden wird das Bewegungsausmaß im Bereich des oberen Brustkorbs, der Rippen und des Abdomens in verschiedenen Positionen evaluiert und Abnormitäten der Bewegung beim Husten genau dargestellt.<br /> Die <strong>Sonografie des Zwerchfells</strong> ist ein probates Mittel zur Beurteilung der Struktur und der Dynamik des Zwerchfells.<br /> Weitere Beurteilungsmöglichkeiten der Atemmuskulatur sind <strong>Lungenfunktionsparameter</strong>. Anhand der Atemfrequenz (AF) und des Tidalvolumens (Vt) kann das Atemminutenvolumen bestimmt werden. Aus diesen Parametern kann auch der Rapid Shallow Breathing Index (AF/Vt) errechnet werden. Dieser Wert beschreibt das Verhältnis der Tiefe der Atemzüge zu ihrer Frequenz. Der Wert wird umso größer, je schneller und flacher die Atmung ist.<br /> Bei neuromuskulären Erkrankungen zeigt sich in der Lungenfunktionsdiagnostik das charakteristische Bild einer restriktiven Lungenerkrankung. Eine reduzierte Vitalkapazität kombiniert mit einer reduzierten totalen Lungenkapazität ist Zeichen für eine inspiratorische Atemmuskelschwäche, Ankylosen und Skoliose. Ein gesteigertes Residualvolumen ist Zeichen für eine exspiratorische Atemmuskelschwäche.<br /> Zur Einschätzung der Progression des − üblicherweise linear verlaufenden − Verlusts der Atemmuskelkraft ist eine regelmäßige Durchführung einer Lungenfunktionsdiagnostik zu empfehlen.<br /> Der <strong>Peak Cough Flow</strong> ist ein wichtiges Werkzeug zur Beurteilung der Hustkraft. Er korreliert mit dem Geschlecht, der Größe und der Körperoberfläche. Bei Erwachsenen liegt der kritische Wert, um eine Sekretentfernung im Bedarfsfall sicherstellen zu können, bei 160 l/min. Ein Wert über 360 l/min ermöglicht hingegen einen effektiven Hustenstoß.<br /> <strong>Maximale statische Drucke</strong> geben Auskunft über die inspiratorische Muskelkraft (PImax − von der funktionellen Residualkapazität aus gemessen) und auch die exspiratorische Muskelkraft (PEmax − von der maximalen Einatmung aus gemessen). Da die jeweilige Kraftanstrengung für mindestens 1 Sekunde gehalten werden muss, sind diese Werte bei ganz jungen Kindern oft sehr schwierig zu messen.<br /> Eine gute Alternative ist das <strong>Sniff-Nasal-Inspiratory-Pressure</strong>(SNIP)-Manöver. Hierbei wird die dynamische inspiratorische Atemmuskelkraft gemessen. Diese Methode kann auch schon bei Kindern im Alter von drei bis vier Jahren zur Beurteilung der inspiratorischen Muskelkraft angewendet werden. Das rasche Aufziehen von Luft durch die Nase ist ein natürliches Manöver, leicht erklärbar und nicht zeitabhängig.<br /> Die <strong>Polysomnografie</strong> ist eine weitere Möglichkeit zur Evaluation der respiratorischen Situation bei neuromuskulären Erkrankungen. Dieses Verfahren ist nicht invasiv, mitarbeits- und altersunabhängig. Hierbei können wichtige Informationen über die respiratorische Situation im Schlaf gewonnen werden.<br /> Zu den invasiven Tests zur Evaluation der respiratorischen Situation zählt die Messung des <strong>transdiaphragmatischen Drucks</strong> (Pdi). Mithilfe von Druckmesssonden im Magen und im Ösophagus wird bei einem schnellen maximalen inspiratorischen Manöver die Zwerchfellkraft bestimmt.<br /> Der <strong>Crying Pdi</strong> ist eine effektive Variante der transdiaphragmatischen Druckmessung, um bei Säuglingen die Zwerchfellkraft zu bestimmen.</p> <h2>Weitere Tests mit invasiver Druckmessung</h2> <p>Während eines Hustmanövers wird über eine Druckmessung im Magen die exspiratorische Muskelkraft (<strong>Pgas cough</strong>) evaluiert. Zur Bestimmung der Ausdauer des Zwerchfells und der globalen inspiratorischen Ausdauer dient der <strong>Tension- Time Index</strong> des Diaphragmas bzw. der Speiseröhre. Die letztgenannten Parameter werden in der Regel im normalen Klinikalltag eher selten angewendet, da sie sehr aufwendig sind.</p> <h2>Empfehlungen zum klinischen Management</h2> <p>Aktuelle Empfehlungen zum weiteren Vorgehen nach der Evaluation enthält Tabelle 1.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1901_Weblinks_jatros_pneumo_1901_s29_tab1_wagner.jpg" alt="" width="550" height="378" /></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Da Muskelschwäche zu ineffektivem Husten und somit zu Sekretansammlungen führen kann, sind Kinder mit einer neuromuskulären Erkrankung besonders für rezidivierende Pneumonien und Atelektasen prädisponiert, was zu einer verminderten Lungen-Compliance, erhöhtem Atemwegswiderstand und gesteigerten ventilatorischen Anforderungen führt. In weiterer Folge entwickelt sich eine respiratorische Insuffizienz, die sich − beginnend in der Nacht − bei Progression der Erkrankung auch tagsüber in einer Hypoventilation manifestiert.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wenig genützte Chance: COPD-Therapie abseits der Medikamente
Neben der medikamentösen Behandlung spielen im Management der COPD nicht-medikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dies betrifft vor allem die pulmonale Rehabilitation, die ...
Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg
Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...


