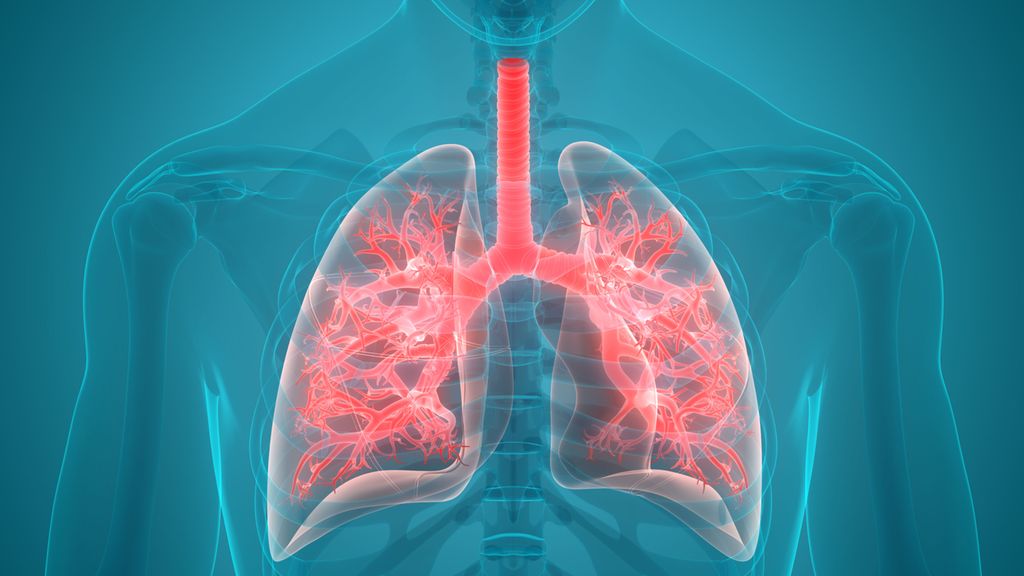
©
Getty Images/iStockphoto
Enzyme als inhalative Allergene am Arbeitsplatz
Jatros
Autor:
Dr. Vera van Kampen
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung<br> Institut der Ruhr-Universität Bochum (IPA)<br> E-Mail: kampen@ipa-dguv.de
30
Min. Lesezeit
10.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Schon seit Langem werden Enzyme industriell eingesetzt. Die Anwendungsgebiete und die Auswahl der verwendeten, vermehrt mikrobiell hergestellten Enzyme werden stetig erweitert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich bei allen inhalativ aufgenommenen Enzymen um potenzielle Allergene handelt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen katalysieren, ohne sich dabei selbst zu verändern bzw. zu verbrauchen. Da viele biochemische Reaktionen nur dann in messbarer Geschwindigkeit ablaufen, wenn sie durch Enzyme katalysiert werden, ist es nicht verwunderlich, dass Enzyme bereits seit Langem in großen Mengen in den verschiedensten Industriezweigen eingesetzt werden (Tab. 1).</p> <p>Grundsätzlich handelt es sich bei Enzymen um Naturstoffe, die früher oft direkt aus tierischen oder pflanzlichen Materialien gewonnen wurden. So stammen die Proteasen Bromelain bzw. Papain aus der Ananas bzw. der Papaya und die Pankreasenzyme Trypsin und Chymotrypsin wurden ursprünglich aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen oder Rindern isoliert. Das für die Käseherstellung unverzichtbare Chymosin (Rennin) kommt hingegen natürlicherweise im Labmagen junger Kälber vor. Inzwischen werden die meisten Enzyme ausschließlich biotechnologisch mithilfe von Mikroorganismen (Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze) hergestellt. Dabei handelt es sich einerseits um solche Enzyme, die von dem jeweiligen Mikroorganismus (Produktionsorganismus) natürlicherweise hergestellt werden. Zu den wichtigsten Produktionsorganismen zählen Bakterien der Gattung Bacillus und Schimmelpilze der Gattung <em>Aspergillus</em>. Andererseits werden aber auch immer häufiger Gene für bestimmte Enzyme aus anderen (Ursprungs-)Organismen in die jeweiligen Produktionsorganismen kloniert, sodass es eine nahezu unüberschaubare Zahl an verschiedenen Enzymen gibt. In der Enzym-Datenbank BRENDA sind derzeit Informationen zu 77 000 Enzymen aus mehr als 30 000 verschiedenen Organismen enthalten.<sup>3</sup> Auch eine Liste der kommerziellen Enzyme des Verbands der Hersteller von Enzymprodukten (AMFEP, Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products)<sup>4</sup> zeigt, dass es sehr viele verschiedene Enzyme gibt, die zwar die gleiche Reaktion katalysieren, jedoch aus völlig verschiedenen Organismen stammen und teilweise sehr unterschiedliche Aminosäuresequenzen und Raumstrukturen aufweisen. Da die Benennung eines Enzyms entsprechend der Reaktion, die es katalysiert, erfolgt, laufen alle reaktionsgleichen Enzyme unter dem gleichen Namen (z.B. existieren in der AMFEP-Liste 17 verschiedene Xylanasen) und unter einer identischen EC-Nummer (bei Xylanase: EC 3.2.1.8). Die EC-Nummern (EC, „enzyme commission“), die aus vier durch Punkte voneinander getrennte Zahlen bestehen, bilden die Grundlage der Systematisierung von Enzymen. So beginnen die ECNummern aller kohlenhydratspaltenden Enzyme (Glycosidasen) mit 3.2.1 und die aller proteinspaltenden Enzyme (Proteasen) mit 3.4 (Tab. 1 und 2). Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass reaktionsgleiche Enzyme oft unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben werden. So ist beispielsweise die sehr häufig in der Waschmittelindustrie eingesetzte Protease Subtilisin, die ursprünglich aus dem Bakterium <em>B. subtilis</em> gewonnen wurde, als Alcalase<sup>®</sup>, Esperase<sup>®</sup>, Durazym<sup>®</sup>, Maxatase<sup>®</sup>, Savinase<sup>®</sup> etc. erhältlich. Teilweise sind diese Enzyme identisch, teilweise unterscheiden sich jedoch ihre Sequenzen oder Strukturen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1802_Weblinks_jatros_pneumo_1802_s10_tab1.jpg" alt="" width="2151" height="1283" /></p> <h2>Sensibilisierende Wirkung von Enzymen</h2> <p>Inzwischen sind in der Literatur viele Fälle von Atemwegssensibilisierungen nach beruflicher Exposition gegenüber Enzymstäuben beschrieben worden. Während für einige Enzyme bisher nur einzelne Kasuistiken vorliegen, existieren für andere z.T. mehrere Fallserien und Querschnittstudien in entsprechend exponierten Kollektiven. Einen zusammenfassenden Überblick über die bisher in der Literatur als atemwegssensibilisierend beschriebenen Enzyme gibt Tabelle 2.</p> <p>Neben den Kasuistiken und Studien zu einzelnen Enzymen gibt es detaillierte Übersichten über Enzyme als berufliche Atemwegsallergene generell<sup>1, 2, 22, 23</sup> bzw. über Enzyme in einzelnen Industrien wie der Waschmittelindustrie<sup>24, 25</sup> oder der Backindustrie<sup>18, 26</sup>. All diese Studien belegen, dass Beschäftigte, die gegenüber Enzymstäuben exponiert sind, ein erhöhtes Sensibilisierungsrisiko aufweisen. In Rahmen einer Studie wurden Sensibilisierungsprävalenzen für Aspergillus-Enzyme von 8 % für Glucoamylase, 11 % für Xylanase, 13 % für Cellulase und bis zu 34 % für α-Amylase berichtet.<sup>2</sup> Wie bereits von Baur und Mitarbeitern im Jahr 2000 beschrieben, sind aerogene Enzyme potente Inhalationsallergene, sodass die entsprechenden Sensibilisierungen auch in vielen Fällen zu rhinokonjunktivalen und/oder asthmatischen Beschwerden bzw. zur Diagnose einer Berufsallergie führen.<sup>23</sup> So reagierten in α-Amylase-sensibilisierten Kollektiven zwischen 16 % und 100 % positiv im bronchialen Provokationstest auf das Enzym.<sup>2</sup> In der Enzymindustrie ist man sich des Risikos berufsbedingter Sensibilisierungen bewusst. Unter Mitwirkung verschiedener US-amerikanischer und europäischer Enzymhersteller wurde z.B. ein Programm initiiert, in dessen Rahmen in ca. 100 enzymherstellenden bzw. -verarbeitenden Firmen Luftmessungen zur Expositionsabschätzung durchgeführt wurden.<sup>27</sup> Zudem wurden die ca. 23 000 Mitarbeiter über das Sensibilisierungsrisiko, die richtige Handhabung der Produkte und den Gebrauch von Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz) aufgeklärt. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter regelmäßig untersucht (Lungenfunktionstest, Überprüfung einer möglichen Enzymsensibilisierung mittels Haut-Pricktests oder spezifischen IgETests) und bezüglich allergischer Beschwerden befragt. Die Sensibilisierungsprävalenz lag dabei bei ca. 8 % .<sup>27</sup></p> <p>Insgesamt herrscht Konsens darüber, dass inhalativ aufgenommene Enzyme grundsätzlich Allergene sind. Aus diesem Grunde findet sich auch in der MAK- und BAT-Werte-Liste der Eintrag, „dass zahlreiche Vertreter aus dieser Stoffgruppe eine sensibilisierende Wirkung an den Atemwegen aufweisen können“.<sup>28</sup> Auch auf EU-Ebene sind Enzyme entsprechend der CLP-Verordnung („regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures“) mit H334 „Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atemwegsbeschwerden verursachen“ (früher R42) gekennzeichnet.<sup>29</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1802_Weblinks_jatros_pneumo_1802_s11_tab2.jpg" alt="" width="1419" height="1984" /></p> <h2>Fallstricke bei der Diagnostik der Enzymallergie</h2> <p>Wie bereits erwähnt, sind Enzyme potente Typ-I-Allergene. In den meisten publizierten Fällen einer berufsbedingten Enzymallergie war ein Tätigkeitsbezug eindeutig gegeben und fast immer korrelierten Symptome, Hauttestergebnisse, der Nachweis spezifischer IgE-Antikörper und – wenn durchgeführt – auch das Ergebnis des spezifischen Provokationstests gut. Ein Problem kann allerdings darin bestehen, das geeignete Enzymmaterial für die Allergietestung zu finden. Einerseits stehen nur wenige kommerzielle Pricktest- Lösungen oder spezifische IgE-Tests für Enzyme zur Verfügung. Zum anderen unterscheiden sich reaktionsgleiche Enzyme oft deutlich in ihrer Aminosäuresequenz und/oder der räumlichen Struktur und sind deshalb nicht immer kreuzreaktiv. So auch im Falle eines 60-jährigen Chemiearbeiters, der seit 32 Jahren mit der Herstellung und Verpackung von Detergenzien betraut war und seit 10 Jahren beim Umgang mit dem Enzympräparat Termamyl<sup>®</sup>, einer α-Amylase, über sich verschlimmernde Rhinokonjunktivitis und Atemnot klagte. Während der kommerziell verfügbare IgE-Test mit α-Amylase aus A. oryzae negativ verlief, war der IgE-Test mit dem Enzympräparat Termamyl<sup>®</sup> positiv (21,6 kU/l).<sup>6</sup> Dabei handelt es sich um eine bakterielle α-Amylase aus <em>B. stereothermophilus</em>, die nach vorheriger gentechnischer Veränderung von vier Aminosäuren kommerziell in dem Bakterium <em>B. licheniformis</em> produziert wird. Auch Elms und Mitarbeiter fanden in ihrer Studie unter Verwendung von polyklonalen Kaninchenseren keine Kreuzreaktivität zwischen fungalen und bakteriellen α-Amylasen. Darüber hinaus zeigten aber auch die bakteriellen α-Amylasen aus <em>B. amyloliquefaciens</em> und <em>B. licheniformis</em> sowie die fungalen Glucoamylasen aus <em>A. niger</em> und <em>Rhizopus</em> keinerlei Kreuzreaktivitäten.<sup>30</sup> Dies zeigt, wie wichtig es bei der Diagnostik von berufsbedingten Enzymsensibilisierungen ist, dass genau das Enzympräparat als Testmaterial verwendet wird, gegenüber dem der Patient auch tatsächlich exponiert war. Somit ist es empfehlenswert, die Patienten um Produktproben vom Arbeitsplatz zu bitten. Ist dies nicht möglich, oder soll ein weiterer Extrakt getestet werden, muss exakt recherchiert werden, mit welchem Enzym (Ursprungsorganismus, Produktionsorganismus, Handelsname etc.) der Patient Umgang hatte.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Enzyme werden seit Langem und in immer größerem Ausmaß industriell eingesetzt. Seit den 1960er-Jahren werden zunehmend berufsbedingte Allergien gegen natürliche, inzwischen aber vermehrt gegen mikrobiell hergestellte und teilweise gentechnisch veränderte Enzyme beschrieben. Es kann davon ausgegangen werden, dass alle inhalativ aufgenommenen Enzyme Allergenwirkung haben. Dabei handelt es sich in der Regel um Typ- I-Allergien.</p> <p>Bei der Diagnostik muss berücksichtigt werden, dass reaktionsgleiche Enzyme, je nachdem aus welchem Organismus sie stammen und ob sie direkt daraus isoliert oder gentechnisch (verändert) hergestellt wurden, eine große Heterogenität aufweisen können. Selbst wenn sie unter einem Namen und einer gemeinsamen EC-Nummer subsumiert werden, kann eine Kreuzreaktivität zwischen diesen Enzymen fehlen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Baur X: Int Arch Occup Environ Health 2005; 78(4): 279- 86 <strong>2</strong> Green BJ et al.: J Allergy (Cairo) 2011; 2011: 682574. doi: 10.1155/2011/682574 <strong>3</strong> Enzym-Datenbank BRENDA. The Comprehensive Enzyme Information System. Updated Januar 2018. Braunschweig. http://www.brenda-enzymes. org/ <strong>4</strong> Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products (AMFEP): List of commercial enzymes. Updated Mai 2015. Brüssel. http://www.amfep. org/content/list-enzymes <strong>5</strong> Brisman J et al.: Occup Environ Med 2004; 61(6): 551-3 <strong>6</strong> Baur X et al.: Am J Ind Med 2013; 56(3): 378-80 <strong>7</strong> Simonis B et al.: Allergo J Int 2014; 23(8): 269-73 <strong>8</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2003; 57: 388-91 <strong>9</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2004; 58: 103-6 <strong>10</strong> Belleri L et al.: Allergy 2002; 57(8): 755 <strong>11</strong> Escudero C et al.: Allergy 2003; 58(7): 616-20 <strong>12</strong> Stöcker B et al.: Arch Environ Occup Health 2016; 71(5): 259-67 13 van Kampen V et al.: Pneumologie 2013; 67: 260-4 <strong>14</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2016; 70: 442-5 <strong>15</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2002; 56: 182-6 <strong>16</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2005; 59: 405-10 <strong>17</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2007; 61: 159-61 <strong>18</strong> Harris- Roberts J et al.: Am J Ind Med 2009; 52(2): 133-40 <strong>19</strong> De Palma G et al.: Ann Allergy Asthma Immunol 2014; 112(6): 553-4 <strong>20</strong> Loureiro G et al.: J Investig Allergol Clin Immunol 2009; 19(3): 242-4 <strong>21</strong> van Kampen V et al.: Pneumologie 2008; 62: 707-10 <strong>22</strong> Baur X et al.: Int Arch Occup Environ Health 2014; 87(4): 339-63 <strong>23</strong> Baur X et al.: Dtsch med Wochenschr 2000; 25(30): 912-7 <strong>24</strong> van Rooy FG et al.: Occup Environ Med 2009; 66(11): 759-65 <strong>25</strong> Brant A et al.: Clin Exp Allergy 2006; 36(4): 483-8 <strong>26</strong> J ones M e t a l.: Allergy 2016; 71(7): 997-1000 <strong>27</strong> Basketter DA et al.: J Occup Environ Hyg 2015; 12(7): 431-7 <strong>28</strong> MAK- und BATWerte- Liste 2017 der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Weinheim: Verlag Wiley- VCH, 2017 <strong>29</strong> Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Gefahrstoffliste 2016 – Gefahrstoffe am Arbeitsplatz (IFA-Report 1/2016). Berlin: November 2018. http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/rep0116.pdf 30 Elms J, Robinson E , M ason H e t a l.: A nn O ccup H yg 2006; 50(4): 379-84</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


