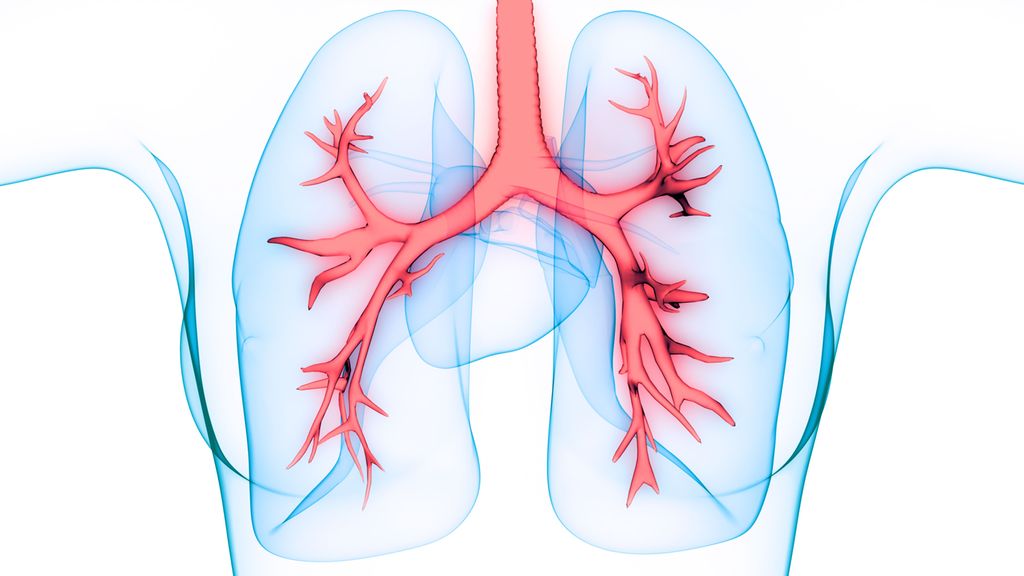
Dieselskandale gibt es mehrere – NO2 ist nicht unter den ersten drei
Arbeits- und Umweltmedizin, Baubiologe (IBO)
Wissenschaftlicher Leiter des Kurses Umweltmedizin der ÖÄK, Innsbruck
E-Mail: h.fuchsig@ikbnet.at
Sind Stickoxide relativ harmlos? Ultrafeine Partikel (UFP) samt Beladung mit polyzyklischen Aromaten (PAK) und Metallabrieb aus dem Motor scheinen großteils für die epidemiologisch dem Stickstoffdioxid (NO2) zugeschriebenen Gesundheitsschäden verantwortlich zu sein.
Die medial viel diskutierte Expositionsstudie von Prof. Kraus, Aachen, hat mit bislang einmaliger Genauigkeit gezeigt, dass beim Gesunden unterhalb von 3000μg/m³ NO2 keine akuten Effekte auftreten. Die WHO spricht von Studien, die ab 1500μg/m³ leichte Effekte zeigen, andere finden bis 6000μg/m³ (Arbeitsplatzgrenzwert in der Schweiz) nichts. Bei Asthmatikern spricht die WHO von einem klaren „lowest observed effect level“ (LOEL) von 400–500μg/m³. Wie kommt es dann zu Jahresmittelwerten von 40μg/m³ und einem Einstundenmittel von 200μg/ m³?
Die Datenlage verdichtet sich, dass für die epidemiologisch dem Stickstoffdioxid (NO2) zugeschriebenen Gesundheitsschäden der ultrafeine Partikel (UFP) samt Beladung mit polyzyklischen Aromaten (PAK) und Metallabrieb aus dem Motor verantwortlich zeichnet. Diese Verwechslung konnte nur deswegen geschehen, weil man glaubte, UFP würden mit PM2,5 ausreichend erfasst. Dabei wurde allerdings der Fortschritt der Motorentechnik übersehen – seit dem Jahr 2000 ist der Druck im Dieselmotor bis auf 4000bar (PKW) oder sogar 12 000bar (Lkw) gestiegen (lt. persönlicher Auskunft eines Entwicklers der Fa. Bosch). Die mit NOx korrelierenden ultrafeinen Partikel dürften für 95 % der NO2-Schäden verantwortlich sein (Abb. 1). Der gestiegene Druck hat die Masse der Partikel extrem reduziert, die Anzahl nicht. Ein Euro-V-Lkw emittiert die gleiche Zahl, aber nur ein Zehntel der Masse eines Euro III, im Vergleich zu Euro I gar nur ein Dreißigstel. Das leichteste 1 % der Masse hat aber 80 % der – für die Gesundheit relevanten – Oberfläche. Wenn wir ein Partikel mit 5μm (wird teils sogar bei PM2,5 mit erfasst) aus einer Mischung mit 1 Mio. Partikeln mit 50nm (frisches Dieselabgas) entfernen, ist die Luft scheinbar um 50 % besser geworden, die Oberfläche ist immer noch 99 % . Eine weitere Täuschung brachte die sinnvolle Entfernung des Schwefels aus dem Diesel: Der Sulfatmantel hat viel Wasser um den Partikel gebunden, nun sind wir um diesen harmlosen Teil „besser“. Das erklärt auch Gerüchte, dass die Containerschiffe „ja mehr emittieren als alle Dieselfahrzeuge zusammen“ – der hohe Schwefelanteil des Schiffsdiesels bringt einen höheren Wassergehalt auf die „PM10- Waage“. Für die Gesundheit gilt diese Aussage nicht. Aus dem schwarzen Ruß ist unsichtbarer, alle biologischen Barrieren durchdringender, ultrafeiner Partikel weit unter den Lichtwellenlängen geworden.
Ruß/„black carbon“ ist ex aequo mit Methan als Klimatreiber anerkannt. Weil diese beiden viel schneller aus der Atmosphäre verschwinden, haben 400 Wissenschaftler 2012 dazu aufgerufen, sich mehr auf sie als auf CO2 zu konzentrieren.
Mechanische Generierung (Abrieb etc.) bringt praktisch nur Partikel über 1000nm hervor, die häufig auch natürlichen Ursprungs sind (Pollen, Erosion, salzhaltige Luft am Meer). Weil es sie schon vor dem Menschen gegeben hat, haben wir dafür mehrere „Filtermechanismen“. Mundatmer haben daher ein deutlich höheres Risiko für Staublunge, Vorgeschädigte wie Raucher leiden stärker unter gröberen Partikeln, wie sie mit PM10 erfasst werden. Die sekundär durch Kondensation aus Ammoniak aus der Landwirtschaft oder aus Stickoxiden entstandenen Partikel sind weniger gefährlich, da sie löslich sind.
1000nm gilt zwar als alveolengängig, allerdings penetriert diese Größe die Alveolarwand nicht. Unter 100nm geht der nun penetrierende Partikel auch durch Zellwände und wurde bereits sogar in Gehirnen von Ungeborenen sowie Erwachsenen (über nasale Translokation wie Herpesviren via Bulbus olfactorius) gefunden. Kinderärzte haben Anfang 2018 davor gewarnt, dass die Partikel pränatal die Blut-Hirn-Schranke beschädigen können; zahlreiche Folgeschäden, vor allem im Sinn mentaler Beeinträchtigungen, werden befürchtet.
Die Hauptlast stellt epidemiologisch, experimentell gesichert und biologisch plausibel, die Zunahme an Herzinfarkten und Schlaganfällen dar. Die kleinsten Partikelgrößen führen über eine Erhöhung der Blutgerinnung und permanente Entzündung – unter anderem über oxidativen Stress – zu mehr thrombotischen Ereignissen. Damit wird eine Erhöhung der Sterblichkeit plausibel.
Die Lösung – Partikelfilter auch zur Nachrüstung
Selten ist eine Technik derart wirksam. Studien von AVL und der ETH Zürich haben gezeigt, dass 99,99 % Reduktion Standard sind und manchmal im Abgas weniger Partikel zu finden sind als in der Ansaugluft. Beim Pkw wurde der Filter mit Euro V (2010) Pflicht, beim Lkw leider erst mit Euro VI (2014). Deutlich wird die Reduktion der Mutagenität durch den Filter (PKW Euro V+VI; Abb. 2).
Was macht die Politik? Diese Erkenntnisse haben in der Schweiz zu einer langjährigen Diskussion, aber auch zielgerichtetem Handeln geführt. Busse in öffentlichem Interesse fahren nur dann von der Mineralölsteuer befreit, wenn sie Filter haben – 95 % der Busse wurden nachgerüstet bzw. sind Euro VI. Größere Baumaschinen müssen Partikelfilter haben – und die Funktion wird auf den Baustellen streng überprüft. Selbst Schiffe und Dieselloks der Schweiz wurden nachgerüstet. So kann unser Nachbar den PM2,5-Grenzwert von 12,5μg/m³ vermutlich bald einhalten, während wir bei doppelt so hohen Grenzwerten Überschreitungen verzeichnen müssen. Die WHO hat 2017 darauf hingewiesen, dass selbst ihr Grenzwertvorschlag von 10μg/m³ die Gesundheit nicht ausreichend schützt. Israel wird ab 10/2018 Lkw ohne Filter bei den jährlichen Kontrollen aus dem Verkehr ziehen, auch in anderen Ländern wurden insgesamt bereits bald zwei Millionen Partikelfilter nachgerüstet.
Die bei uns mangelnde Nachrüstung aller viel und noch lange im Betrieb stehenden Schwerfahrzeuge etc. führt zu einem direkten Gesundheitsschaden von mindestens 10 Cent pro Liter und dem Doppelten durch Produktionsverlust in der Wirtschaft. Ein zweiter Aspekt ist beim Diesel besonders ärgerlich: die steuerliche Begünstigung (in Österreich 8 Cent pro Liter). Würden wir CO2-Steuern wie in Schweden oder British Columbia einführen (was den momentanen Klimaschaden von 80 Euro pro Tonne abbildet), müssten pro Liter Diesel 21 Cent zusätzlich abgeführt werden, da pro Liter 2,6kg CO2 entstehen. Sehr langfristig wird mit bis zu 500 Euro Schaden pro Tonne CO2 gerechnet.
Weitere Dieselskandale sind die größere Lärmerregung im Bereich von Wohnstraßen und der Zusatz von Palmöl, der in Österreich die Menge erreicht, die in Lebensmitteln verarbeitet wird. Palmöl ist das Fett mit dem geringsten Bodenverbrauch und kann nachhaltig gewonnen werden, auch wenn das in der Praxis heute noch selten erfolgt. Für eine kaum sauberere Verbrennung in Motoren und Kraftwerken sind unsere Lebensmittel viel zu schade (von der Menge Mais, die eine Tankfüllung Ethanol ergibt, kann man ein Jahr lang leben) und zukünftig zu knapp.
Ein weiterer Skandal sind die Zerstörung von Partikelfiltern und der Einbau von sogenannten Emulatoren, die den Harnstoffverbrauch stark reduzieren und damit die Stickoxidbelastung vervielfachen. Den eingesparten Kosten steht ein Vielfaches an Schäden an der Allgemeinheit gegenüber.
Mit Benzin, Kerosin, Heizöl und anderen Ölprodukten teilt Diesel auch die militärischen Kosten. Der Großteil der außerhalb der USA positionierten Streitkräfte ist in und um die Öllieferländer stationiert, die USA importieren immer noch die Hälfte ihres Bedarfes. Das soll zu Kosten von 10 bis 100 Cent pro Liter führen.
Arbeitsmediziner sind gewohnt, Ratschläge an Kosten-Nutzen-Überlegungen auszurichten. In diesem Fall bedeutet das eine Nachrüstung intensiv genutzter Schwerfahrzeuge mit Filtern – evtl. durch eine Anpassung der Mineralölsteuer auf Diesel finanziert. Die Elektromobilität ist als Teil der Energiewende zu bejahen, der Schwerpunkt sollte zunächst auf Zweirädern liegen, da hier mit wenig Geld auch Lärm eingespart werden kann.
Natürlich wissen wir um die Bedeutung von Hausbrand und die Wichtigkeit von Alltagsbewegung. Prävention kommuniziert jedoch dann besonders effektiv, wenn sie Bewusstseinsfenster nutzt wie die Dieseldiskussion, die derzeit an der Gesundheit vorbeigeführt wird.
Eine Software, die niedrige Werte vortäuscht, ist ein schwerer Betrug. Kaum ein Hersteller kann die NO2-Grenzwerte ohne teure Technik zur Stickstoffminimierung (selektive katalytische Reduktion, SCR) einhalten. Die Stickoxide sind problematisch wegen ihres Beitrags zur Überdüngung, zur Entstehung von Ozon in trockener Hitze, wie sie in kommenden heißen, niederschlagsarmen Sommern wieder zum Problem werden könnte – besonders für Lungenkranke, die die Hitze schlecht vertragen. Aber die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) forderte auf ihrer Pressekonferenz am 7. März 2018 ein, sich dem gefährlicheren Feinstaub zu widmen. Es ist Unsinn, viel Geld in die Reduktion eines gesundheitlich wenig relevanten Stoffes zu investieren, wenn hocheffizient der Hauptschädiger beseitigt werden kann.

Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


