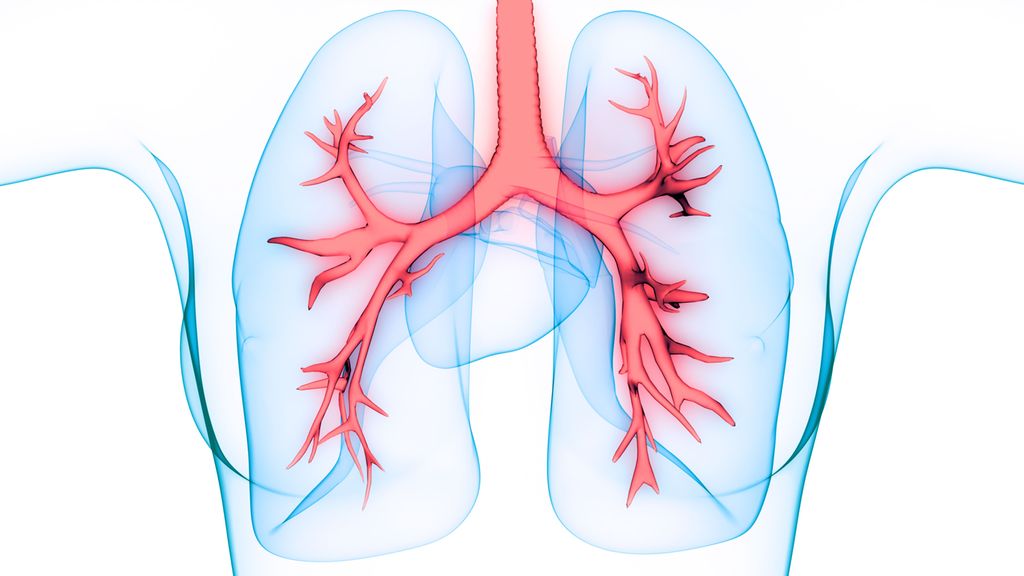
©
Getty Images/iStockphoto
„Decision making“ für die Lungentransplantation – funktionelle Aspekte und Patientenselektion
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Peter Jaksch
Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie<br> Universitätsklinik für Chirurgie<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: peter.jaksch@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
13.12.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Durchführung einer Lungentransplantation (LuTX) ist eine etablierte Therapieoption bei chronischen Lungenerkrankungen, wenn alle anderen therapeutischen Optionen (medikamentös, chirurgisch, Rehabilitation, Sauerstofftherapie) ausgeschöpft sind. Ziele der Operation sind die Verbesserung der Lebensqualität und der Überlebenszeit. Die prognostischen Faktoren der Grunderkrankung der Patienten sowie der individuelle Krankheitsverlauf sollten den Überlebensraten nach LuTX gegenübergestellt werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>In Österreich wurde 1989 die erste Lungentransplantation von Prof Walter Klepetko durchgeführt. Seither wurden im AKH Wien (Medizinische Universität Wien) bis Sommer 2018 mehr als 2000 Patienten lungentransplantiert (derzeit jährlich mehr als 100), womit das AKH/MUW Wien zu den fünf größten LuTX-Zentren weltweit zählt (Abb. 1). Jährlich werden international mehr als 4000 Transplantationen verzeichnet.</p> <h2>Patientenselektion für die Transplantation</h2> <p>In den meisten Fällen wird eine doppelseitige Operation durchgeführt. Gründe dafür sind einerseits das bessere Langzeitüberleben und zweitens Probleme, die von einer im Körper belassenen Lungenhälfte ausgehen können (Tumoren, Infektionen, atemmechanische Probleme).<br /> Die Beurteilung, ob ein Patient ein Kandidat für diesen komplexen und aufwendigen chirurgischen Eingriff ist, erfolgt im jeweiligen Transplant-Zentrum. Es gibt internationale und nationale Leitlinien für zuweisende Ärzte, um schon im Vorfeld ein entsprechendes Screening vornehmen zu können und auch um den Patienten unnötige Untersuchungen und voreilige Hoffnungen zu ersparen.<br /> Für die häufigsten Lungenerkrankungen gibt es jeweils spezielle Richtlinien, wann Patienten dem Transplantzentrum vorgestellt werden sollten und wann der optimale Zeitpunkt zur Listung ist. Generell kann gesagt werden, dass eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem TX-Zentrum vor allem bei IPF, IPH und CF sinnvoll ist.</p> <h2>Indikationen für die Lungentransplantation</h2> <p>Die häufigste Indikation ist weiterhin das Lungenemphysem (COPD) (Abb. 2): Mehr als 200 Patienten werden jährlich an die LuTX-Vorstellungsambulanz mit der Frage überwiesen, ob sie geeignete TX-Kanditen wären. Aus dieser doch großen Gruppe müssen die 30 bis 40 am besten geeigneten ausgesucht werden. Dabei handelt es sich um diejenigen, bei denen das beste Überleben sowie die beste Lebensqualität nach der TX am wahrscheinlichsten sind. Die entscheidenden Faktoren sind, abgesehen vom biologischen Alter, der muskuläre Zustand, das Körpergewicht sowie die Möglichkeit und der Wille, eine intensive pulmonale Rehabilitation während der Wartezeit durchzuführen. Da es sich bei diesen Patienten oft um ehemalige Raucher handelt, sind, abgesehen von absoluter Nikotinfreiheit für mindestens sechs Monate, auch alle anderen rauchassoziierten Morbiditäten auszuschließen (koronare Herzkrankheit, Tumoren etc.). Sonstige klinische Parameter sind ein FEV<sub>1</sub> < 25 % und ein BODE-Index von > 7 (Tab. 1).<br /> Weitere häufige Indikationen zur LuTX sind die idiopathische Lungenfibrose (IPF), die zystische Fibrose (CF) sowie alle Formen der pulmonalen Hypertonie. Außerdem gibt es Patienten mit eine Reihe weiterer seltener Lungenerkrankungen wie der Lymphangioleimyomatose (LAM) oder der Histiozytose, die auch zu einer Transplantation zugewiesen werden.<br /> Mögliche Kandidaten für eine LuTX müssen sorgfältig voruntersucht werden, um Komorbiditäten zu erfassen, die eine absolute oder relative Kontraindikation darstellen (Tab. 2). Bei Patienten, die älter als 50 Jahre sind, sind Begleiterkrankungen wie kardiovaskuläre Probleme (besonders bei Exrauchern), extrapulmonale Organdysfunktionen (Niere, Leber) sowie der Ausschluss eines Malignoms relevant für die Eignung zur LuTX. Bei CF-Patienten und bei anderen Lungenerkrankungen mit chronischer Infektion ist ein Keimbefund aus dem Sputum oder aus der bronchoalveolären Lavage notwendig, um multioder panresistente Keime auszuschließen, da diese auch eine relative Kontraindikation darstellen können (Tab. 2).</p> <h2>Relativ günstige Situation bei Spenderorganen</h2> <p>Die Wartezeiten auf ein Organ sind in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern immer noch relativ kurz. Durchschnittlich wartet ein Empfänger sechs bis neun Monate auf eine Transplantation. In akuten Fällen kann die Wartezeit auch deutlich kürzer sein. Die Mortalität auf der Warteliste ist im internationalen Vergleich ebenfalls sehr gering (< 2–3 %).<br /> Der Großteil der Spenderorgane kommt von hirntoten Spendern, die an einer intrazerebralen Blutung verstorben sind. Die Qualität der Spenderlungen muss optimal sein, nur so können ein gutes perioperatives Outcome und ein adäquates Langzeitüberleben gewährleistet werden. Vorgeschädigte Spenderorgane können heute durch die sogenannte Ex-vivo-Lungenperfusion verbessert werden. Dabei werden Organe bis zur Implantation nicht wie üblich auf Eis gelagert, sondern für mehrere Stunden mit einer Speziallösung perfundiert und beatmet. In etwa zwei Drittel der Fälle verbessert sich durch diese Behandlung die Funktion eines primär nicht akzeptablen Organs und es kann implantiert werden. Mehrere Studien konnten in den letzten Jahren zeigen, dass die Verwendung von ex-vivo lungenperfundierten Organen zu einem ausgezeichneten Kurz- und Langzeitüberleben führt.<br /> Entscheidend für ein gutes Langzeitüberleben ist die Auswahl der Empfänger. Je älter der Empfänger ist und je mehr Komorbiditäten bestehen, desto geringer sind die postoperative Lebenserwartung und die Lebensqualität der Patienten. Es ist nicht nur die perioperative Zeit, die ein hohes Risiko birgt. Auch im Langzeitverlauf können viele Probleme auftreten, sei es durch akute Abstoßungsreaktionen, schwere Infektionen oder durch die Nebenwirkungen der lebenslang durchzuführenden immunsuppressiven Therapie.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1806_Weblinks_jatros_pneumo_1806_s18_abb1+2.jpg" alt="" width="1417" height="1982" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1806_Weblinks_jatros_pneumo_1806_s20_abb3+tab1.jpg" alt="" width="1419" height="2912" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1806_Weblinks_jatros_pneumo_1806_s21_tab2.jpg" alt="" width="1419" height="1065" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Weill D et al.: A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014 – an update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant 2015; 34: 1-15</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wenig genützte Chance: COPD-Therapie abseits der Medikamente
Neben der medikamentösen Behandlung spielen im Management der COPD nicht-medikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dies betrifft vor allem die pulmonale Rehabilitation, die ...
Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg
Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...


