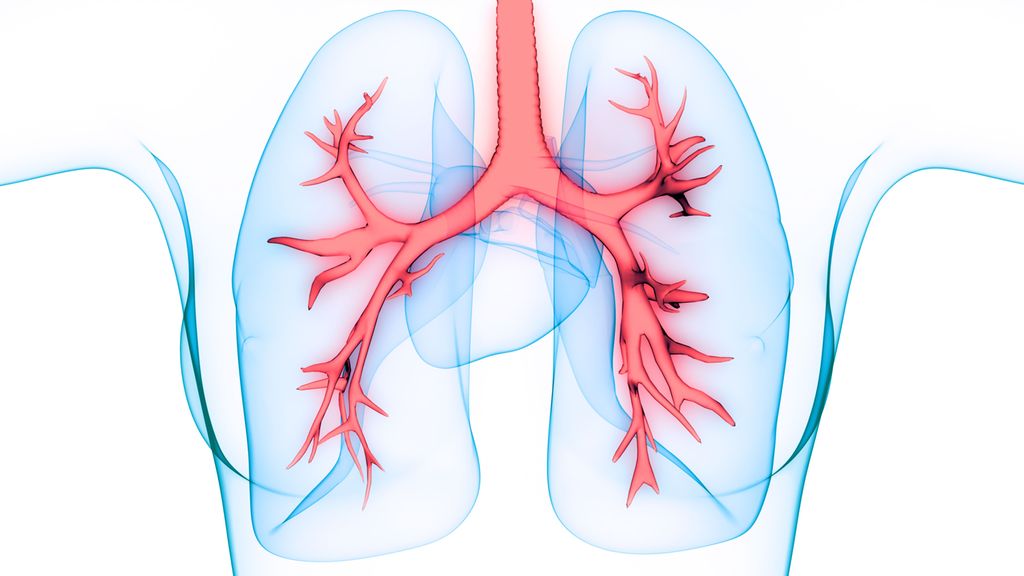<p class="article-intro">Neben direkten Effekten wie Hitze und der Zunahme von Extremwetterereignissen sind mit dem Klimawandel auch indirekte Folgen für unsere Gesundheit verbunden: Veränderte Umweltbedingungen – insbesondere steigende Temperaturen – können die Ausbreitung gebietsfremder gesundheitsrelevanter Organismen begünstigen. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus aus Public-Health-Sicht?</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Der mit dem Klimawandel einhergehende Temperaturanstieg begünstigt die Ansiedelung und Ausbreitung gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten.</li> <li>Diese bringen Risiken für die Gesundheit mit sich, etwa Infektionen und bisher unbekannte Allergene.</li> <li>Es ist notwendig, verstärkt präventive Maßnahmen zu setzen, um der Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten entgegenzuwirken, dazu zählen auch Schutz und Förderung heimischer Biodiversität.</li> </ul> </div> <p>Dengue, Chikungunya und West-Nil- Fieber – exotisch klingende Krankheiten, die eher an tropische Gebiete denken lassen. Sie verbindet ein gemeinsamer potenzieller Vektor: Aedes albopictus (Abb. 1), auch als Asiatische Tigermücke bekannt und in den letzten Jahren vermehrt in den Schlagzeilen heimischer Medien zu finden. <br />Die ursprünglich aus den asiatischen Tropen und Subtropen stammende Art ist ein prominenter Vertreter gesundheitsrelevanter „Aliens“ bzw. „Neobiota“. Unter diesen Begriffen werden ganz allgemein gebietsfremde Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie Mikroorganismen verstanden, die seit 1492 unter Mitwirkung des Menschen absichtlich oder unabsichtlich in ein neues Gebiet gelangen. Die Ausbreitungswege sind dabei vielfältig und werden durch steigende Mobilität bzw. globale Vernetzung begünstigt: Über internationalen Handel und damit verbundene Transportwege können Spezies über weite Entfernungen verschleppt werden und in neuen Regionen zum Teil gravierende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, aber auch auf die Gesundheit von Menschen und Nutztieren haben sowie hohe wirtschaftliche Schäden verursachen. <br />Nur ein verhältnismäßig geringer Teil der gebietsfremden Arten hat negative Folgen und wird als invasiv eingestuft. Invasive Neobiota zählen unter anderem durch die Verdrängung einheimischer Arten und Konkurrenzdruck, strukturelle Veränderungen von Lebensräumen und die Veränderung von Beziehungen zwischen Arten zu den wichtigsten Faktoren für den Verlust von Biodiversität.</p>
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Login
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Registrieren
<p class="article-intro">Neben direkten Effekten wie Hitze und der Zunahme von Extremwetterereignissen sind mit dem Klimawandel auch indirekte Folgen für unsere Gesundheit verbunden: Veränderte Umweltbedingungen – insbesondere steigende Temperaturen – können die Ausbreitung gebietsfremder gesundheitsrelevanter Organismen begünstigen. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus aus Public-Health-Sicht?</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Der mit dem Klimawandel einhergehende Temperaturanstieg begünstigt die Ansiedelung und Ausbreitung gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten.</li> <li>Diese bringen Risiken für die Gesundheit mit sich, etwa Infektionen und bisher unbekannte Allergene.</li> <li>Es ist notwendig, verstärkt präventive Maßnahmen zu setzen, um der Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten entgegenzuwirken, dazu zählen auch Schutz und Förderung heimischer Biodiversität.</li> </ul> </div> <p>Dengue, Chikungunya und West-Nil- Fieber – exotisch klingende Krankheiten, die eher an tropische Gebiete denken lassen. Sie verbindet ein gemeinsamer potenzieller Vektor: Aedes albopictus (Abb. 1), auch als Asiatische Tigermücke bekannt und in den letzten Jahren vermehrt in den Schlagzeilen heimischer Medien zu finden. <br />Die ursprünglich aus den asiatischen Tropen und Subtropen stammende Art ist ein prominenter Vertreter gesundheitsrelevanter „Aliens“ bzw. „Neobiota“. Unter diesen Begriffen werden ganz allgemein gebietsfremde Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie Mikroorganismen verstanden, die seit 1492 unter Mitwirkung des Menschen absichtlich oder unabsichtlich in ein neues Gebiet gelangen. Die Ausbreitungswege sind dabei vielfältig und werden durch steigende Mobilität bzw. globale Vernetzung begünstigt: Über internationalen Handel und damit verbundene Transportwege können Spezies über weite Entfernungen verschleppt werden und in neuen Regionen zum Teil gravierende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, aber auch auf die Gesundheit von Menschen und Nutztieren haben sowie hohe wirtschaftliche Schäden verursachen. <br />Nur ein verhältnismäßig geringer Teil der gebietsfremden Arten hat negative Folgen und wird als invasiv eingestuft. Invasive Neobiota zählen unter anderem durch die Verdrängung einheimischer Arten und Konkurrenzdruck, strukturelle Veränderungen von Lebensräumen und die Veränderung von Beziehungen zwischen Arten zu den wichtigsten Faktoren für den Verlust von Biodiversität.</p> <h2>Neobiota als „Gewinner“ des Klimawandels</h2> <p>Durch den Klimawandel ist von einer Zunahme auch gesundheitsrelevanter Neobiota auszugehen. Es wird erwartet, dass Etablierung und Ausbreitung bei steigenden Temperaturen häufiger, großflächiger und schneller ablaufen. Kritische Phasen der Entwicklungszyklen vieler Arten können entscheidend verlängert werden, wodurch Ausbreitungspotenzial und Konkurrenzfähigkeit zunehmen. Vor diesem Hintergrund rücken potenzielle Gesundheitseffekte von Neobiota und daran geknüpfte Herausforderungen für das Gesundheitssystem vermehrt in den Fokus. <br />So widmete sich etwa das interdisziplinäre Klimafonds-Forschungsprojekt „Aliens_Health“, unter Zusammenarbeit von Umweltbundesamt, MedUni Wien und der Bangor University (Wales), unter anderem der Analyse und Zusammenfassung des aktuellen Wissensstandes zu Gesundheitsauswirkungen gebietsfremder Arten.<sup>1</sup> Es zeigte sich, dass in Österreich die gesundheitliche Bedeutung von Neobiota vor allem im Auftreten von Infektionskrankheiten und Allergien liegt.</p> <h2>Stechmücken und Zecken wichtigste Vektoren</h2> <p>Als Krankheitsvektoren haben Stechmücken und Zecken die höchste Relevanz. Neben der Tigermücke kommt in Österreich unter anderem auch die Asiatische Buschmücke (Aedes japonicus) vor. Trotz ihrer Vektorkompetenz für zahlreiche eingangs erwähnte Krankheitserreger ist das Gesundheitsrisiko, das von der Tigermücke ausgeht, derzeit in Österreich gering, da sie aktuell noch keine stabilen Populationen bildet. Bisher gibt es hierzulande noch keine gesicherten Fälle von Erkrankungen, die auf eine Übertragung durch die Tigermücke zurückgehen.<sup>2</sup> Umso wichtiger sind daher Präventionsmaßnahmen, um einer Etablierung und weiteren Ausbreitung entgegenzuwirken. Seit 2011 wird durch die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) ein „Stechmückenmonitoring“ zur Verbesserung des Informationsstandes hinsichtlich mit dem Klimawandel assoziierter Ausbreitung und Ansiedlung „exotischer“ Stechmücken durchgeführt. <br />Auch bei heimischen Vektoren wie dem Gemeinen Holzbock (Ixodes ricinus), der bei uns häufigsten Zeckenart, zeigen sich bereits Änderungen in den Verbreitungsgebieten, etwa ein Vordringen in höhere Lagen. Im Oktober 2018 wurde zudem erstmals die subtropische Zeckenart Hyalomma marginatum in Österreich nachgewiesen, sie ist unter anderem Überträger des Krim- Kongo-Fieber-Virus und human-relevanter Bakterien wie Rickettsia aeschlimannii. Letztere wurde auch in der in Österreich gefundenen adulten Zecke nachgewiesen. Die Entwicklung bis zum Adultstadium in an sich für diese Jagdzecke klimatisch ungeeigneten Gebieten wird auf den überdurchschnittlich warmen Sommer 2018 zurückgeführt. Mit der Erderwärmung wird zudem eine Zunahme von Sandmücken (Phlebotomus spp.) erwartet. Diese kommen in Österreich autochthon vor und sind zum Beispiel Überträger von Leishmanien – protozoischen Krankheitserregern, die insbesondere aus dem Mittelmeerraum zu uns eingeschleppt werden. Auch in diesem Fall ist das gegenwärtige Infektionsrisiko für die Bevölkerung noch gering. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass 20 Erkrankungen pro Jahr in Deutschland auftreten, praktisch alle eingeschleppt.<sup>3</sup> <br />Die Beispiele verdeutlichen: Vektoren, Wirte und Krankheitserreger stehen in komplexer Relation zueinander. Sowohl gebietsfremde als auch autochthone Arten können dabei eine Rolle spielen. Klimawandel und menschliche Eingriffe (z. B. Habitatveränderungen), deren Effekte mit großen Unsicherheiten behaftet sind, beeinflussen diese Beziehungen, was genaue Abschätzungen zukünftiger Entwicklungen erschwert.</p> <h2>Zusätzliche Belastung für Allergiker</h2> <p>Unter den gebietsfremden Pflanzenarten (Neophyten) ist das aus Nordamerika stammende Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) mit seinen hochallergenen Pollen in großen Mengen die derzeit bei uns gesundheitlich relevanteste Art. Zusätzlich belastend für Allergiker: Die bei uns weit verbreitete Art führt durch ihre späte Blüte bis in den Oktober zur Spätsommer-Allergorhinokonjunktivitis („Herbstheuschnupfen“) und einer Verlängerung der Pollensaison. Konsequente Umsetzung wissenschaftlich fundierter, umfassender Managementmaßnahmen könnte auch bei dieser etablierten Art Erfolge in der Bekämpfung erzielen und eine bedeutende Reduktion von Gesundheitskosten erwirken.<sup>4</sup> <br />Anders gelagert sind die Gesundheitseffekte des in Österreich ebenfalls etablierten und aus dem Kaukasus stammenden invasiven Riesenbärenklaus (Heracleum mantegazzianum): Die im Pflanzensaft enthaltenen phototoxischen Furanocumarine können bei Hautkontakt in Kombination mit Sonneneinstrahlung schwere Hautekzeme mit Blasenbildungen verursachen.</p> <h2>Biologische Vielfalt als Prävention</h2> <p>Die Zahl gebietsfremder gesundheitsrelevanter Arten wird zunehmen; dies erfordert ein Vorantreiben des präventiven Managements. Verstärktes Monitoring mit geeigneten Screenings und Nachweismethoden, Datenerhebungen zu Fallzahlen für zielgerichtete Maßnahmen und Risikoabschätzungen sind dafür ebenso erforderlich wie eine Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ökologie und Medizin, um den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu verbessern. Durch Identifizierung gemeinsamer Anliegen von Ökologie und Gesundheitsschutz kann der Kommunikation und Argumentation des Themas mehr Gewicht verliehen werden. Für die wirksame Umsetzung von Strategien braucht es zudem eine verbesserte Koordination sowie eine starke Einbeziehung der Öffentlichkeit. <br />Fundament aller Anstrengungen sollte jedoch der Erhalt intakter Ökosysteme sein: Diese wirken – neben der Bereitstellung einer Vielzahl weiterer für unsere Gesundheit essenzieller, „kostenloser“ Ökosystemleistungen – auch regulierend hinsichtlich biologischer Invasionen. Der gegenwärtig massive Biodiversitätsverlust stellt daher eine Gefahr für unsere Gesundheit dar, inklusive der damit verbundenen Kosten für das Gesundheitssystem. Damit kommt dem Schutz bzw. der Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme als Gesundheitsvorsorge grundlegende, auch wirtschaftliche Bedeutung zu. Statt Umweltanliegen laufend gegen wirtschaftliche Argumente auszuspielen, sollte dem Nutzen biologischer Vielfalt als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage entsprechender politischer Stellenwert beigemessen werden – mit Umsetzungswillen für wirksame Maßnahmen, zu denen auch der Klimaschutz zählt.</p> <h2>Schlussfolgerungen</h2> <p>Aufgrund des Temperaturanstiegs als Folge der Erderwärmung ist eine Verstärkung der Dynamik in Bezug auf die Verbreitung invasiver Neobiota in Österreich zu erwarten. Um dem Trend entgegenzuwirken, sind umfangreiche Maßnahmenpakete umzusetzen. <br />Monitoring und Abwehr von Infektionskrankheiten, speziell von vektorübertragenen Krankheiten, waren immer eine Kernaufgabe des öffentlichen Gesundheitswesens. Die bisherigen Anstrengungen zur Überwachung sind fortzusetzen und permanent an das sich ändernde Krankheitsspektrum zu adaptieren. Die verschiedenen Anpassungsmaßnahmen z. B. zur Verbesserung von Früherkennung, Diagnose und Therapie von „new and emerging diseases“, finden sich in der österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Schindler S et al.: Aliens_Health. Final Project Report for the Austrian Climate Research Program (ACRP). Umweltbundesamt; Wien 2017 <strong>2</strong> AGES: Tigermücke und von ihr übertragene Krankheiten. Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Wien 2018 <strong>3</strong> Robert-Koch-Institut: Leishmaniose (2018). www.rki.de/DE/Content/InfAZ/L/Leishmaniose/Leishmaniose.html (Zugriff am 5. 4. 2019) <strong>4</strong> Richter R et al.: Spread of invasive ragweed: climate change, management and how to reduce allergy costs. J Appl Ecol 2013; 50: 1422-30</p>
</div>
</p>