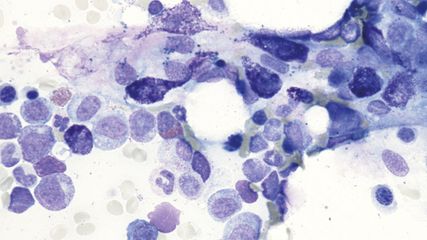Single-Port da Vinci – der nächste Entwicklungsschritt?
Autor:innen:
Dr. Katharina Oberneder
Univ.-Prof. Dr. Mesut Remzi
Abteilung für Urologie
Comprehensive Cancer Center CCC
Medizinische Universität Wien
Korrespondenz:
In den letzten zwei Jahrzehnten ist das Interesse an minimalinvasiven Techniken in der Urologie stark gestiegen und in vielen Bereichen „State of the Art“ geworden. Die neueste Innovation in diesem Bereich ist das da Vinci Single-Port(SP)-System. Während das Konzept der Single-Site-Chirurgie bereits vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführt wurde und die kosmetischen Vorteile der laparoendoskopischen Single-Site-Chirurgie (LESS) in mehreren Studien belegt sind, konnte sich LESS aufgrund ergonomischer Herausforderungen, wie der fehlenden optimalen Instrumententriangulation und eingeschränkten Bewegungsfreiheit, nicht durchsetzen.1,2
Innovationen der Single-Port-Chirurgie
Im Jahr 2018 erhielt das da Vinci SP-System die FDA-Zulassung für den klinischen Einsatz.3 Es ist die vierte Generation der da-Vinci-Roboterplattform und folgt auf die Modelle S, Si und Xi.4 Ähnlich wie in früheren Generationen kann der Chirurg eine Kamera sowie drei Instrumente gleichzeitig steuern (Abb.1). Der entscheidende Unterschied des SP-Systems besteht darin, dass alle Instrumente in einer einzigen Kanüle mit 2,5cm Durchmesser untergebracht sind. Sie sind innerhalb der Kanüle in 12-, 3-, 6- und 9-Uhr-Position angeordnet. Die chirurgischen Instrumente haben einen Durchmesser von 6mm, während das Endoskop 8mm misst. Sowohl die Instrumente als auch das Endoskop verfügen über bewegliche Gelenke („Ellbogen“ und „EndoWrist“), die eine größere Bewegungsfreiheit im Körper ermöglichen.4
Während der Chirurg weiterhin jedes Instrument einzeln steuern kann, bietet das SP-System zusätzliche Funktionen wie eine Kameraneigung von bis zu 30° sowie die Möglichkeit, alle Instrumente simultan über ein Fußpedal zu bewegen. Eine Herausforderung des SP-Systems ist die enge Anordnung der Instrumente, wodurch die räumliche Orientierung erschwert wird. Ein Vorteil ist jedoch die flexible Steuerung der Kamera, die die Visualisierung verbessert, indem sie eine noch nähere und detailliertere Ansicht der anatomischen Strukturen bietet.
Ein weiterer entscheidender Vorteil der SP-Technologie ist der kleine operative Footprint, der es ermöglicht, auch in engen anatomischen Bereichen zu operieren. Die 360°-Bewegungsfreiheit der Instrumente erlaubt eine präzisere Dissektion, ohne dass es zu externen Kollisionen mit den Armen des Roboters kommt. Gleichzeitig vereinfacht der SP-Ansatz die Lagerung der Patient:innen, da sie in Rückenlage oder minimaler Trendelenburg-Lage gelagert werden können, ohne dass die für den transperitonealen Zugang übliche steile Trendelenburg-Lage erforderlich ist.5,6
Welche Anpassungen sind beim Umstieg von MP auf SP zu erwarten?
Die Kameraführung ist viel näher am Organ, sodass primär nur kleinere Räume abgedeckt werden können. Ein Wechsel der Perspektive erfolgt über den gleichzeitigen Wechsel aller Instrumente. Die Kamerapositionen innerhalb des Ports müssen je nach Eingriff angepasst werden.7 Durch die enge Anordnung der Instrumente kann es zu einer größeren gegenseitigen Interaktion kommen, weshalb eine angepasste Steuerung und viel Erfahrung erforderlich sind. Gleichzeitig können alle Instrumente um 360° rotiert werden, was eine präzisere Manipulation ermöglicht.7
Die Spitze der Instrumente weist weniger Freiheitsgrade auf und ähnelt in dieser Hinsicht wieder der klassischen Laparoskopie. Dies erfordert eine Umstellung in der Handhabung, besonders im Vergleich zu den bisherigen MP-Techniken. Zudem ist der Zugang über spezielle Port-Systeme (Access Port) notwendig, was eine weitere Anpassung in der OP-Planung und Durchführung bedingt.8 Der intraoperative Wechsel von Instrumenten ist komplexer und benötigt eine exakte Planung.8 Darüber hinaus erfordert die neue Ergonomie für den Chirurgen eine Umstellung in der Steuerung der Instrumente und der Handhabung der Bedienelemente.
Lernkurve und chirurgische Effizienz
Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Einführung der SP-Technologie ist das Verständnis der Lernkurve. In einer retrospektiven Analyse von 387 aufeinanderfolgenden SP-Operationen eines erfahrenen Chirurgen zwischen 2018 und 2023 zeigte sich, dass sowohl die allgemeine chirurgische Erfahrung als auch die eingriffsspezifische Routine mit einer geringeren Komplikationsrate assoziiert waren.9 Die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen sank mit zunehmender Fallzahl, wobei sich die minimale Komplikationsrate nach etwa 30 SP-roboterassistierten einfachen Prostatektomien (RASP), 70 SP-roboterassistierten Nephrektomien (RANP) und 150 SP-roboterassistierten radikalen Prostatektomien (RARP) einstellte. Zudem war eine höhere spezifische Erfahrung mit einer signifikant verkürzten Operationszeit verbunden. Die Studie hebt hervor, dass sich renale Eingriffe und SP-RASP durch eine schnellere Lernkurve auszeichnen, während SP-RARP erst nach ausreichender Erfahrung mit der Plattform durchgeführt werden sollten.
Das SP-System in der Prostatachirurgie
Ein entscheidender Vorteil des SP-Systems ist die Möglichkeit, die Zielanatomie direkt zu erreichen, vor allem durch alternative Zugangswege. Der transperitoneale Zugang, der in der Multiport(MP)-roboterassistierten Chirurgie am häufigsten verwendet wird, bietet eine gute Übersicht und ausreichend Platz für die Instrumentenmanipulation. Allerdings besteht dabei ein erhöhtes Risiko für intraperitoneale Adhäsionen und potenzielle Organverletzungen. Um diese Nachteile zu umgehen, wurde in den letzten Jahren verstärkt der extraperitoneale Zugang untersucht.
In einer retrospektiven Studie wurden die Ergebnisse der SP-RARP mit der MP-RARP verglichen.10 Insgesamt wurden 925 Patienten von einem erfahrenen Chirurgen operiert, wobei 485 SP- und 121 MP-Fälle analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die SP-Gruppe eine längere Operationszeit hatte (durchschnittlich 198,9 vs. 181,5 Minuten in der MP-Gruppe, p<0,001). Jedoch profitierte die SP-Gruppe von einem geringeren intraoperativen Blutverlust (125,1ml vs. 215,9ml), einer kürzeren Krankenhausaufenthaltsdauer (12,6 vs. 31,9 Stunden) und einem reduzierten Bedarf an postoperativen Opioiden bei Entlassung (14,4% vs. 85,1%). Zudem konnte der Katheter in der SP-Gruppe früher entfernt werden (6 vs. 8 Tage in der MP-Gruppe). Bezüglich der onkologischen Ergebnisse, einschließlich der Rate positiver Resektionsränder, sowie der funktionellen Ergebnisse, wie Kontinenz- und Potenzraten, zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.10 Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die extraperitoneale SP RARP eine effektive Alternative zur transperitonealen MP-RARP darstellt, mit Vorteilen in Bezug auf geringere Morbidität und eine schnellere postoperative Erholung.
Auch in der Behandlung der benignen Prostatahyperplasie hat die SP-Chirurgie Vorteile gezeigt. Der transvesikale Zugang ermöglicht einen direkten Zugang zur Prostata, während das Peritoneum umgangen wird. In einer retrospektiven Studie wurden 50 transvesikale SP-RASP mit 90 Holmium-Laser-Enukleationen der Prostata (HoLEP) bei Patienten mit einem präoperativen Prostatavolumen von über 80cm3 verglichen.11 Die Ergebnisse zeigen, dass kein signifikanter Unterschied im Anteil des entfernten Adenoms bestand (57% vs. 51%, p=0,10). SP-RASP-Patienten wurden signifikant häufiger am selben Tag entlassen (48% vs. 8%, p<0,01), wiesen jedoch eine längere Katheterverweildauer auf (6 vs. 1 Tag, p<0,01). Auffällig war, dass transiente De-novo-Inkontinenz bei HoLEP-Patienten häufiger vorkam (28% vs. 5%, p<0,01).
Auch die Thulium-Laser-Enukleation der Prostata (ThuLEP) wurde in einer retrospektiven Studie mit der SP-RASP verglichen (33 SP-RASP, 69 ThuLEP). Beide Verfahren führten zu einer ähnlichen Verbesserung des International Prostate Symptom Score (−17 vs. −14, p=0,296). SP-RASP hatte eine längere Operationszeit (180 vs. 90 min, p<0,0001), jedoch traten keine Fälle von postoperativer Stressinkontinenz auf, während diese bei 19% der ThuLEP-Patienten vorkam (p=0,008). Krankenhausverweildauer, Postmiktionsresidualvolumen und Komplikationsrate unterschieden sich nicht signifikant.
Die hohen Raten an Inkontinenten bei den Enukleationsverfahren überraschen sehr und es bleibt unklar, wie viel Lernkurve in diesen Daten versteckt ist. Es scheint aber so zu sein, dass die Lernkurve mit dem SP hier kürzer ist als die bei Enukleationsverfahren, vor allem in Bezug auf postoperative Inkontinenz.
Nierenchirurgie mit dem SP-System
Die erste roboterassistierte laparoendoskopische radikale Single-Site-Nephrektomie (R-LESS RN) wurde 2008 von Kaouk et al. durchgeführt.12 Eine retrospektive Analyse von 10 R-LESS RN im Vergleich zu 10 konventionellen Laparoskopiefällen zeigte keine Unterschiede hinsichtlich der medianen Operationszeit, des Blutverlusts oder der Komplikationsrate.13 Die R-LESS-Gruppe hatte einen geringeren medianen Schmerzmittelbedarf bei der Krankenhausaufnahme (25,3 vs. 37,5 Morphinäquivalente; p=0,049) und eine kürzere Aufenthaltsdauer (2,5 vs. 3,0 Tage; p=0,03).
In den frühen Jahren wurde R-LESS-Nierenteilresektion (PN) aufgrund der technischen Einschränkungen nur selten durchgeführt. Herausforderungen wie eine fehlende Triangulation, Kollision der Instrumente und eingeschränkte Bewegungsfreiheit erschwerten die Durchführung.14 Mit dem Fortschritt der Technologie hat sich auch die Anwendung der R-LESS-PN weiterverbreitet. Dabei zeigen Studien, dass Patienten in der SP-Gruppe häufiger über einen retroperitonealen Zugang operiert wurden (81% vs. 19%) anstatt transperitoneal.15 Komninos et al. verglichen 89 Patient:innen, die mit RPN behandelt wurden, mit 78, die mit R-LESS-PN behandelt wurden.16 In dieser Studie wurde als primärer Endpunkt das sogenannte Trifecta (Warm-Ischämiezeit ≤20 Minuten, negative Schnittränder und keine chirurgischen Komplikationen) definiert. Dieses Ziel wurde nur bei 25,6% der R-LESS-Patient:innen im Vergleich zu 42,7% der MP-Patient:innen erreicht. Zudem hatten Patient:innen in der R-LESS-Gruppe eine signifikant längere Operationszeit, Ischämiezeit und einen stärkeren Rückgang der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR). Es wurden keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in Bezug auf die Dauer des Krankenhausaufenthalts, den Blutverlust, die postoperative eGFR, positive Operationsränder und chirurgische Komplikationen festgestellt.
Ebenso zeigte eine Studie aus 2014 keine Unterschiede zwischen R-LESS- und MP-PN hinsichtlich der Dauer des Krankenhausaufenthalts, des Blutverlusts, der postoperativen eGFR, der positiven Resektionsränder oder der chirurgischen Komplikationen. Allerdings hatten R-LESS-Patient:innen signifikant geringere postoperative Schmerzen.17 In einer „Propensity-score matched“-Analyse wurde gezeigt, dass SP-Patient:innen eine reduzierte Opioidnutzung und eine kürzere kumulative Krankenhausverweildauer im Vergleich zur MP-Kohorte hatten.18 Auch hier zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich Operationszeit, Blutverlust, Ischämiezeit oder positiver Resektionsränder.
Fazit
Die SP-Chirurgie mit dem da Vinci SP-System bietet zahlreiche Vorteile, befindet sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit der Regionalisierung der Chirurgie: Durch alternative Zugangswege wie den retroperitonealen oder transvesikalen Zugang werden neue operative Optionen eröffnet und hierin ist der Vorteil für die Patient:innen begründet. Dies äußert sich durch eine schnellere komplette Rekonvaleszenz und geringere postoperative Schmerzen. Diese Art von Chirurgie ermöglich uns, das Konzept von größeren tageschirugischen Eingriffen weiter zu verfolgen. Besonders wichtig für die Entwicklung sind die Rahmenbedingungen. Diese werden sich aber auch in Österreich durch die Ressourcenverknappung in diese Richtung weiterbewegen.
Trotz dieser Vorteile ist die SP-Technologie bislang keine vollständige Alternative zur Multiport-Technik, sondern ergänzt das bestehende Portfolio der Roboterchirurgie. Eine wesentliche Herausforderung bleibt die Lernkurve für die Operateur:innen, vor allem im Hinblick auf den optimalen Zugang, die Kameraführung und die Nutzung der Instrumente.
Literatur:
1 Kaouk JH et al.: Laparoendoscopic single-site surgery in urology: worldwide multi-institutional analysis of 1076 cases. Eur Urol 2011; 60(5): 998-1005 2 Irwin BH et al.: Complications and conversions of upper tract urological laparoendoscopic single-site surgery (LESS): multicentre experience: results from the NOTES Working Group. BJU Int 2011; 107(8): 1284-9 3 Billah MS.: et al.: Single port robotic assisted reconstructive urologic surgery-with the da Vinci SP surgical system. Transl Androl Urol; 2020; 9(2): 870-8 4 Dobbs RW et al.: Single-port robotic surgery: the next generation of minimally invasive urology. World J Urol 2020; 38(4): 897-905 5 Covas Moschovas M et al.: Technical modifications necessary to implement the da Vinci single-port robotic system. Eur Urol 2020; 78(3): 415-23 6 Sobhani S, Hemal S: Single-port extra-peritoneal robotic radical prostatectomy in a patient with hostile abdomen. Indian J Urol 2024; 40(4): 279-80 7 Da Vinci SP [cited 2025; Available from: www.intuitive.com/de-de/products-and-services/da-vinci/sp 8 Lai A et al.: Single-port robotic surgery: general principles and troubleshooting. J Endourol 2022; 36(S2): S25-8 9 Pellegrino AA et al.: Learning curve for single-port robot-assisted urological surgery: single-center experience and implications for adoption. Eur Urol Focus 2024; S2405-4569(24)00172-X 10 Chavali JS et al.: Single-port extraperitoneal vs. multiport transperitoneal robot-assisted radical prostatectomy: a propensity score-matched analysis. Cancers (Basel) 16(17): 2994 11 Palacios DA et al.: Holmium laser enucleation of the prostate vs transvesical single-port robotic simple prostatectomy for large prostatic glands. Urology 2023; 181: 98-104 12 Kaouk JH et al.: Robotic single-port transumbilical surgery in humans: initial report. BJU Int 2009; 103(3): 366-9 13 White MA et al.: Robotic laparoendoscopic single-site radical nephrectomy: surgical technique and comparative outcomes. Eur Urol 2011; 59(5): 815-22 14 Nguyen TT et al.: Single-port robotic applications in urology. J Endourol 2023; 37(6): 688-99 15 Glaser ZA et al.: Single- versus multi-port robotic partial nephrectomy: a comparative analysis of perioperative outcomes and analgesic requirements. J Robot Surg 2022; 16(3): 695-703 16 Komninos C et al.: R-LESS partial nephrectomy trifecta outcome is inferior to multiport robotic partial nephrectomy: comparative analysis. Eur Urol 2014; 66(3): 512-7 17 Shin TY et al.: Laparoendoscopic single-site (LESS) robot-assisted partial nephrectomy (RAPN) reduces postoperative wound pain without a rise in complication rates. BJU Int 2014; 114(4): 555-61 18 Harrison R et al.: Single-port versus multiport partial nephrectomy: a propensity-score-matched comparison of perioperative and short-term outcomes. J Robot Surg 2023; 17(1): 223-31
Das könnte Sie auch interessieren:
Hautmanifestationen bei onkologischen Erkrankungen
Krebserkrankungen verschiedener Organsysteme können auch mit Symptomen an der Haut einhergehen, die manchmal bereits als frühe Warnzeichen auftreten. Dazu zählt ausgeprägter Pruritus. ...
Kutane oder systemische Mastozytose – was macht die Hämatologie?
Mastzellerkrankungen sind eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, die von einer Vielzahl zugrunde liegender genetischer Veränderungen und Komorbiditäten beeinflusst werden und in ihrem ...
Neues zur GVHD-Prophylaxe und Risikobewertung bei Myelofibrose
Die Prophylaxe der Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) bleibt eine zentrale Herausforderung nach allogener Stammzelltransplantation. Auf dem diesjährigen EBMT-Kongress wurden dazu neue ...