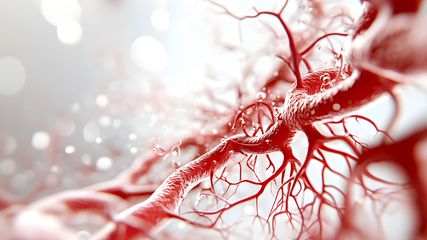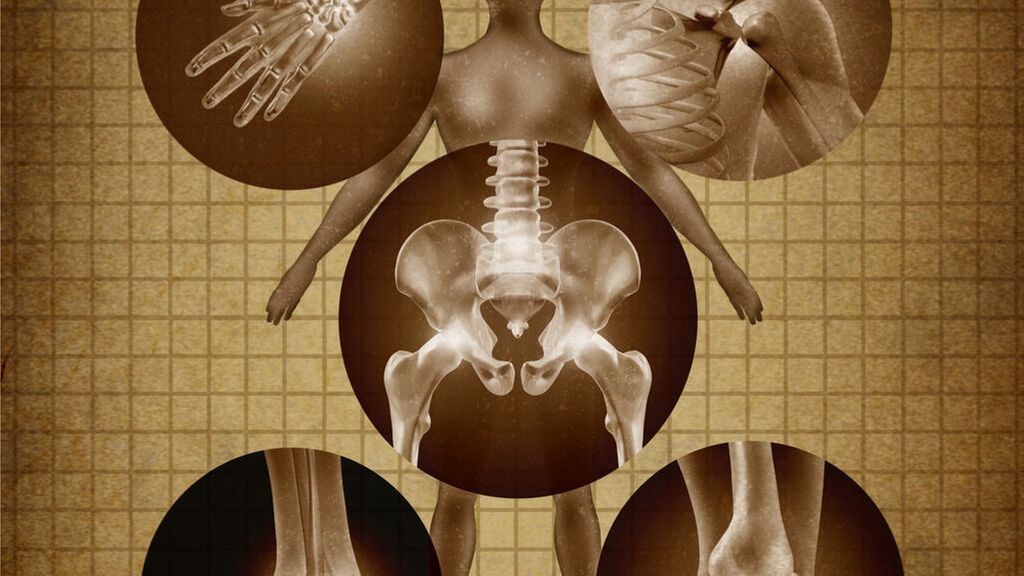
Nötige und unnötige Operationen an Schulter und Ellbogen
Leading Opinions
Autor:
PD Dr. med. Patrick Vavken
alphaclinic Zürich, CH<br/> ADUS Klinik, Dielsdorf, CH<br/> Harvard Medical School, Boston, USA<br/> E-Mail: vavken@alphaclinic.ch
30
Min. Lesezeit
16.05.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die zunehmende Forschungstätigkeit zur Effektivität verschiedener Therapieformen für Schulter und Ellbogen hat operative und konservative Behandlungen mehr und mehr gegeneinander gestellt, obwohl diese sich ergänzen und nicht miteinander konkurrieren sollen. Trotzdem hat die rezente Forschung neue Anhaltspunkte entwickelt, wann welche Therapie nötig ist und wann weniger – angepasst an die individuelle Situation.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe von <em>LEADING OPINIONS Orthopädie & Rheumatologie</em> ist für Ärzte und Patienten gleichermassen emotional besetzt, deswegen ist eine persönliche Einleitung vielleicht besser geeignet als kalte Fakten. Als Student habe ich ein Sub-internship, natürlich für Orthopädie, an einer US-amerikanischen Universität gemacht. Dort habe ich die T-Shirts der «surgical interest group» gesehen, die mit dem Slogan «heal with steel» bedruckt waren. Bis heute empfinde ich diesen Satz als gute Zusammenfassung meiner chirurgischen Motivation, nämlich Krankheiten zu heilen, aber mit chirurgischem Stahl, wo andere Tabletten, Infusionen, Bestrahlung etc. benutzen.<br /> Heilen mit Stahl hat eine lange Tradition, und als Chirurg wird man durch das Investment vieler Jahre und langer Ausbildung Teil dieser Tradition. Wir lernen theoretisch und sehen praktisch, was funktioniert. In der Psychologie gibt es den Terminus «Funktionslust» oder «Wirksamkeitsmotivation », und ich denke, die meisten Chirurgen leiden darunter. Aber wo steckt die «Wirksamkeit» in der zunehmend komplexeren Welt der Chirurgie, bestehend aus vermehrt biologisch unterstützten Eingriffen, aufwendiger peri- und postoperativer Medikation und Schmerztherapie und detaillierten Nachbehandlungsschemen, geprägt von Ruhephasen, intensiver Therapie und guten Vorsätzen, in Zukunft gesünder zu leben und besser auf sich aufzupassen? Es ist wahrscheinlich vermessen, anzunehmen, dass der Therapieerfolg lediglich auf der Operation beruht, aber wäre es deswegen ohne Eingriff auch so gut gekommen?<br /> Genau hier setzten nun viele wissenschaftliche Studien an, die z. B. zeigen, dass Kniespiegelungen keinen Einfluss auf das lang- und mittelfristige Ergebnis bei Arthrose haben. Die Wissenschaft ist dabei wertfrei und kann nur zum Ausdruck bringen, dass ein bestimmter Messwert zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen verschiedenen Gruppen im Wesentlichen nicht unterschiedlich ist. Was gemessen wird, wie gemessen wird, wie gross ein Unterschied sein soll/ darf und wie man zum Messzeitpunkt kommt, ist für die Methodologie der Statistik unwesentlich, aber für den Patienten oft entscheidend. In diesem Graubereich findet sich viel Spielraum für eine Argumentation entsprechend der persönlichen Motivation, sei es Leistungen zu kürzen, um Kosten zu sparen, Leistungen auszudehnen, um Mindestfallzahlen zu erreichen oder mehr zu verdienen, oder, oder … Dabei geht leider zusehends verloren, dass konservative und operative Therapien sich eigentlich ergänzen und nicht miteinander konkurrieren.</p> <h2>Konservativ oder Operation: Schulter</h2> <p>Die häufigste Schulteroperation weltweit ist immer noch die subakromiale Dekompression bzw. die Schulterdacherweiterung. Es wird angenommen, dass z. B. in den USA knapp eine halbe Million dieser Eingriffe jährlich vorgenommen wird. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass diese Operation als erste unter den Schultereingriffen näher erforscht wurde. Bereits 2007 publizierte die Cochrane Collaboration, ein Pro-bono-Forschungsnetzwerk mit 13 000 Mitgliedern aus 130 Ländern, Daten, die zeigten, dass dieser Eingriff im Vergleich zu Placebo oder Physiotherapie keine besseren Ergebnisse bezüglich Schmerzerleichterung, Funktion und Lebensqualität erbringt. 2017 publizierte «The Lancet» Daten aus einer englischen Multicenterstudie (32 Krankenhäuser, 51 Chirurgen, 313 Patienten), welche die Ergebnisse der Cochrane- Studie weiter untermauerten.<br /> Für das Schulterimpingement gibt es damit eine klare wissenschaftliche Empfehlung zur konservativen Behandlung und gegen die Schulterdacherweiterung bzw. subakromiale Dekompression.</p> <p>Die nächste Eskalationsstufe der Pathologie der Schulter ist die degenerative Ruptur der Rotatorenmanschette. Hier gibt es ein differenzierteres Bild als beim Impingement. Da sich die degenerative Rotatorenmanschettenruptur über Jahre entwickelt, können sich Kompensationsmechanismen einstellen. Es wird diskutiert, ob das schliessliche Auftreten von Schmerzen eine Folge der zunehmenden Ruptur oder der abnehmenden Kompensation ist. Ähnlich wie bei der degenerativen Meniskusruptur gibt es hier Daten, die zeigen, dass ein konservativer Therapieversuch eine ausgezeichnete Funktion und Schmerzreduktion erreichen kann. Zugleich gibt es aber auch Daten, dass diese substanzielle Verbesserung im Zeitraum von 3 Monaten, bzw. für den Subscapularis sogar in nur 2 Monaten, stattfinden muss, sofern sie möglich ist. Patienten, die über diesen Zeithorizont hinaus wesentliche Beschwerden haben, müssen mit einer dauerhaften Verschlechterung rechnen, auch wenn später doch operiert wird – wiederum wie beim degenerativen Meniskusriss. Es ist in diesem Zusammenhang auch sehr interessant, dass aktuelle Studien zeigen, dass Kortikosteroide einen anhaltenden negativen Effekt auf die Rotatorenmanschette haben. So haben Patienten mit zwei oder mehr Kortisoninfiltrationen vor ihrer Manschettennaht ein dreifach höheres Risiko für ein späteres Therapieversagen bzw. eine operative Revision. Es handelt sich hier also um eine «unnötige» konservative Behandlung, wobei «unnötig» hier sowohl mangelnde Nachhaltigkeit als auch vermehrtes Risiko für spätere Komplikationen umfasst.<br /> Für die degenerative Rotatorenmanschettenruptur gibt es damit eine klare wissenschaftliche Empfehlung der konservativen Behandlung initial, aber bei ausbleibendem Erfolg des Wechsels zur Operation nach 2–3 Monaten und der Vermeidung von mehr als zwei Kortisoninfiltrationen.</p> <p>Eine besondere Gruppe unter den Rotatorenmanschettenrupturen sind die massiven Rupturen, bei denen 2 oder mehr der 4 Sehnen oder mehr als 5 cm der Rotatorenmanschette gerissen sind. Diese Rupturen zeigen oft einen hohen Grad an Retraktion und Atrophie der betroffenen Sehnen. Dementsprechend ist die Überlegung, eine inverse Prothese einzusetzen, anstatt die Sehnen zu refixieren, naheliegend. Für Massenrupturen der Rotatorenmanschette zeigen relevante Studien den Trend, dass die primäre, arthroskopische (Teil-)Refixation der Sehnen mit sekundärer Revision zur inversen Prothese bei Bedarf die effektivste Strategie ist.<br /> In der Welt der Rotatorenmanschettennaht gibt es aber auch Neuigkeiten, die die Notwendigkeiten in der postoperativen Therapie betreffen. So hat eine aktuelle Studie aus der Schweiz, publiziert im «JBJS », 2 Gruppen von Patienten verglichen, die nach der Naht von Manschettendefekten bis 3 cm entweder eine Schulterschlinge trugen oder in keiner Form immobilisiert waren und die Schulter sofort ab der Operation frei beüben durften. Die Studie hat für die Gruppe ohne Schlinge eine schnellere Mobilität, weniger Schmerzen, eine bessere subjektive Zufriedenheit und keine vermehrten Komplikationen gezeigt.<br /> Diese Daten zeigen, dass für kleine und mittlere Defekte die immer noch weit verbreitete Nachbehandlung mit Abduktionskissen für 6 Wochen nicht nötig ist.</p> <p>Zuletzt hat auch die Entscheidungsfindung in der Versorgung von Frakturen des proximalen Humerus grosse wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Diese Brüche, die vermehrt bei älteren Patienten auftreten, können sowohl durch eine Verplattung als auch durch einen prothetischen Ersatz oder konservativ behandelt werden.<br /> Es hat sich dabei herauskristallisiert, dass in sehr vielen Fällen auch bei komplexen Frakturen die konservative Therapie ein sehr gutes Ergebnis erreichen kann, wobei hier sicher die altersangepassten Funktionsansprüche beachtet werden müssen. Für die Patienten, bei denen eine chirurgische Versorgung nötig ist, bietet die primäre Prothese im Vergleich zur Verplattung, ähnlich wie bei der Schenkelhalsfraktur, eine Reihe von Vorteilen.</p> <h2>Konservativ oder Operation: Ellbogen</h2> <p>Für den Ellbogen ist die Diskussion «konservativ oder operativ?» etwas komplizierter als für die Schulter. Zum einen liegt das sicherlich daran, dass Ellbogeneingriffe bei Weitem nicht so verbreitet sind wie Schulteroperationen. Zum anderen spielt beim Ellbogen in der Definition eines «nötigen» oder «unnötigen» Eingriffes die Differenzialdiagnostik eine wichtige Rolle.</p> <p>Ein nach wie vor sehr häufiger Eingriff am Ellbogen ist die Entfernung des Schleimbeutels bei Bursitis olecrani. Hierbei ist zwischen der bakteriellen infektiösen Bursitis und anderen Ursachen, wie z. B. Druck oder Überlastung, zu unterscheiden.<br /> Für die aseptische Bursitis des Ellbogens gibt es qualitativ hochwertige wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass eine chirurgische Entfernung zumeist keine Vorteile gegenüber einer konservativen Behandlungsstrategie zeigt, sehr wohl aber ein deutlich höheres Komplikationsrisiko hat.<br /> Aber auch Fälle von septischer Bursitis können mit einer adäquaten Antibiose erfolgreich konservativ behandelt werden. In Anbetracht der häufigen Wundheilungsstörungen nach der chirurgischen Entfernung des Schleimbeutels sollte dieser Eingriff nur für wahrhaft chronische Fälle reserviert bleiben. Dies stimmt umso mehr für Patienten mit Blutverdünnung oder mit Nebenerkrankungen wie Rheuma.</p> <p>Was für die Schulter das Impingement ist, ist für den Ellbogen der Tennisarm. Hierzu gibt es eine sprichwörtliche Fülle an Studien, was die Wirksamkeit der zahllosen Therapien betrifft. Ein positiver Effekt hat sich für Therapien wie Bandagen, Schnallen, Handgelenksschienen etc. nicht verlässlich reproduzieren lassen.<br /> Mehrere Metaanalysen haben gezeigt, dass beim «echten» Tennisarm sowohl die konservative als auch die operative Therapie wenig Einfluss auf die effektive Heilung haben («unnötig» sind), wobei exzentrisches Dehnen und PRP-Infiltrationen in einigen randomisierten Studien die Heilung vorangetrieben haben.</p> <p>In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass drei Viertel der Patienten mit einem «chronischen Tennisarm» (definiert als therapieresistente Schmerzen über 6 oder mehr Monate) bei genauer Diagnostik keinen Tennisarm haben, sondern unter einer anderen Diagnose leiden, allen voran unter einer Ellbogeninstabilität (vgl. <em>LEADING OPINIONS Orthopädie & Rheumatologie</em> 2018; 3: 43-6).<br /> Für den lateralen Ellbogenschmerz, der nicht auf eine «Tennisarmtherapie» anspricht, gibt es starke Evidenz, dass bei 3 von 4 Fällen eine andere Diagnose verantwortlich ist und gefunden werden muss.</p> <p>Als Maximalvariante der Ellbogeninstabilität ist auch für die Ellbogenluxation die Diskussion über nötige und unnötige Therapien von Bedeutung. Hier gibt es wieder Daten der Cochrane Collaboration wie auch anderer Forschungsgruppen. Diese identifizieren für die einfache Ellbogenluxation (Luxation unter adäquatem Trauma ohne Knochenverletzung) die konservative Therapie nicht nur als ausreichend, sondern sogar als tendenziell besser als die operative Versorgung. Parallel gibt es aber auch bereits seit den 1970ern harte Daten dazu, dass eine Ruhigstellung über 3 Wochen Dauer schnell zu einer nachhaltigen Verschlechterung aufgrund einer ernstzunehmenden Gelenkseinsteifung führt.<br /> Für die einfache Ellbogenluxation ist die konservative, zeitlich genau begrenzte konservative Therapie (< 3 Wochen Ruhigstellung) nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft das Mittel der Wahl.</p> <p>Die Radiusköpfchenfraktur wird oft als Bagatellverletzung angesehen, die von selbst heilt. Und in der Tat ist es auch so, dass die konservative Therapie für die meisten Frakturen hervorragende Ergebnisse erzielt. Rezente Studien haben aber gezeigt, dass auch bei der «harmlosen» Mason- I-Radiuskopffraktur regelmässig weitere Binnenschäden am Ellbogen auftreten. In einer Studie von 1323 Radiuskopffrakturen wurde gezeigt, dass in zwei Drittel der Fälle weitere nicht knöcherne Verletzungen vorlagen. 11 % dieser Verletzungen waren behandlungsbedürftig (Abb. 1). Neue Klassifikationssysteme, die die Pathomechanik der Verletzung besser berücksichtigen als die rein deskriptiv-radiologischen Klassifikationen, können helfen, diese Fälle leichter herauszuarbeiten (Abb. 2).<br /> Für die Radiusköpfchenfraktur zeigt die Literatur also eine konservative Therapie als oft ausreichend, aber mögliche Begleitverletzungen müssen identifiziert und behandelt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1902_Weblinks_a1-abb1.jpg" alt="" width="636" height="329" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1902_Weblinks_a1-abb2.jpg" alt="" width="633" height="443" /></p> <p>Als letztes Beispiel aus der Welt des Ellbogens zum Thema nötige und unnötige Therapie eignet sich die Osteochondrosis dissecans des Capitellums, wie sie häufig bei Kindern und Jugendlichen (Gymnasten und Wurfsportler) auftritt. Diese voranschreitende Erkrankung des Knorpels und subchondralen Knochens tritt aus bis anhin noch nicht genau identifizierten Gründen auf und kann zur kompletten Loslösung eines Teils des Gelenkknorpels führen. Nicht selten ist aber eine Rotationsstörung der Schulter, die zu einer kompensatorischen Überlastung des Ellbogens führt, mit impliziert.<br /> In frühen Phasen, solange die Gelenkoberfläche intakt und die Wachstumsfuge offen ist, ist eine konservative Therapie indiziert, die auf eine Belastungsreduktion bei erlaubter Bewegung abzielt. Ruhigstellende Massnahmen wie Schienen oder Gipse bringen keine zusätzliche Verbesserung, bergen aber die Gefahr einer Einsteifung des Ellbogens. Hier hat es die Gefahr einer Übertherapie. In späteren Phasen der Erkrankung kann sich ein Fragment lösen. In dieser Situation gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, wie ein Debridement, die Refixation des Fragments oder ein osteochondrales Autograft (OATS). Hier haben Studien die besten Ergebnisse für das osteochondrale Graft gezeigt, aber oft wird in diesen Fällen untertherapiert (Abb. 3).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1902_Weblinks_a1-abb3.jpg" alt="" width="557" height="411" /></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <ul> <li>Konservative und operative Therapien ergänzen sich und sind nicht als konkurrierende Behandlungen entwickelt worden.</li> <li>Für das Schulterimpingement gibt es eine klare wissenschaftliche Empfehlung der konservativen Behandlung und gegen die Schulterdacherweiterung bzw. subakromiale Dekompression.</li> <li>Für die degenerative Rotatorenmanschettenruptur gibt es eine klare wissenschaftliche Empfehlung der konservativen Behandlung initial, aber bei ausbleibendem Erfolg des Wechsels zur Operation nach 2–3 Monaten und der Vermeidung von mehr als zwei Kortisoninfiltrationen.</li> <li>Für Massenrupturen der Rotatorenmanschette zeigen relevanten Studien den Trend, dass die primäre, arthroskopische (Teil-)Refixation der Sehnen mit sekundärer Revision zur inversen Prothese bei Bedarf die effektivste Strategie ist.</li> <li>Mehrere Metaanalysen haben gezeigt, dass beim «echten» Tennisarm sowohl die konservative als auch die operative Therapie wenig Einfluss auf die effektive Heilung haben («unnötig» sind), wobei exzentrisches Dehnen und PRP-Infiltrationen in einigen randomisierten Studien die Heilung vorangetrieben haben.</li> <li>Für den lateralen Ellbogenschmerz, der nicht auf eine «Tennisarmtherapie» anspricht, gibt es starke Evidenz, dass bei 3 von 4 Fällen eine andere Diagnose verantwortlich ist und gefunden werden muss.</li> <li>Für die einfache Ellbogenluxation ist die konservative, zeitlich genau begrenzte konservative Therapie (< 3 Wochen Ruhigstellung) nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft das Mittel der Wahl.</li> </ul> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker
Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...
Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus
Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...
Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III
Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...