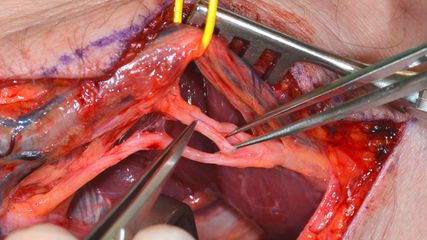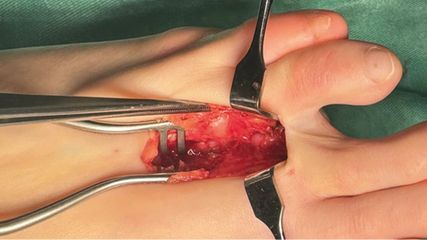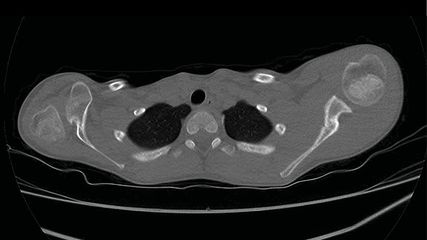<p class="article-intro">Micro-RNAs (miRNAs) sind neue potenzielle Biomarker für Diagnose, Verlauf und möglicherweise Prädiktion vieler Erkrankungen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse im Bereich der Osteologie.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>MiRNAs sind kleine, nicht kodierende mRNAs, die zukünftig eine wichtige Rolle in der Diagnostik und Prädiktion von muskuloskelettalen Erkrankungen spielen könnten. miRNAs kontrollieren die Genexpression auf posttranskriptioneller Ebene und tragen zum Zellphänotyp und damit zur Gewebsphysiologie bei. Meist kontrollieren einzelne miRNAs mehrere Gene. Umgekehrt kann ein Gen durch mehrere miRNAs reguliert werden. <br />Veränderungen im miRNA-Profil zeigen pathophysiologische Prozesse an. Die Herausforderung ist es nun, miRNAs zu identifizieren, die mehr oder weniger gewebsspezifisch sind und im besten Falle ein Krankheitsbild oder einen Pathomechanismus widerspiegeln können. Da miRNAs großteils an Vesikel gebunden sind (Exosomen), ist ein Nachweis in verschiedensten Körperflüssigkeiten möglich. Die Analyse von miRNAs im Serum hat sich als praktikabel erwiesen.</p> <h2>miRNAs und Osteoporose</h2> <p>Von den mehr als 2500 bekannten miRNAs wurden bereits zahlreiche miRNAs mit dem Knochenstoffwechsel in Verbindung gebracht. Knochenspezifische miRNAs (osteomiRs) beeinflussen Transkriptionsfaktoren des Osteoblasten oder die Osteoklastendifferenzierung über verschiedenste Signalwege. Eine Untergruppe von miRNAs, welche Patienten mit Osteoporose von gesunden Kontrollen diskriminiert, konnte bereits identifiziert werden.<sup>1</sup> Knochenspezifische miRNAs waren zwar nicht mit statischen histomorphometrischen Parametern, also Knochenstruktur, jedoch mit dynamischen Parametern assoziiert.<sup>2</sup> Dies bedeutet, dass einzelne miRNAs dynamische Prozesse im Knochen, wie zum Beispiel die Mineralisierungsrate oder die Knochenformationsrate, widerspiegeln könnten.</p> <h2>miRNAs und Osteoporosetherapie</h2> <p>miRNAs könnten auch für den Therapieverlauf relevante Informationen bringen. Aktuell werden etablierte Knochenumbaumarker für die Diagnose und die Kontrolle des Verlaufs osteologischer Erkrankungen verwendet. Etablierte Knochenumbaumarker zeigen einen typischen Verlauf unter antiresorptiver beziehungsweise osteoanaboler Therapie. <br />Genauere Informationen zu pathophysiologischen Prozessen könnten jedoch knochenspezifische miRNAs bringen. In einem Experiment an ovariektomierten Ratten (OVX), einem etablierten Modell für postmenopausale Osteoporose, wurde der Verlauf von miRNAs unter Osteoporosetherapie untersucht.<sup>3</sup> OVX führte erwartungsgemäß zum signifikanten Knochenverlust und zu Veränderungen im miRNA-Profil. Die Applikation von Zoledronat, einem intravenösen Bisphosphonat, konnte den Effekt nur gering reduzieren. Mittels osteoanaboler Teriparatid-Therapie jedoch konnte die Hochregulierung knochenspezifischer miRNAs großteils unterbunden werden. <br />Eine der Schlüssel-miRNAs, die identifiziert werden konnten, war miR-203. Diese miRNA ist mit der Osteoblastendifferenzierung assoziiert. miRNA-203 führt zu einer Hemmung des „runt-related transcription factor 2“ (RUNX2), der für die Differenzierung der mesenchymalen Stammzelle zum Osteoblasten nötig ist. OVX resultierte in einer Erhöhung, Teriparatid hingegen in einer Hemmung der miRNA- 203. Diese Daten zeigen, dass miRNAs die Veränderungen der Knochenformation beweisen können. Interessanterweise waren miRNAs aus dem Knochengewebe mit zirkulierenden miRNAs im Serum korreliert. Dies bedeutet, dass pathophysiologische Effekte im Knochen durch serologische Marker widergespiegelt werden können. <br />Bei postmenopausalen Frauen kam es ebenfalls zu Veränderungen in der miRNA-Signatur unter einer Teriparatid-Therapie.<sup>4</sup> miRNA- 133a-3p war nach 12-monatiger Therapie signifikant erniedrigt. Da miRNA-133a-3p bei Patientinnen mit postmenopausaler Osteoporose erhöht ist, wurde sie kürzlich in einer Metaanalyse als am meisten versprechender Biomarker für Osteoporose genannt.<sup>5</sup> Unter Denosumab-Therapie wurden keine signifikanten Veränderungen im miRNA-Profil beobachtet. Jedoch sind weitere Untersuchungen notwendig, um diese Ergebnisse zu bestätigen oder zu widerlegen.</p> <h2>miRNAs und Frakturheilung</h2> <p>miRNAs spielen auch eine wesentliche Rolle in der Frakturheilung. Die Hochregulierung von miR-186 hatte einen positiven Effekt auf Kallusformation, Knochendichte und -struktur durch Aktivierung des „bone morphogenetic protein“ (BMP).<sup>6</sup> miR-133a hingegen wurde als negativer Regulator der Frakturheilung identifiziert. Eine Hochregulierung der miR133a wurde bei Patienten mit Frakturheilungsstörung beobachtet und führte zu einer Senkung von RUNX2 und BMP2.<sup>7</sup></p> <h2>Fazit</h2> <p>Zirkulierende miRNAs, die einfach im Serum der Patienten bestimmt werden können, spiegeln pathophysiologische Prozesse wider und könnten zukünftig zur Diagnose von muskuloskelettalen Erkrankungen genutzt werden. Darüber hinaus ist ein Monitoring des Krankheits- und Therapieverlaufs möglich. Ob miRNAs Frakturen prospektiv vorhersagen können, ist Gegenstand aktueller Forschungsprojekte.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Kocijan R et al.: J Clin Endocrinol Metab 2016; 101(11): 4125-34 <strong>2</strong> Feichtinger X et al.: Sci Rep 2018; 8(1): 4867 <strong>3</strong> Kocijan R et al.: Bone 2020; 131: 115104 <strong>4</strong> Anastasilakis AD et al.: J Clin Endocrinol Metab 2018; 103(3): 1206-13 <strong>5</strong> Pala E et al.: Biosci Rep 2019; 39(5): BSR20190667 <strong>6</strong> Wang C et al.: Bone Joint Res 2019; 8(11): 550-62 <strong>7</strong> Peng H et al.: Eur Rev Med Pharmacol Sci 2018; 22(9): 2519-26</p>
</div>
</p>