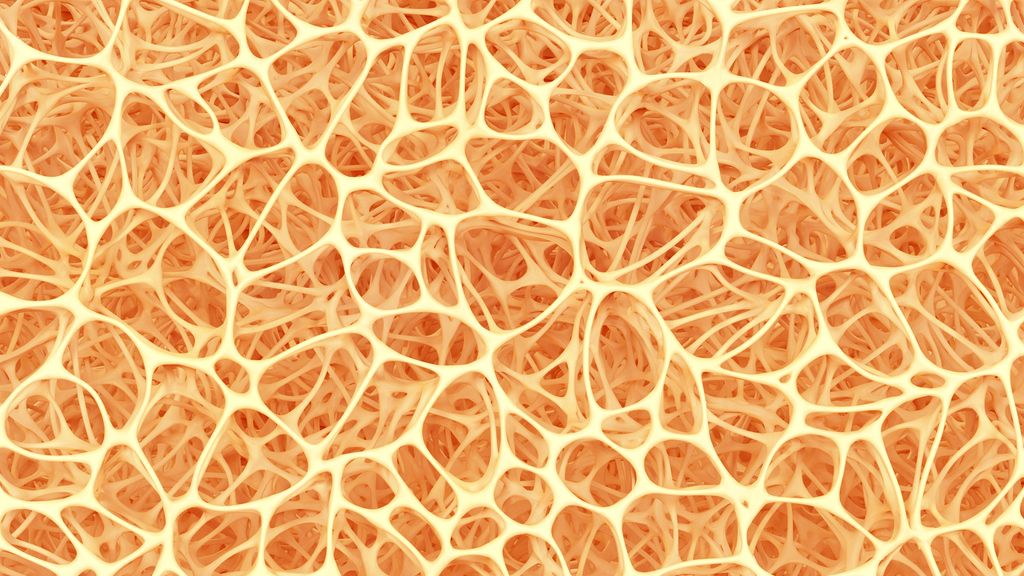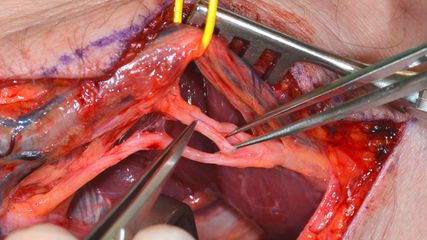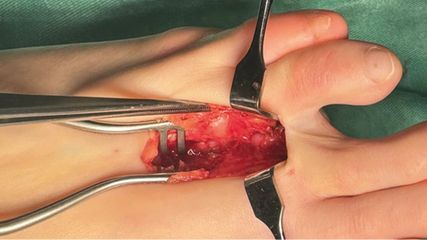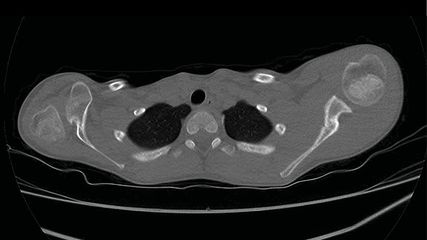<p class="article-intro">Körperliches Training für Patienten – insbesondere Krebspatienten – hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen Paradigmenwechsel erfahren. Während es Ende der 1990er-Jahre noch Standard war, dass Krebspatienten zu „Schonung und Ruhe“ geraten wurde, ist es heutzutage selbstverständlich in der Rehabilitation onkologischer Patienten, dass diesen ein möglichst aktiver Lebensstil und körperliches Training empfohlen werden.<sup>1</sup></p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Unter Berücksichtigung potenzieller Kontraindikationen profitieren Krebspatienten substanziell von körperlichem Training.</li> <li>Die Trainingslehre muss für Krebspatienten nicht neu geschrieben werden. Wie auch bei gesunden Menschen sind intensive Trainingsreize wirksamer als leichte.</li> <li>An solch ein Training muss methodisch korrekt, progressiv gesteigert und individuell abgestimmt herangeführt werden, um die Entstehung von Überlastungsschäden am Bewegungsapparat zu verhindern.</li> </ul> </div> <p>Für diese Kehrtwendung mitverantwortlich ist eine Reihe richtungsweisender Publikationen gewesen, die einerseits gezeigt haben, dass befürchtete negative Effekte von Training auf den Gesundheitszustand von Krebspatienten nicht eintreten, und andererseits, dass Patienten über eine Reihe unterschiedlicher Wirkungswege (Immunologie, Fatigue, Body Composition, Survival) sogar stark vom Training profitieren können.<sup>2</sup> Vor allem bei den diesbezüglich zum aktuellen Zeitpunkt am besten beforschten Krebsentitäten Prostata- und Brustkrebs zeigt sich mittlerweile eine sehr solide Datenlage, sodass hier zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr geklärt werden muss, ob eine Trainingsintervention hilfreich ist, sondern sich die Fragestellung dahin entwickelt hat, wie denn der „optimale“ Trainingsreiz auszusehen hat.<sup>3–5</sup></p> <h2>Historisches Umdenken</h2> <p>Historisch betrachtet war die Verbindung von Training und Krebs stark geprägt von Angst, Unverständnis und einem Übermaß an Vorsicht. Das äußerte sich darin, dass die ersten systematisch geplanten, prospektiven Trainingsinterventionsstudien mit Ausdauertraining bei Krebspatienten 1989 publiziert wurden<sup>6, 7</sup> – das ist nicht einmal 30 Jahre her. 30 Jahre sind in der Wissenschaft ein sehr kurzer Zeitraum, aber noch dramatischer sieht die Situation mit Krafttraining aus. Krafttraining war zur selben Zeit aufgrund medienwirksamer Beispiele wie Arnold Schwarzenegger („Pumping Iron“, „Conan“, „Terminator“), Sylvester Stallone („Rocky“, „Rambo“) oder Lou Ferrigno („The incredible Hulk“) in der öffentlichen Wahrnehmung primär mit Bodybuilding, düsteren Kraftkellern und Steroidmissbrauch assoziiert. Niemand mit auch nur einem Funken Vernunft wäre auf die Idee gekommen, Krebspatienten Gewichte heben zu lassen. Ausdauertraining hatte den Nimbus des „Guten“, Krafttraining war als „schlecht“ abgestempelt.<br /> Bis zu einem ausreichend großen Umdenken hat es, gemessen an der Veröffentlichung der ersten Ausdauer-Studie, über ein Jahrzehnt gedauert. Die ersten Krafttrainingsinterventionsstudien mit Krebspatienten wurden erst 2003 publiziert.<sup>8, 9</sup> Alleine wenn man diese Zeiträume betrachtet und in Bezug zueinander setzt, wird einerseits offensichtlich, dass die Erforschung von körperlichem Training bei Krebspatienten prinzipiell eine sehr junge Disziplin ist, und andererseits, dass in diesem kurzen Zeitraum Ausdauertraining mit Krebspatienten fast doppelt so lange beforscht ist wie Krafttraining. Was sich in den letzten 15 Jahren der Erforschung von Krafttraining bei Krebspatienten getan hat und welche Konsequenzen das für die muskuloskelettale Perspektive hat, darauf wird in den nächsten Zeilen eingegangen.</p> <h2>Dekonditionierung verhindern …</h2> <p>Eine über alle Krebsentitäten ähnlich problematische Entwicklung ist, dass die Primärtherapie – so erfolgreich sie bei manchen Krebserkrankungen mittlerweile ist – oft mit einer massiven Dekonditionierung der Patienten einhergeht. Dazu kommt, dass der natürliche Reflex der Patienten ist, sich – speziell was die körperliche Aktivität betrifft – zurückzunehmen. Dieser Verhaltensreflex wird einerseits durch die körperlichen Strapazen der Primärbehandlung noch unterstützt und andererseits durch eine zentrale Nebenwirkung der Primärtherapie, das Erschöpfungssyndrom, verschlimmert. Das führt zu einer weiteren Immobilisierung der Patienten, was in weiterer Folge die körperliche Dekonditionierung weiter voranschreiten lässt. Das bedeutet unter anderem einen massiven Verlust von Muskelmasse, die nicht nur funktionell fehlt (ehemals selbstverständliche Alltagstätigkeiten wie das Aufstehen aus einem tiefen Stuhl, das Öffnen einer schweren Tür oder das Tragen einer schweren Tasche werden dann zu unüberwindbaren Hindernissen im Alltag), sondern es fehlt an Muskelmasse, die als größtes stoffwechselaktives Organ eine protektive Wirkung vor der Entstehung metabolischer Erkrankungen hat. Das beste Negativbeispiel dazu sehen wir bei Prostatakrebspatienten, bei denen gut die Hälfte zumindest einmal in ihrem Behandlungsprozess eine Hormonentzugstherapie erfährt. Bei dieser Therapie wird das körpereigene Testosteron, das zentrale Sexualhormon des Mannes, welches sehr wichtig für den Aufbau und die Erhaltung von Muskelmasse ist, komplett heruntergefahren. Diese Patienten zeigen durch die Hormonentzugstherapie eine deutliche Verschlechterung der Körperzusammensetzung. Sie verlieren massiv an Muskelmasse, während sie an Körperfett zunehmen. Die Behandlung der primären Krebserkrankung ist hingegen so erfolgreich, dass die Patienten schlussendlich nicht mehr an ihrem Prostatakarzinom sterben, sondern an kardiovaskulären und metabolischen Sekundärerkrankungen, die auf die deutliche Verschlechterung der körperlichen Verfassung zurückzuführen sind.<br /> Auch wenn durch die spezielle Rolle des Testosterons beim Mann diese Problematik der Verschlechterung des kardiovaskulären und metabolischen Risikoprofils bei dieser Subpopulation von Prostatakrebspatienten am extremsten ausgeprägt ist, trifft sie aufgrund der Dekonditionierung letztlich auf alle Krebspatienten zu.<sup>2</sup> Was sich dagegen nach der aktuellen Studienlage als sehr positiv zeigt, ist, dass diese Patienten empfänglich sind für Krafttrainingsreize: Muskelmasse kann nicht nur erhalten, sondern auch geringfügig aufgebaut werden. Ebenfalls zeigt sich, dass für Krebspatienten die Trainingslehre nicht umgeschrieben werden muss: Wenn ein Krebspatient einen intensiven Krafttrainingsreiz körperlich verträgt und mental umsetzen kann, dann wird er auch stärker davon profitieren, als wenn er mit einer niedrigen Intensität trainiert.</p> <h2>... ohne dem Bewegungsapparat zu schaden</h2> <p>Standard in aktuellen Trainingsinterventionsstudien sind Krafttrainingsintensitäten zwischen dem Zwölf- und Sechs- Wiederholungs-Maximum, was in etwa 65–85 % des konzentrischen Ein-Wiederholungs- Maximums darstellt. Und exakt das führt nun zur muskuloskelettalen Perspektive. Wenn nach aktuellem Stand der Wissenschaft Krebspatienten mit mittelhohen bis hohen Krafttrainingsintensitäten belastet werden sollen, dann muss das entsprechende Training sorgfältig vorbereitet und progressiv gesteigert werden, um Überlastungen und Schäden am Bewegungsapparat zu verhindern. Die Bewegungen müssen bei niedrigeren Intensitäten sauber gelernt werden; gelenksstabilisierende und rumpfstabilisierende Übungen sind vorab einzuplanen. Die Intensitätssteigerung muss dann nach dem individuellen Fortschritt erfolgen. Kann der Patient seine Übungen methodisch korrekt durchführen und kann er dabei alle betroffenen Gelenke sowie die Wirbelsäule korrekt stabilisieren? Erst wenn diese beiden Fragen zweifelsfrei mit „Ja“ beantwortet werden können, darf die Trainingsintensität gesteigert werden. Das bedeutet wiederum, dass Training noch mehr als das betrachtet werden muss, was es ist: ein Prozess. Noch nie hat ein einzelner Trainingsreiz über Erfolg oder Misserfolg entschieden. Sehr wohl hingegen haben einzelne bei falscher Intensität beziehungsweise schlecht ausgeführte Übungen auf dem Behandlungstisch des Neurooder Unfallchirurgen oder des Orthopäden geendet.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Schmitz KH et al.: American College of Sports Medicine roundtable on exercise guidelines for cancer survivors. Med Sci Sports Exerc 2010; 42(7): 1409-26 <strong>2</strong> Bowen TS, Schuler G, Adams V: Skeletal muscle wasting in cachexia and sarcopenia: molecular pathophysiology and impact of exercise training. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2015; 6(3): 197-207 <strong>3</strong> Keilani M et al.: Effects of resistance exercise in prostate cancer patients: a meta-analysis. Support Care Cancer 2017; 25(9): 2953-68 <strong>4</strong> Hasenoehrl T et al.: The effects of resistance exercise on physical performance and health-related quality of life in prostate cancer patients: a systematic review. Support Care Cancer 2015; 23(8): 2479-97 <strong>5</strong> Keilani M et al.: Resistance exercise and secondary lymphedema in breast cancer survivors - a systematic review. Support Care Cancer 2016; 24(4): 1907-16 <strong>6</strong> Winningham ML et al.: Effect of aerobic exercise on body weight and composition in patients with breast cancer on adjuvant chemotherapy. Oncol Nurs Forum 1989; 16(5): 683-9 <strong>7</strong> MacVicar MG, Winningham ML, Nickel JL: Effects of aerobic interval training on cancer patients’ functional capacity. Nurs Res 1989; 38(6): 348-51 <strong>8</strong> McKenzie DC, Kalda AL: Effect of upper extremity exercise on secondary lymphedema in breast cancer patients: a pilot study. J Clin Oncol 2003; 21(3): 463-6 <strong>9</strong> Segal RJ: Resistance exercise in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer. J Clin Oncol 2003; 21(9): 1653-9</p>
</div>
</p>