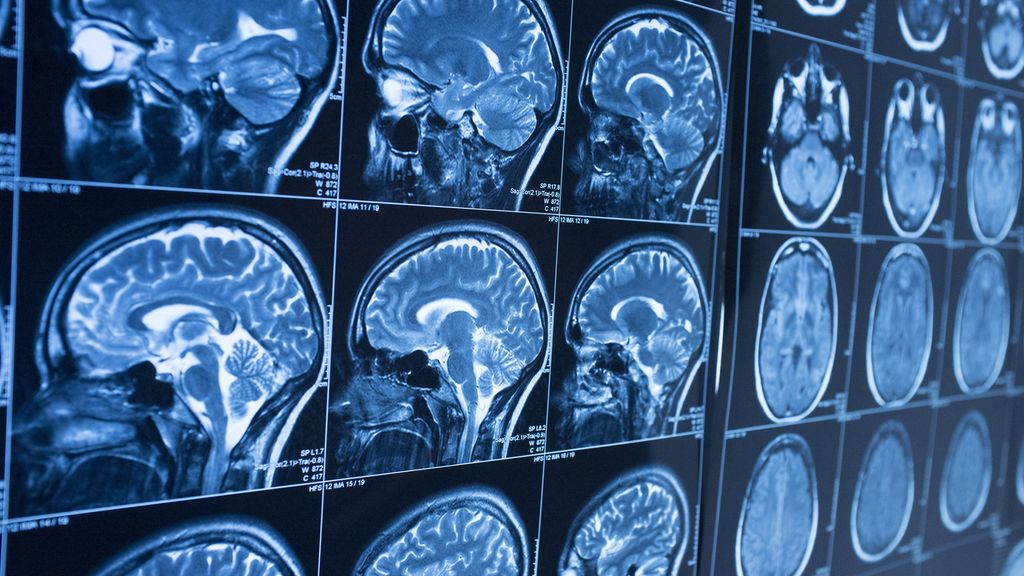
©
Getty Images/iStockphoto
Wie man Epilepsie am besten therapiert
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
09.03.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ein Gewitter im Kopf – so kann man seinen Patienten am besten eine Epilepsie erklären. Wie man am schnellsten zur Diagnose kommt, die Medikamente auswählt und was man in therapierefraktären Fällen macht, war Thema beim FOMF Innere Medizin Update Refresher in Zürich.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Wie ein Gewitter im Kopf kann man es sich vorstellen – dieses Bild hilft Patienten oft, zu verstehen, was ein epileptischer Anfall ist. Vereinfacht gesagt feuern Nervenzellen im Gehirn unkontrolliert los und werden daran nicht durch bremsende Botenstoffe gehindert. Ein Gelegenheitsanfall kann jedem von uns passieren: nach zu viel Alkoholgenuss oder einem Stromunfall zum Beispiel. «Erleidet ein Patient so einen Anfall, ist es ganz wichtig, ihm zu erklären, dass das keine Epilepsie ist», sagte PD Dr. med. Christoph Schankin, Oberarzt in der Neurologie am Inselspital in Bern. «Erst wenn immer wieder Anfälle ohne Provokation auftreten, müssen wir dem Patienten die Diagnose Epilepsie mitteilen.» 5 von 100 Menschen bekommen mindestens einmal im Leben einen epileptischen Anfall, bei 1 von 100 treten sie chronisch rezidivierend auf. Hierzulande leben schätzungsweise 80 000 Menschen mit Epilepsie. Die meisten erkranken im Kindes- und Jugendalter oder wenn sie älter als 65 Jahre sind (Abb. 1). Bei jüngeren Menschen findet man oft keine Ursache, bei einigen ist die Neigung zur Epilepsie vererbt oder ihr Gehirn wurde vor oder bei der Geburt geschädigt. Bei Älteren hingegen liegt der Epilepsie meist eine Erkrankung oder Schädigung im Hirnbereich zugrunde, etwa ein Apoplex, eine Hirnblutung, ein Tumor, eine Narbe nach einem Unfall, eine Hirnentzündung oder eine Demenz. Hatte jemand einen Anfall, bekommt er mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 % irgendwann noch einen. Nach einem zweiten oder dritten Anfall steigt das Risiko auf über 70 % .</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1701_Weblinks_s20_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1201" /></p> <h2>Das A und O: die Fremdanamnese</h2> <p>Die Fremdanamnese sei für die Diagnose essenziell, sagt Schankin: «Oft kann sich der Patient an den Anfall nicht erinnern, aber diejenigen, die dabei waren, können ihn beschreiben.» Er rät, die Angehörigen mit zum Anamnesegespräch einzuladen und sie genau zu fragen, was sie gesehen haben. «Das ist der wichtigste Schritt zur Diagnose.»<br /><br /> So erzählten ihm die Eltern eines 7-jährigen Buben, ihr Sohn habe ab und zu «Aussetzer», zwei bis drei Sekunden lang sei er «einfach nicht da». Im EEG sah Schankin Polyspike-Waves, und der Junge reagierte nicht auf Klickreize. Er leidet unter dialeptischen Anfällen, hat eine kindliche Absencen-Epilepsie, vermutlich genetisch bedingt. Bei einer 25-jährigen Frau berichteten Angehörige, sie werde ab und zu auf einmal bewusstlos. Sie selbst spürte kurz zuvor ein «seltsames Gefühl» im Oberbauch – eine epigastrische Aura. Im EEG erkannte Schankin eine Temporallappenepilepsie. Was die Ursache war, zeigte die MRI: eine Hippocampussklerose. «Formulieren Sie immer eine strukturierte, hierarchische Diagnose», sagte Schankin. «Also was für ein Symptom liegt vor, was für ein Syndrom (Tab. 1) und was ist die Ursache? Denn das bestimmt den weiteren Verlauf.» So kann man beispielsweise die Epilepsiemedikamente bei einem Kind mit benigner fokaler Epilepsie absetzen, wenn es lange genug anfallsfrei war, denn das Rezidivrisiko für einen erneuten Anfall ist nahezu null. Bei einer juvenilen myoklonischen Epilepsie ist dagegen davon abzuraten, weil das Rezidivrisiko 100 % beträgt (Tab. 2).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1701_Weblinks_s20_tab1.jpg" alt="" width="685" height="873" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1701_Weblinks_s20_tab2.jpg" alt="" width="1417" height="404" /></p> <h2>Medikamente werden individuell ausgesucht</h2> <p>Jeder Patient sollte präventive Massnahmen beachten: nicht Auto fahren, keine Extremsportarten wie Klettern oder Tiefschneefahren ausüben und keinen Hubschrauber fliegen. Damit man in einem Anfall vor Verbrennungen oder Verbrühungen geschützt ist, sollten Herde bei zu langer Hitzeentwicklung automatisch ausgehen und die maximale Wassertemperatur vom Duschwasser sollte nicht zu hoch eingestellt sein. «Im Bett rauchen lässt man lieber sein – es könnte eine böse Überraschung geben, wenn das Bett während eines Anfalls in Brand gerät», erzählte Schankin. Er rät seinen Patienten zu regelmässigem Schlaf und es mit dem Alkohol nicht zu übertreiben – beides reduziert das Risiko für Anfälle.<br /><br /> Antiepileptika teilt der Neurologe in drei Kategorien: erstens das Medikament «für arme Länder» (Phenobarbital), Präparate für Nichtexperten (Valproat und Levetiracetam) und eine lange Liste von Medikamenten für Experten (Phenytoin, Primidon/PB, Benzodiazepine, Carbamazepin, Ethosuximid, Vigabatrin, Lamotrigin, Gabapentin, Tiagabin, Topiramat, Oxcarbazepin, Levetiracetam, Pregabalin, Zonisamid, Lacosamid, Rufinamid, Stiripentol, Eslicarbazepin). Er wählt das Präparat danach aus, wie rasch ein Anfallsschutz gewünscht wird, wie hoch das Rezidivrisiko ist, nach Alter und Begleitkrankheiten und bei Frauen danach, ob sie schwanger sind oder werden wollen. So wirken beispielsweise Phenytoin, Lorazepam, Phenobarbital und Valproat i.v. innert Minuten bis Stunden, Pregabalin oder Levetiracetam innert ein bis zwei Tagen und Oxcarbazepin und Gabapentin erst nach mehreren Tagen. «Ältere und neuere Präparate wirken vergleichbar gut, aber die neueren haben weniger Nebenwirkungen und interagieren nicht so viel mit anderen Medikamenten», sagte Schankin. Zu bevorzugen sei eine Monotherapie: Die Compliance sei besser, es komme zu keinen Interaktionen zwischen verschiedenen Antiepileptika, zu weniger Nebenwirkungen und die Dosis lasse sich einfacher anpassen. «Man sollte so lange aufdosieren, bis der Patient anfallsfrei ist. Ist das nur mit starken Nebenwirkungen möglich, sollte man eher umsteigen auf ein anderes Präparat, statt ein zweites dazuzugeben.» Je nach zugrunde liegender Ursache kann man versuchen, die Medikamente zu reduzieren, wenn der Patient einige Jahre anfallsfrei war.<br /><br /> Manche Patienten lassen sich trotz ausgefeilter medikamentöser Therapie nicht vor Anfällen schützen. Braucht der Patient ein zweites Medikament, ist die Chance gering, dass er anfallsfrei wird, und wenn er auf drei nicht anspricht, ist die Chance quasi null, ausschliesslich mit Medikamenten anfallsfrei zu werden. Dann solle man frühzeitig über eine Operation nachdenken und den Hirnbereich entfernen lassen, der für die Anfälle verantwortlich sei, sagte Schankin. «Ich würde immer raten, das nur in einem Epilepsie-Zentrum machen zu lassen.» 58 % der Patienten mit therapierefraktärer Epilepsie können mit einer Operation anfallsfrei werden. Wenn sie dagegen ausschliesslich Medikamente nehmen, nur 8 % .</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: FOMF Innere Medizin Update Refresher, 22. November
2016, Zürich
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Werhan K et al: Dtsch Arztebl Int 2009; 106(9): 135-42<br /> <strong>2</strong> Shinnar et al: Ann Neurol 1994; 35 (5): 534-45</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...


