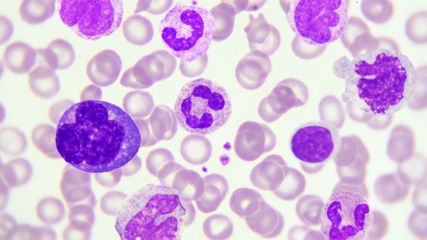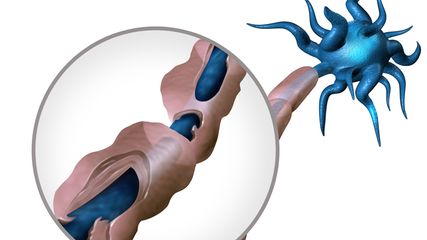©
Getty Images
Was leisten die neuen CGRP-Antikörper?
Jatros
30
Min. Lesezeit
11.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mit der Antikörper-vermittelten Antagonisierung des Neuropeptids CGRP („calcitonin gene-related peptide“) hat ein neues Wirkprinzip Einzug in die Migräneprophylaxe gehalten. Auf der AAN-Jahrestagung 2019 wurden zu den bisher zugelassenen CGRP- Antikörpern Erenumab (Aimovig<sup>®</sup>), Fremanezumab (Ajovi<sup>®</sup>) und Galcanezumab (Emgality<sup>®</sup>) neue Langzeitdaten aus offenen Extensionsstudien („open label extension“, OLE) und verblindeten Langzeitstudien zur Wirksamkeit und Sicherheit bei Patienten mit episodischer Migräne (EM) und chronischer Migräne (CM) bis zu einer Therapiedauer von einem Jahr sowie Post-hoc-Subgruppenanalysen der Phase-III-Basisstudien vorgestellt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Besondere Aufmerksamkeit galt dabei in den Studienprogrammen der Gruppe schwer behandelbarer Patienten mit schlechter Prognose. Dazu gehören vor allem mehrfach erfolglos vorbehandelte Patienten sowie Migränepatienten mit Medikamentenübergebrauch. Erenumab wurde bei EM-Patienten in den Phase-III-Studien STRIVE und LIBERTY untersucht. In der LIBERTY-OLE erreichten unter Erenumab 70 und 140 mg über die Hälfte der Patienten mit mehr als einer vergeblichen Prophylaxe (52 % bzw. 55 %) eine Reduktion der monatlichen Anzahl an Migränetagen (MMT) ≥ 50 %. Bei 75 % waren es noch rund ein Drittel (29 % bzw. 33 %), jeweils vs. Therapiebeginn vor 52 Wochen (Abb. 1).<sup>1</sup> Eine noch etwas deutlichere Reduktion der MMT erreichte die STRIVE-OLE mit Patienten mit EM und ≥ 2 vergeblichen Prophylaxen. Gleichzeitig blieb der in der Basisstudie erreichte signifikante Rückgang der physischen Behinderungen im MPFID Physical Impairment Score und der Aktivitäten des Alltags im MPFID-EA („Migraine Physical Function Impact Diary – Everyday Activities“) in der OLE erhalten.<sup>2</sup><br /> In den Phase-III-Studien HALO EM und HALO CM wurden die monatlichen Migräne- bzw. Kopfschmerztage (primäre Endpunkte) durch den vollhumanen monoklonalen CGRP-Antikörper (IgG2Δ2) Fremanezumab signifikant verringert. Desgleichen wurden die sekundären klinischen und Patienten-relevanten Endpunkte verbessert.<sup>3</sup> In der OLE erhielten die Patienten verblindet entweder Fremanezumab einmal monatlich 225 mg oder einmal vierteljährlich 675 mg. Zahlreiche Patienten hatten bereits ≥ 1 vergebliche Prophylaxe. Bei den CM-Patienten mit komorbider schwerer Depression hielt die in der Doppelblindphase erreichte Reduktion der monatlichen Anzahl an Migränetagen bis Woche 52 an<sup>4</sup> und der Verbrauch an Akutmedikamenten sank. Die Migräne-assoziierte Behinderung verringerte sich ebenfalls.<sup>5</sup> Begleitend ging auch die mit der CM assoziierte Depressivität zurück; Lebensqualität und Patientenzufriedenheit verbesserten sich bis Woche 52.<sup>4, 6</sup> 548/813 Patienten mit CM erreichten nach 12 Monaten eine Konversion zu einer EM.<sup>7</sup> In der 9-monatigen OLE der Phase-IIIStudie REGAIN erhielten die Patienten mit CM entweder Galcanezumab 120 oder 240 mg s.c. monatlich. Rund drei Viertel der Teilnehmer waren vortherapiert. In allen Gruppen nahm in der Folge die MMT bis Ende der OLE noch weiter ab (Abb. 2). Begleitend verbesserte sich die Rollenfunktion im Migräne-spezifischen Lebensqualitätsfragebogen (MSQ) kontinuierlich.<sup>8</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1903_Weblinks_jatros_neuro_1903_s23_abb1_kretzschmar.jpg" alt="" width="1419" height="847" /></p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1903_Weblinks_jatros_neuro_1903_s23_abb2_kretzschmar.jpg" alt="" width="1431" height="944" /></p> <h2>Eine Frage der Dosis?</h2> <p>Die Daten zeigen insgesamt keinen großen Wirkunterschied zwischen beiden Erenumab-Dosierungen. In speziellen Behandlungssituationen erwies sich jedoch Erenumab 140 mg gegenüber 70 mg als überlegen. Hinsichtlich des Sicherheitsprofils bestanden in den Studien keine relevanten Unterschiede. Bei Fremanezumab waren die Wirksamkeit und Sicherheit der monatlichen und der vierteljährlichen Gabe in den vorliegenden klinischen Studien vergleichbar.<sup>4, 9</sup></p> <h2>Konsistente Sicherheitsdaten</h2> <p>Als hoffnungsvoll für eine Migräneprophylaxe über längere Zeiträume mit den drei zugelassenen CGRP-Antikörpern ist zu bewerten, dass ihr Sicherheitsprofil auch in den OLE demjenigen in den Kurzzeitstudien ohne neue Signale entsprach und im Wesentlichen auf Placeboniveau lag. Eine Ausnahme bildete die erhöhte Drop-out- Rate wegen unerwünschter Ereignisse unter Galcanezumab 240 mg.<sup>10</sup> Am häufigsten – und teilweise häufiger als unter Placebo – wurden Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet.<sup>1, 2, 4, 8, 11, 12</sup></p> <h2>Offene Fragen</h2> <p>Alle Präsentatoren warnten davor, die bei den verschiedenen Antikörpern erreichten Ergebnisse direkt zu vergleichen – zu groß sind die Unterschiede bei den Patientengruppen und Studiendesigns. Prof. Peter Goadsby, London, ist davon überzeugt, dass die Unterschiede im Bindungsverhalten – Erenumab bindet an den CGRP-Rezeptor, die übrigen Antikörper interagieren direkt, aber laut Goadsby nicht an identischen Bindungsstellen mit dem Neuropeptid – auch klinisch erkennbar werden. Mit den jetzt zunehmend generierten Daten zur Langzeitanwendung der neuen CGRP-Antikörper wird man das Nutzen-Risiko-Profil der verschiedenen Wirkstoffe besser differenzieren können, so seine Hoffnung.<br /> Damit werden nach Ansicht der Experten auch einige der noch offenen Fragen zu Unterschieden und Gruppeneffekten der neuen Antikörper beantwortet. Dies betrifft vor allem mögliche Sequenztherapien bei Patienten, die auf einen CGRPAntikörper nicht ansprechen oder Unverträglichkeiten entwickeln. Die CGRP-Antikörper werden auch bei anderen Schmerz- bzw. Kopfschmerzindikationen untersucht. Hier reduzierte Galcanezumab 300 mg s.c. bei 49 Patienten mit Cluster-Kopfschmerzen in einer 8-wöchigen Doppelblindstudie gegenüber Placebo (n = 57) die Frequenz der wöchentlichen Cluster-Attacken in den Wochen 1–3 (primärer Endpunkt) signifikant stärker. Der globale Eindruck der Verbesserung der Patienten (PGI-I) war nach Woche 4 unter Galcanezumab signifikant größer, nicht aber nach Woche 8.<sup>13</sup></p> <p> </p> <div id="fazit"> <h2>Gepante wieder ante portas?</h2> <p>Die Entwicklung der CGRP-Antikörper wurde forciert, nachdem mehrere orale CGRP-Antagonisten (Gepante) als neue Klasse von Medikamenten zur akuten Behandlung der Migräneattacken aufgrund von Lebertoxizität noch spät in der Phase III scheiterten. Auf dem AAN 2019 wurden jetzt mehrere erfolgreiche Phase-II/III-Studien zu verschiedenen neuen „Gepant-small molecules“ zur Migräneprophylaxe (Atogepant) bzw. Akuttherapie (Ubrogepant) vorgestellt. Atogepant erreichte in einer Phase-IIb/III-Studie bei Patienten mit im Mittel 7,67 (4–14) Migränetagen pro Monat nach 12-wöchiger Therapie mit allen Dosierungen (10 mg/qd; 30 mg/bid oder qd; 60 mg/bid oder qd) gegenüber Placebo eine Reduktion der Migränetage (primärer Endpunkt), die in etwa in der Größenordnung der CGRPAntikörper lag. Das Sicherheitsmonitoring zeigte bei 0,6 % der Patienten eine Leberwerterhöhung ≥ 5 x ULN („upper limit of normal“; Placebo: 0 %) sowie zwischen 0,6 % und 2,2 % einen ALT- oder AST-Anstieg ≥ 3 x ULN (Placebo: 1,1 %).<sup>14</sup> In einer Sicherheitsstudie entwickelten unter Ubrogepant bei hochfrequenter intermittierender Hochdosisgabe (100 mg) 0,8 % der 256 Teilnehmer eine AST-/ALTErhöhung gegenüber 1,9 % unter Placebo (n = 260).<sup>15</sup></p> </div></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 71. Jahrestagung der American Academy of Neurology
(AAN), 4.–10. April 2019, Philadelphia
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Reuter U et al.: Poster P01.10-020; AAN 2019 <strong>2</strong> Chou D et al.: Oral Session S38.005 (STRIVE); AAN 2019<strong> 3</strong> Lawrence C et al.: Oral Session S38.001: AAN 2019 <strong>4</strong> Lipton R et al.: Poster P1.10-024; AAN 2019 <strong>5</strong> McAllister P et al.: Poster P2.10-015; AAN 2019 <strong>6</strong> Cohen JM et al.: Poster P2.10-023; AAN 2019 <strong>7</strong> Lipton R et al.: Poster P2.10-013; AAN 2019 <strong>8</strong> Detke H et al.: Poster P2.10-010; AAN 2019 <strong>9</strong> Blaiss C et al.: Poster P2.10-013; AAN 2019 <strong>10</strong> Bangs ME et al.: Poster 10-014; AAN 2019 <strong>11</strong> Tepper S et al.: P1.10- 016 ; AAN 2019 <strong>12</strong> Goadsby P et al.: Oral Session S38.004; AAN 2019 <strong>13</strong> Bardos J et al.: Clinical Trails Session; AAN 2019<strong> 14</strong> Goadsby P et al.: Oral Session S17001; AAN 2019 <strong>15</strong> Goadsby P et al.: Oral Session S17009; AAN 2019</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien
Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...
Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS
Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...
Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln
Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...