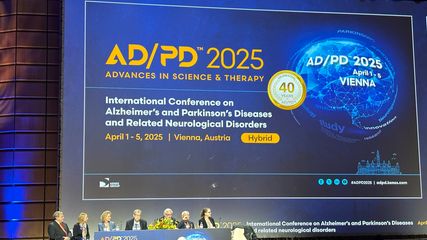Therapie-Update motorischer Symptome
Bericht:
Mag. Harald Leitner
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Im Rahmen des virtuellen Kongresses Highlights Digital 2023 der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DGP) berichteten Expert*innen über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Behandlung motorischer Symptome von M. Parkinson und von Levodopa-induzierten motorischen Spätkomplikationen.
Medikamentöse Therapien
P2B001
P2B001 ist ein neues Prüfpräparat, bestehend aus einer Fixkombination aus retardiertem, niedrig dosiertem Pramipexol (0,6mg) und Rasagilin (0,75mg). Es wurde zur einmal täglichen Einnahme gegen motorische Symptome des M. Parkinson entwickelt. In einer Phase-II-Studie konnte eine symptomatische Wirksamkeit von P2B bei ähnlich guter Verträglichkeit wie bei Placebo nachgewiesen werden. Erste Daten einer Phase-III-Studie wurden im vergangenen Jahr im Rahmen der Kongresse der AAN (American Academy of Neurology) und der MDS (International Parkinson and Movement Disorder Society) präsentiert. Bei Letzterer handelt es sich um eine 12-wöchige, multizentrische, multinationale, randomisierte Doppelblindstudie, in die Patient*innen im Alter zwischen 35 und 80 Jahren mit einem Hoehn-und-Yahr-Stadium <3, einer Zeit seit Diagnosestellung unter 3 Jahren und ohne Parkinsonmedikation eingeschlossen wurden.1 Die Studienteilnehmer*innen wurden in vier Gruppen randomisiert und erhielten entweder P2B001, Pramipexol 0,6mg, Rasagilin 0,75mg oder retardiertes auf Dosierungen zwischen 1,5 und 4,5mg titriertes Pramipexol. Bezüglich des primären Endpunktes, Wirksamkeit im UPDRS-Gesamtscore, zeigten sich nach 12 Wochen ein signifikanter Vorteil von P2B001 gegenüber den einzelnen Bestandteilen und eine vergleichbare Wirksamkeit wie mit retardiertem Pramipexol bei einer mittleren Dosis von 3,2mg. Die Kombination aus niedrig dosiertem Pramipexol und Rasagilin wurde von den Proband*innen allerdings deutlich besser vertragen. So wurden unter P2B001 signifikant weniger Tagesmüdigkeit und orthostatische Hypotension als unter handelsüblichem Pramipexol beobachtet.
Amantadin
Dabei handelt es sich um eine Substanz mit antiglutamaterger und dopaminerger Wirkung. Die Wirksamkeit von Amantadin gegen L-Dopa-induzierte Dyskinesien in späten Stadien des M. Parkinson ist gut belegt, wenig bekannt ist jedoch über dessen Wirksamkeit gegen motorische und nichtmotorische Symptome in der Frühphase der Erkrankung. In der PREMANDYSK-Studie wurde untersucht, ob eine frühe Therapie mit Amantadin die Prävalenz von L-Dopa-induzierten Dyskinesien reduziert.2 Dabei handelt es sich um eine doppelblinde, placebokontrollierte, 21-monatige randomisierte Multicenterstudie zur Evaluierung von Amantadin 200mg/d innerhalb des ersten Jahres einer L-Dopa-Therapie. Eingeschlossen wurden 207 Patient*innen mit M. Parkinson mit einem mittleren Alter von 62 Jahren und einer Krankheitsdauer von 3 Jahren, einer L-Dopa-Therapie (305mg/d) seit 8 Monaten und ohne motorische Komplikationen (MDS-UPDRS Teil 3: 15 Punkte).
Hinsichtlich des primären Endpunktes zeigte sich nach 18 Monaten eine signifikant geringere Häufigkeit von Dyskinesien unter Amantadin gegenüber Placebo (11% vs. 22%; p=0,023). Darüber hinaus kam es zu einem geringeren Anstieg der L-Dopa-Tagesdosis unter Amantadin und die Progressionen in der Parkinson Fatigue Scale (p=0,002), der Freezing of Gait Scale (p=0,03) und dem PDQ (p=0,01) fielen ebenfalls signifikant niedriger aus. Nach verzögertem Start von Amantadin in der Placebogruppe ergab sich allerdings kein Unterschied in Bezug auf die motorischen Komplikationen, sodass die Autoren schliessen, dass die frühe Behandlung mit Amantadin das Auftreten von Dyskinesien unter L-Dopa reduziert, die Substanz aber wahrscheinlich keine neuroprotektive Wirkung hat.
Weitere Substanzen
Tavapadon ist ein neuartiger, oral verabreichter, selektiver partieller Agonist an Dopamin-D1- und -D5-Rezeptoren.3 Durch die selektive Beeinflussung der D1/D5-Rezeptoren soll er die motorischen Symptome verbessern und gleichzeitig unerwünschte Wirkungen minimieren, die mit traditionellen D2/D3-Rezeptor-Agonisten assoziiert sind. TEMPO-1 und TEMPO-2 sind Phase III-Studien, in denen einerseits eine fixe Dosierung und andererseits eine flexible Dosierung von Tavapadon in frühen Stadien des M. Parkinson geprüft werden.
Eine weitere Substanz ist Opicapon. Dabei handelt es sich um einen COMT-Hemmer der 3. Generation, der bereits zur Behandlung von «End-of-dose»-Fluktuationen bei M. Parkinson zugelassen ist. In der EPSILON-Studie soll nun die Wirkung von Opicapon auf motorische Symptome untersucht werden, wenn es zusätzlich zu einer stabilen L-Dopa/DDCi(DOPA-Decarboxylase-Hemmer)-Therapie bei Parkinsonpatient*innen im Frühstadium verabreicht wird.4
Nichtmedikamentöse Therapien
In randomisierten Studien konnte gezeigt werden, dass sich Bewegungsgrade, Richtungskontrolle, Ganggeschwindigkeit und Lebensqualität von Parkinsonpatient*innen nach sechsmonatigem Tai-Chi-Training verbessern. Eine neue Studie aus China untersuchte nun den Langzeiteffekt von Tai-Chi und zugrunde liegende Mechanismen bei Patient*innen mit M. Parkinson mittels fMRT und Biomarker.5 95 Patient*innen wurden dabei in drei Gruppen randomisiert – Tai-Chi, Brisk Walking (zügiges Gehen) und eine Kontrollgruppe. Im Vergleich zu Placebo zeigten sich in der Tai-Chi-Gruppe Verbesserungen der Balance, der Motorik und des Gehens. Aber auch im Vergleich zum zügigen Gehen wurden mit Tai-Chi Verbesserungen der Balance und der Schrittlänge erzielt. Das fMRT zeigte, dass die Verbesserungen der Balance nach Tai-Chi mit Veränderungen im visuellen Netzwerk und die motorischen Verbesserungen mit Veränderungen im Default Mode Network korrelierten. Darüber hinaus wurden die Downregulation von proinflammatorischen Zytokinen und Veränderungen bei Metaboliten des Aminosäure-, Energie- und Neurotransmitterstoffwechsels beobachtet. In einer anderen Studie an 70 Parkinsonpatient*innen zeigte sich, dass Brisk Walking über 6 Monate zu einer deutlichen Verbesserung der Motorik führt.6 Darüber hinaus waren auch Schrittgeschwindigkeit und Balance durch Brisk Walking gebessert.
Motorische Spätkomplikationen
Levodopa-induzierte motorische Komplikationen, die durch die nicht physiologische, pulsatile Stimulation der Rezeptoren verursacht werden, sind häufig für die Behinderung von Parkinsonpatient*innen verantwortlich.7 Die Methoden zur möglichst kontinuierlichen Stimulation durch konstante Pharmakaspiegel reichen von der zusätzlichen Gabe einer On-Demand-bzw. Rescue-Medikation über die Anwendung von Apomorphinpumpen, LCIG (Levodopa Carbidopa Intestinal Gel) und LECIG (Levodopa Entacapone Carbidopa Intestinal Gel) bis hin zur tiefen Hirnstimulation.
Als Rescue-Medikation ist seit vergangenem Jahr ein Levodopa-Inhalationspulver in Europa verfügbar. In der zulassungsrelevanten Studie konnten signifikante Verbesserungen im UPDRS Motor Score während der Off-Phasen beobachtet werden.8 Die darauffolgende Sicherheitsstudie hat gezeigt, dass das Sicherheitsprofil von inhalativem Levodopa günstig ist und jenem von Levodopa entspricht.9 Für Apomorphin, das seit Langem erfolgreich als subkutan applizierte Formulierung eingesetzt wird, wird in Kürze auch in Europa eine sublinguale Formulierung zur Verfügung stehen. In der Zulassungsstudie erwies sich der Apomorphin-Sublingualfilm als effektive Medikation zur Bedarfsbehandlung von Off-Episoden. Neu bei den invasiven Therapieoptionen zur Behandlung von motorischen Spätkomplikationen ist das LECIG, bei dem zu Levodopa und Carbidopa des LCIG der COMT-Inhibitor Entacapon hinzugefügt wurde. Erste Erfahrungen zeigen, dass das LECIG wirksam und sicher ist und von den Patient*innen gut angenommen wird.10 Eine grösser angelegte prospektive, nicht interventionelle Real-World-Studie zur Evaluierung von Wirksamkeit und Sicherheit des LECIG ist derzeit im Laufen.11
Quelle:
Parkinson und Bewegungsstörungen – Highlights Digital 2023, 16.–17. März 2023, virtuell
Literatur:
1 Olanow CW et al.: MDS Annual Meeting 2022, Madrid; Abstract 750 2 Rascol et al.: MDS Annual Meeting 2022, Madrid; LBA-17 3 Fernandez et al.: World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders 2022, Prag 4 Ferreira JJ et al.: Mov Disord 2022; 37(11): 2272-83 5 Li G et al.: Transl Neurodegener 2022; 11(1): 6 6 Mak MKY, Wong-Yu ISK: J Parkinsons Dis 2021; 11(3): 1431-41 7 Olanow CW et al.: Lancet Neurol 2006; 5(8): 677-87 8 LeWitt PA et al.: Lancet Neurol 2019; 18(2): 145-54 9 Grosset DG et al.: Parkinsonism Relat Disord 2020; 71: 4-10 10 Öthman M et al.: J Pers Med 2021; 11(4): 254 11 Jost W et al.: Clin Neurophysiol 2022; 137: e61
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...