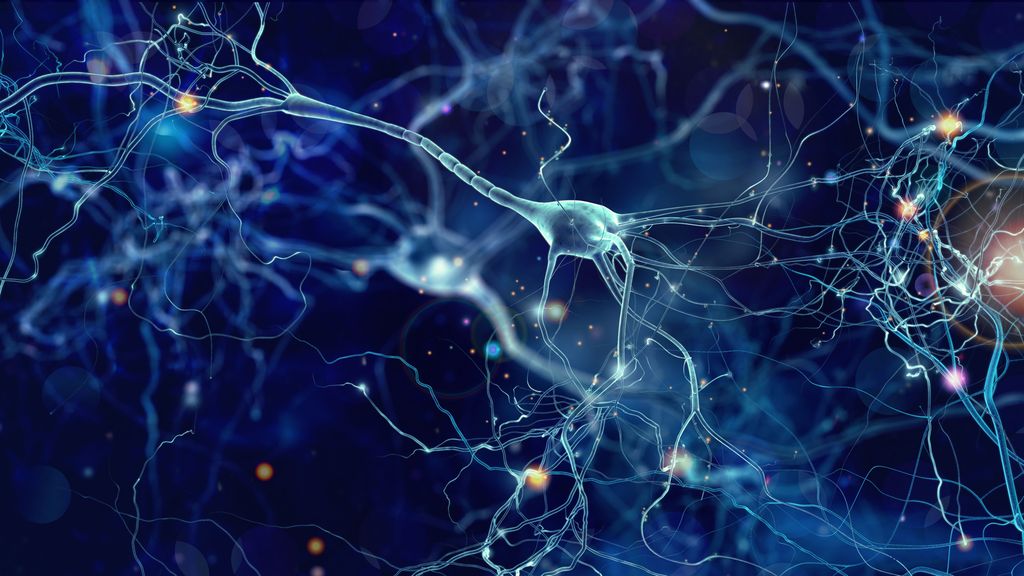
©
Getty Images/iStockphoto
Tagung der Neurologen im Zeichen neuer Wege
Jatros
30
Min. Lesezeit
28.06.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Es gibt wenige Bereiche in der Medizin, in denen während der letzten beiden Jahrzehnte eine derart rasante Entwicklung stattgefunden hat wie in der Neurologie. Zahlreiche Vorträge und Sitzungen bei der ÖGN-Tagung in Linz zeigten auf, wie sich die Neurologie in den letzten Jahren von einem rein diagnostischen Spezialfach in ein Akutversorgungsfach wandelte und wie in manchen Gebieten Paradigmenwechsel stattfanden. Um das Zusammenspiel und die Vernetzung mit anderen medizinischen Fachgebieten zu fördern, gingen die Organisatoren heuer neue Wege.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Erstmals Angebote für junge Neurologen und Allgemeinmediziner</h2> <p>In einer perfekten neurologischen Versorgungskette braucht es gut funktionierende Schnittstellen. Das fängt bei der Laieninformation über das richtige Verhalten im Akutfall an und geht über ein Grundverständnis bei Allgemeinmedizinern bis zu einem erweiterten Basiswissen bei anderen Fachärzten wie beispielsweise Augenärzten oder Chirurgen. Dieses wichtige Zusammenspiel ist nun gefährdet. Mit der 2015 in Kraft getretenen Ärzteausbildungsordnung wurde die Neurologie in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner als Pflichtfach abgeschafft. „Wir haben mehrfach vor gefährlichen Wissenslücken bei der zukünftigen Ärzteschaft gewarnt – und sehen unsere Befürchtungen leider zunehmend bestätigt. Die Erfahrungen zeigen uns, dass angehende Allgemeinmediziner tatsächlich kaum mit der Neurologie in Berührung kommen“, erörterte Prim.<sup>a</sup> Univ.-Doz.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> Elisabeth Fertl, Präsidentin der ÖGN. Darauf müsse die ÖGN dringend reagieren. Es brauche eine Novelle zur Ausbildungsordnung, die sicherstelle, dass künftig wieder jeder Allgemeinmediziner neurologische Erfahrungen und Fertigkeiten vermittelt bekomme.</p> <p>Ein Zeichen diesbezüglich setzten daher auch die Organisatoren der ÖGN-Tagung und gestalteten den diesjährigen Kongress sehr offen. Kongresspräsident Prim. Dr. Tim von Oertzen, meinte dazu: „Um auch Allgemeinmediziner und vor allem die nächste Ärztegeneration über die laufenden Fortschritte unseres Fachgebietes zu informieren, gab es am Kongress diesmal zahlreiche Veranstaltungen für Nichtneurologen und spezielle Angebote für Jungmediziner.“</p> <h2>Fortschritte in der Schlaganfallbehandlung</h2> <p>Der Schlaganfall ist das beste Beispiel für die Entwicklung der Neurologie hin zum Akutversorgungsfach. Dank vieler neuer Erkenntnisse und des in Österreich vorbildlichen Stroke-Unit-Netzwerks konnten erhebliche Fortschritte erzielt werden. Mit der Thrombektomie besteht seit einigen Jahren die Möglichkeit, auch größere Gefäßverschlüsse zu entfernen. Bisher galt dabei die Maxime, dass eine erfolgreiche Behandlung nur in einem Zeitfenster von sechs bis acht Stunden nach dem Schlaganfall möglich sei.</p> <p><strong>Schlaganfallpatienten auch noch nach 24 Stunden rettbar</strong><br />Gleich zwei Studien (DAWN, DEFUSE 3) belegen nun, dass eine solche Behandlung auch bis zu 24 Stunden nach dem Ereignis erfolgreich sein kann.<sup>1, 2</sup> Die wichtigste Voraussetzung dafür ist die Erweiterung der bildgebenden Diagnostik: Während bisher nur geprüft werden musste, ob der für den Schlaganfall verantwortliche Thrombus in einem Bereich der Hirnarterien sitzt, der mit dem Katheter erreicht werden kann, muss bei sehr spät einsetzender Behandlung zusätzlich herausgefunden werden, ob die betroffenen Gehirnteile noch zu retten oder bereits abgestorben sind. „Dass wir in Zukunft noch mehr Patienten retten werden können, ist erfreulich, zwingt uns aber nicht nur zu medizinischen, sondern auch technischen – und datenschutztechnischen – Anpassungen, beispielsweise beim Austausch der Bilder zwischen Bundesländern oder Krankenhausträgern. Wenn wir die neuen Chancen für unsere Patienten nutzen wollen, müssen wir rechtzeitig für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen“, betonte Fertl.</p> <h2>Tagungsschwerpunkt Epilepsie</h2> <p>Die Epilepsie wird häufig immer noch zu Unrecht als seltene Erkrankung angesehen. Tatsächlich aber sind in Österreich 0,8 Prozent der Gesamtbevölkerung betroffen, also mehr als 60 000 Menschen. Dass dieses Thema bei der ÖGN-Tagung besonders intensiv behandelt wurde, hat vor allem den Grund, dass in diesem Teilbereich der Neurologie die Kluft zwischen Patientenbedürfnissen und medizinischen Möglichkeiten auf der einen Seite und der Behandlungsrealität auf der anderen Seite immer größer wird.</p> <p><strong>Möglichkeiten der Gehirnchirurgie noch zu wenig genutzt</strong><br />Die Lücke zwischen dem Machbaren und dem, was gemacht wird, ist bei jenen Patienten besonders groß, die auf die verfügbaren Epilepsiemedikamente nicht ansprechen. Rund ein Drittel der Epilepsiepatienten ist therapieresistent, wobei diese Resistenz definiert ist durch das Ausbleiben der Anfallsfreiheit mit zwei Antiepileptika in Mono- oder Kombinationstherapie bei ausreichender Dosierung und Einsatz von Antiepileptika, die für das jeweilige Epilepsiesyndrom bzw. den Anfallstyp adäquat sind.<sup>3</sup> Der technische Fortschritt sowohl auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik als auch auf dem Gebiet der Neurochirurgie ermöglicht es, dass ein Teil der therapieresistenten Patienten heute mit immer besserer Langzeiteffektivität operiert werden kann. Dies wurde unter anderem in einer rezenten Studie<sup>4</sup> mit 9523 Patienten gezeigt. 58 Prozent der Erwachsenen waren ein Jahr nach einem solchen Eingriff vollständig anfallsfrei. Wenn der Epilepsie ein gutartiger Tumor zugrunde lag, waren es sogar 63,5 Prozent. Bei Kindern lag die Erfolgsrate bei 65 Prozent.</p> <p>„Leider wird diese Möglichkeit noch viel zu wenig genutzt. Und wenn, dann häufig viel zu spät: Wie die Studie zeigt auch unsere tägliche Praxis an der neuen medizinischen Fakultät in Linz, wo wir einen eigenen Forschungsschwerpunkt Epilepsie eingerichtet haben, dass die Betroffenen durchschnittlich erst 16 Jahre nach der Erstdiagnose zur Operation kommen. Dabei müsste in jedem dieser Fälle nach spätestens drei bis fünf Jahren erkennbar gewesen sein, dass es sich um Patienten handelt, die auf Medikamente nicht ansprechen“, kommentierte von Oertzen. Die Hürden für die Zuweisung zu einer epilepsiechirurgischen Abklärung sind vielfältig und äußern sich in Fehleinschätzungen über die Epilepsiechirurgie aufseiten der Ärzte<sup>5</sup> und Vorbehalten aufseiten der Patienten6. „Wir haben mit der Epilepsiechirurgie</p> <p>„Wir haben mit der Epilepsiechirurgie eine effektive Behandlung zur Verfügung und suchen dafür Patienten mit einer therapieresistenten fokalen Epilepsie, die früh im Krankheitsverlauf stehen. Je früher wir sie identifizieren und von ihren Anfällen befreien, umso größer ist die Chance auf eine langfristige Anfallsfreiheit und umso höher wird auch der sozioökonomische Effekt sein, den wir erzielen“, fasste von Oertzen die aktuelle Lage zusammen. Um Epilepsiepatienten mit einer Therapieresistenz früh zu erreichen, bedürfe es jedoch eines Paradigmenwechsels in der Betreuung der Epilepsiepatienten. Dieser verlangt eine engere Patientenführung und ein konsequentes Auf-/ Umdosieren. Es wäre notwendig, enger als bisher mit den Patienten zusammenzuarbeiten – auch der Einsatz von Case- Managern wäre zu überlegen, die sich aktiv mit den Patienten in Verbindung setzen. „Wir brauchen in der Epilepsietherapie eine frühe kurative Behandlung – die haben wir. Wir müssen sie nur nutzen!“, so von Oertzen.</p> <p><strong>Schwierige Themen in der Epilepsiesprechstunde</strong><br />Dr. Iris Unterberger, Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Innsbruck, sprach bei der ÖGN-Tagung über kontroverse Themen, die in der Epilepsiesprechstunde mit Patienten besprochen werden. Die individuelle Betreuung des einzelnen Patienten stehe dabei im Vordergrund, so Unterberger. Daher steht für Unterberger das Prinzip „Zuhören – hinsehen – hinterfragen – wiederholen“ in einem vertrauten Setting bei ausreichenden Zeitressourcen an oberster Stelle, wenn es darum geht, in der Epilepsiesprechstunde heikle Themen, die leicht zu Missverständnissen oder Konflikten führen können, zu besprechen.</p> <p>„Kann ich an Epilepsie sterben?“ Das sei eine dieser heiklen Fragen, die Patienten selten in dieser Art formulieren, die Ärzte in der Sprechstunde mit den Patienten zu klären aber gefordert seien, so Unterberger. Das Risiko, plötzlich und unerwartet vorzeitig zu versterben, ist bei Epilepsiepatienten 20-fach höher als in der Allgemeinbevölkerung. SUDEP („sudden unexpected death in epileptic patients“) zählt neben Unfällen und Status epilepticus sowie tonisch-klonischen Anfällen zu den häufigsten epilepsiebezogenen Todesursachen. Die Inzidenz liegt bei 1,2/1000 Patienten mit chronischer Epilepsie.</p> <p>Die SUDEP-Aufklärung so durchzuführen, dass dem Patienten die Risikofaktoren und vorbeugenden Maßnahmen nähergebracht werden, ohne dass Angst geschürt wird, ist eine besondere Herausforderung. „Die aktuellen Empfehlungen gehen klar in die Richtung, so früh wie möglich über SUDEP aufzuklären. Tools wie SUDEPChecklist können dabei zur Unterstützung herangezogen werden“, erklärte Unterberger. Diese Checkliste ist unter https://sudep. org/checklist abrufbar.</p> <p>Eine weitere wichtige Frage, die immer wieder vor allem von unter medikamentöser Therapie anfallsfreien Epilepsiepatienten gestellt wird, ist jene nach dem Absetzen der Medikation. „Basierend auf bisherigen Studien erleidet circa ein Drittel der anfallsfreien Patienten – egal ob an ihnen ein epilepsiechirurgischer Eingriff vorgenommen wurde oder nicht – nach einem Absetzversuch einen Rückfall. Eine rezente Studie weist nun jedoch darauf hin, dass die Rückfallsrate über die Zeit gemessen weit höher liegt, nämlich zwischen 46 und 48 Prozent“, erörterte Unterberger. Diese Analyse individueller Patientendaten hat acht Prädiktoren für einen Relaps identifiziert. Das individuelle Rezidivrisiko eines Epilepsiepatienten kann anhand dieser Prädiktoren mithilfe eines AE-Risikokalkulators (abrufbar unter http://epilepsypredictiontools.info) ermittelt werden. Unterberger ist überzeugt: „Dieser Risikokalkulator ist ein wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung des Arztes in seiner Betreuungsfunktion und bei der Risiko-Nutzen-Abwägung, wenn ein Absetzversuch angedacht wird. Er kann auch in der Epilepsiesprechstunde recht gut angewendet werden.“</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 15. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für
Neurologie, 21.–23. März 2018, Linz
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Thrombektomie im Zeitfenster zwischen 6 und 24 Stunden: die DAWN-Studie. Springer Medizin InFo Neurologie 2018; 20: 15. doi.org/10.1007/s15005-018-2463-7 <strong>2</strong> Albers GW et al.: Thrombectomy for stroke at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging. N Engl J Med 2018; doi: 10.1056/NEJMoa1713973 <strong>3</strong> Kwan P, Brodie MJ: N Engl J Med 2000; 342: 314-19 <strong>4</strong> Blümckel et al.: N Engl J Med 2017; 377: 1648-56 <strong>5</strong> Jetté N et al.: Lancet Neurol 2016; 15: 982-94 <strong>6</strong> Vakharia VN et al.: Ann Neurol 2018; ahead of print</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...


