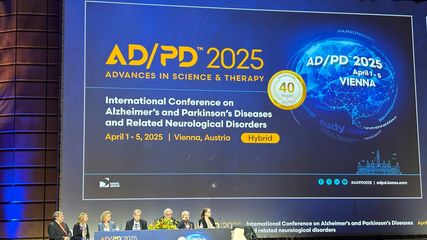Stellenwert von Biomarkern beim Wirbelsäulentrauma
Jatros
Autor:
Dr. Harald Christoph Wolf
Klinik für Unfall-, Wiederherstellungsund Handchirurgie<br> Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Deutschland<br> E-Mail: office@unfallchirurgie-wolf.at
30
Min. Lesezeit
07.07.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Einsatz von Biomarkern als zusätzliche diagnostische Maßnahme bei Frakturen der Wirbelsäule oder bei Verletzungen des Rückenmarks ist derzeit erst mit wenigen klinischen Studien erforscht. Andere Einsatzgebiete wie Therapiemonitoring, Outcomeeinschätzung und die Identifizierung neuer molekularer Therapieansatzpunkte sind derzeit Gegenstand der intensiven Biomarkerforschung.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Bei unklarer (neurologischer) Symptomatik kann S100B eine zusätzliche Information bezüglich Wirbelfraktur und Rückenmarksläsion liefern und die Entscheidung für weiterführende Untersuchungen (CT, MRT) auch bezüglich der Dringlichkeit unterstützen.</li> <li>Aus unserer Erfahrung und den publizierten Daten ist ein Zeitraum für die S100B-Bestimmung von bis zu 24 Stunden nach dem Unfall möglich.</li> <li>NSE hat sich als nicht nützlich beim Wirbelsäulentrauma erwiesen.</li> <li>Die Verwendung von microRNAs stellt einen vielversprechenden Ansatz zur zukünftigen Diagnostik und Therapie von Rückenmarksverletzungen dar.</li> </ul> </div> <p>Die Verwendung von Biomarkern zur Verfeinerung der Diagnostik hat sich beim Schädel-Hirn-Trauma im klinischen Alltag etabliert. Viele nationale und internationale Studien belegen die Nützlichkeit, vor allem des glialen Markers S100B. Die Indikation zur akuten kraniellen Computertomografie (CCT) lässt sich mithilfe der Biomarker S100B, GFAP, UCH-L1 etc. untermauern.<br /> Vor rund 6 Jahren wurden die ersten Studien publiziert, die versuchten, die Erkenntnisse aus der Schädel-Hirn-Trauma(SHT)-Forschung in die Wirbelsäulentraumatologie zu übersetzen (Lee et al 2010, Marquardt et al 2011). Wie in <em>JATROS Unfallchirurgie & Sporttraumatologie</em> 3/2015 berichtet, konnten wir in einer Studie einen deutlichen Zusammenhang sowohl zwischen erhöhten S100B-Serumwerten und Wirbelkörperfrakturen als auch zwischen S100B-Werten und Rückenmarksverletzungen feststellen. Der Biomarker S100B kann daher von diagnostischem Wert bei akuten Wirbelfrakturen mit und ohne neurologische Symptomatik sein.<br /> Die Arbeit von Lee et al zeigte erstmals an 32 Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen, dass sowohl bei Frakturen als auch bei Rückenmarksverletzungen die S100B-Werte signifikant erhöht sind. Die Autoren schlussfolgerten, dass S100B ein Akutmarker für Frakturen der Wirbelkörper ist und auch dazu dienen kann, einfache Wirbelfrakturen bei vorliegendem, negativ befundetem Wirbelsäulenröntgen auszuschließen.<br /> Marquardt et al untersuchten bei Patienten mit spondylotischer zervikaler Myelopathie die postoperativen S100B- und NSE-Verläufe. Es fanden sich statistisch signifikante S100B-Werte für die Subgruppe von Patienten, bei denen es zu einer postoperativen neurologischen Verschlechterung kam. Wenn bei diesen Patienten eine Normalisierung der S100B-Werte am dritten postoperativen Tag beobachtet wurde, konnte ein günstiges Outcome gut mit S100B korreliert werden. Die NSE-Werte zeigten keine Signifikanz.<br /> Dieselbe Arbeitsgruppe hat eine tierexperimentelle Studie mit dem Ziel, S100B als Outcomeparameter zu überprüfen, durchgeführt. Bei Kaninchen wurde eine Querschnittsläsion erzeugt; anschließend wurden die S100B- und NSE-Serumwerte seriell gemessen. Bei den Versuchstieren mit gutem Outcome normalisierten sich die S100B-Werte innerhalb von 2 Tagen. Es zeigte sich eine gute Korrelation zwischen den S100B-Werten und dem Outcome. NSE zeigte auch hier keine signifikante Korrelation.<br /> In einer kürzlich fertiggestellten Studie konnten wir zeigen, dass operative Eingriffe bei Frakturen der Wirbelsäule und bei Frakturen der unteren Extremitäten (Messungen prä- und postoperativ) auch zu einer Auslenkung der S100B-Werte führen. Wir schlussfolgerten, dass S100B als Outcomeparameter bei Patienten nach einer Operation hinterfragt werden muss. Die NSE-Werte waren durch die Operation nicht beeinträchtigt, sodass zumindest nach SHT eine sicherere Outcomeprognose denkbar wäre.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite39.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Neue Ansätze der Forschung</h2> <p>Die Einbindung von Micro-RNA-Mole-külen (miRNAs) in die Biomarkerforsch-ung und Neurotraumatologie ist ein neuer wissenschaftlicher Ansatz. miRNAs sind kurze Nukleotide von nicht kodierender regulatorischer RNA, die die posttranskriptionelle Proteinexpression regelt. Sie inhibieren mRNA-Translation oder induzieren mRNA-Degradation. Sie können hilfreich sein, um eine krankheitsspezifische und gewebsspezifische Proteinexpression zu identifizieren, und sind leicht im Serum nachzuweisen.<br /> Beginnend mit der Untersuchung des potenziellen Nutzens von miRNAs in der Myokardinfarktdiagnostik haben sich in der SHT-Forschung weitere interessante Ergebnisse gezeigt. Die Studie von Redell et al fand, dass eine Erniedrigung der Plasmawerte von miR-16 und miR-92a sowie ein Anstieg von miR-765 gute Marker für das Vorliegen eines schweren SHT, gemessen innerhalb von 24–48 Stunden, waren. Bei Patienten mit leichtem SHT waren die Plasmawerte der miR-765 innerhalb von 24 Stunden nach dem Unfall unverändert, jedoch die miR-92a- und miR-16-Werte signifikant erhöht.<br /> Im Bereich der Wirbelsäulenforschung finden sich einige interessante kürzlich erschienene Arbeiten. Eine tierexperimentelle Studie (Hu et al 2015) mit Ratten zeigte, dass bei traumatischen Querschnittsläsionen, die mit intrath-ekaler Verabreichung von miR-126 über 7 Tage behandelt wurden, deutliche motorische Verbesserungen zu erkennen waren. Dies wurde auf eine verbesserte Neoangiogenese durch miR-126 und auf eine verminderte Inflammation zurückgeführt. Die Effekte von miR-126 wurden durch eine direkte Wirkung (Verminderung) auf die Zielgenexpression von SPRED1, PIK3R2 und VCAM1 erklärt.<br /> Eine weitere neue Studie (Boon et al) untersuchte Muskelbiopsien von Patienten mit Querschnittsläsionen und von Ratten. Es wurde bei den Patienten eine verringerte Expression von microRNA-208b und microRNA-499-5p nach Querschnittsläsion gefunden. Analog wurde eine inverse Reaktion der Myostatin-Genexpression gefunden. Daraus wurde geschlussfolgert, dass die Muskelatrophie von Querschnittspatienten auf die verminderte Expression von microRNA-208b und microRNA-499-5p zurückführbar sein könnte.<br /> Eine weitere tierexperimentelle Studie (Li et al) untersuchte den Effekt von intrathekaler miR-27a-Injektion nach Ischämie/Reperfusionsläsion des Rückenmarks. Sie zeigte eine deutliche Zunahme der Entzündungsreaktion und Leckage der Blut-Rückenmark-Schranke nach Injektion von miR-27a. Ein therapeutischer Ansatzpunkt konnte hiermit gefunden werden, z.B. die Verwendung von Antagonisten (sog. Anti-miRs) gegen endogene miRNA. Diesen Ansatz hat auch die Studie von Liu et al: Es wurde bei Ratten nach Rückenmarksverletzung eine erhöhte Expression von miR-223 gefunden. Eine Antagonisierung von miR-223 zeigte eine verbesserte Hinterlaufmotorik, eine Abschwächung der Apoptose und eine verbesserte Neoangiogenese.<br /> Die microRNA miR-21 scheint wiederum protektive Effekte zu haben. Hu et al fanden, dass eine Antagonisierung von endogener miR-21 bei Ratten nach Rückenmarksverletzung zu einer abgeschwächten neurologischen Erholung, zu einer Vergrößerung der Rückenmarksläsion und zu einer Verstärkung der Apoptose führt. Generell zeigen sich bei microRNA-Messungen nach Rückenmarksverletzung folgende mögliche Expressionsmuster: Aufregulation, Abregulation und frühe Aufregulation nach 4 Stunden, gefolgt von einer Abregulation am 1. und 7. Tag nach der Verletzung.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>• Wolf H et al: Alterations of the biomarker S-100B and NSE in patients with acute vertebral spine fractures. Spine J 2014; 14(12): 2918-22<br />• Wolf H et al: Preliminary findings on biomarker levels from extracerebral sources in patients undergoing trauma surgery: potential implications for TBI outcome studies. Brain Injury; accepted March 24th 2016<br /><br />Weitere Literatur beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...