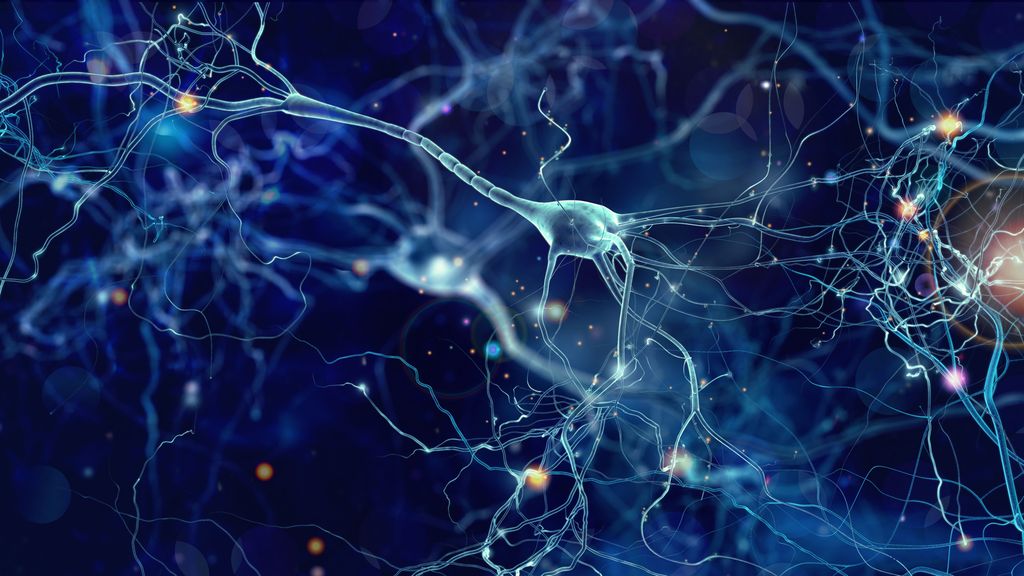
©
Getty Images/iStockphoto
Schlaganfall – keine Frage des Alters
Jatros
Autor:
Dr. Gabriele Senti
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Zahl jener, die bereits in jungen Jahren – also vor dem 50. Lebensjahr – von einem Schlaganfall betroffen sind, ist weltweit im Steigen. Bei der ESOC in Prag war diesem Thema eine Session gewidmet, in der neue Ergebnisse zu Untersuchungen junger Schlaganfallpatienten präsentiert wurden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Suboptimaler Einsatz der Sekundärprävention nach Schlaganfall</h2> <p>Fast jeder zweite Schlaganfallpatient im Alter von 18 bis 50 Jahren erlebt ein rezidivierendes Gefäßereignis. Obwohl etwa ein Drittel aller Schlaganfälle bei jüngeren Patienten eine unbekannte Ursache hat, spielt in den verbleibenden zwei Dritteln die Atherosklerose oft eine Rolle. Dieser Umstand bietet Ansatzmöglichkeiten zur Sekundärprävention.<br />Van Dongen et al. untersuchten die Verschreibung einer medikamentösen Sekundärprävention nach einem Schlaganfall bei einer größeren Anzahl junger Erwachsener (FUTURE Study). In die Studie eingeschlossen waren 656 Patienten im Alter von 18 bis 50 Jahren, die einen ischämischen Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke erlitten hatten. Analysiert wurde jener Anteil der Patienten, die nach dem Schlaganfall eine Sekundärprävention erhielten.<br />Der Anteil jener, die mit Statinen behandelt wurden, stieg zwischen den Jahren 2000 und 2010 auf 51,8 % an. Der Anteil der Antihypertensiva-Einnahmen erhöhte sich von 16,1 % (1980–1989) auf 29,2 % (2000–2010) und die Verwendung von Thrombozyten-Inhibitoren von 63,6 % auf 80,1 % . Trotzdem blieben auch weiterhin vier von fünf jungen Schlaganfallpatienten ohne Sekundärprävention. Dies bietet die Möglichkeit zur weiteren Reduzierung von rezidivierenden vaskulären Ereignissen bei jungen Schlaganfallpatienten (AS28-034).</p> <h2>Thrombolyse und Thrombektomie bei Kindern mit AIS</h2> <p>Intravenöse Thrombolyse (IVT) und/oder endovaskuläre Therapie (ET) sind evidenzbasierte Behandlungsmöglichkeiten bei Erwachsenen mit einem akuten ischämischen Schlaganfall (AIS) – randomisierte kontrollierte Studien bei pädiatrischen Patienten fehlen. Eine schweizerische Studie bewertete nun Durchführbarkeit, Sicherheit und Ergebnis von IVT und ET bei Kindern mit AIS.<br />Die retrospektive Studie (2000–2015) untersuchte eine multizentrische, prospektive Kohorte von Patienten im Alter von einem Monat bis 16 Jahren, bei welchen ein AIS innerhalb von zwölf Stunden nach Symptombeginn diagnostiziert wurde. Die klinischen und radiologischen Daten jener Patienten, die sich einer IVT oder ET unterzogen, wurden mit denen verglichen, die eine Standardpflege (SOC) erhielten. Die Ergebnisse wurden sechs Monate nach dem Schlaganfall anhand des Paediatric Stroke Outcome Measure (PSOM) beurteilt.<br />Von 216 pädiatrischen AIS-Patienten wurden 81 innerhalb von 12 Stunden nach Symptombeginn diagnostiziert. 4 (5 % ) Patienten erhielten IVT und 11 (14 % ) ET. Patienten, die IVT/ET erhielten, waren älter (mittleres Alter 11,4 vs. 7,5 Jahre; p=0,01) und stärker betroffen (medianer pedNIHSS-Wert 13,0 vs. 7,0; p<0,001). Todesereignisse und Blutungskomplikationen unterschieden sich nicht zwischen den beiden Gruppen, jedoch waren Patienten, die IVT/ET erhielten, eher von Schlaganfall-bezogenen Komplikationen (p=0,017) betroffen. Die medianen (IQR) PSOM-Werte 6 Monate nach einem AIS lagen in der IVT/ET-Kohorte bei 2,0 (1–3,4) und in der SOC-Kohorte bei 1,0 (0–1,75) (p=0,034). Aus diesen Ergebnissen schließen die Studienautoren, dass IVT und ET durchführbare und sichere Behandlungsoptionen bei schwer betroffenen pädiatrischen AIS-Patienten darstellen (AS28-020).</p> <h2>Kortikosteroidbehandlung verbessert Ergebnis nach FCA</h2> <p>Die fokale zerebrale Arteriopathie (FCA) ist die Ursache bei bis zu 35 % der arteriellen ischämischen Schlaganfälle bei Kindern und ein wichtiger Prädiktor für ein Schlaganfallrezidiv. Forscher aus Bern und Melbourne untersuchten Kinder mit FCA und verglichen jene, die mit einer Kombination aus Kortikosteroid- und antithrombotischer Therapie (CAT) behandelt wurden, mit jenen, die eine antithrombotische Behandlung (AT) allein erhielten.<br />Diese multizentrische retrospektive Kohortenstudie analysierte Kinder im Alter von einem Monat bis 18 Jahren, die von 1999 bis 2014 mit einem ersten AIS aufgrund einer FCA vorstellig wurden. Primäres Ergebnis waren bleibende neurologische Defizite 6 Monate nach dem AIS, sekundäre Ergebnisse beinhalteten die Auflösung von Stenosen und rezidivierende Schlaganfallereignisse.<br />73 Kinder (51 % männlich) wurden identifiziert, 21 (29 % ) davon erhielten CAT. Das mittlere Alter zum Zeitpunkt des Schlaganfalls für die gesamte Gruppe war 7,9 Jahre (SD 4,7). Der mediane pedNIHSS-Wert lag bei 3 (IQR 2,0–8,0) in der CAT-Gruppe und bei 5 (IQR 3,0–9,0) in der AT-Gruppe (p=0,098). Der mediane PSOM-Wert 6 Monate nach AIS lag bei 0,5 (IQR 0–1,5) in der CAT-Gruppe, verglichen mit 1,0 (IQR 0,5–2,0) in der AT-Gruppe (p=0,035). Eine vollständige Auflösung der Stenose bei der letzten MRT wurde bei 17 Patienten (81 % ) in der CAT-Gruppe verglichen mit 24 Patienten (59 % ) in der AT-Gruppe (p=0,197) festgestellt. Wiederkehrende Schlaganfallereignisse wurden bei je einem Patienten in jeder Gruppe verzeichnet. Die Studienautoren resümieren, dass eine zusätzliche Kortikosteroidbehandlung gegenüber der isolierten antithrombotischen Behandlung zu einem Vorteil führt, um das neurologische Ergebnis juveniler AIS aufgrund einer FCA zu verbessern (AS28-007).</p> <h2>Kognitive Dysfunktion bei jungen Schlaganfallpatienten</h2> <p>Die Prävalenz von jungen Patienten (55 Jahre und jünger), die einen Schlaganfall erleiden, nimmt weltweit zu. Studien, die die Prävalenz von kognitiven Defiziten nach einem Schlaganfall bei jungen Patienten beurteilen, sind selten. Pinter et al. analysierten die Prävalenz und den Verlauf der kognitiven Dysfunktion in einer Stichprobe von jungen Schlaganfallpatienten bei der Krankenhausaufnahme (Baseline, BL) und beim 3-Monats-Follow-up (FU).<br />Von Februar bis November 2016 wurden 54 junge Patienten (59 % Männer, mittleres Alter 44,7+/–8,2 Jahre) mit einem ischämischen (90,7 % ) oder hämorrhagischen Schlaganfall (9,3 % ) untersucht. In diesem Zeitraum nahmen 27 Patienten an der FU-Bewertung teil. Bei BL konnten Defizite (definiert durch 1,5 Standardabweichungen unterhalb des standardisierten Mittels) in der allgemeinen kognitiven Funktion (56,6 % ), der Verarbeitungsgeschwindigkeit (61,5 % ), der Aufmerksamkeit (42,3 % ), der Exekutivfunktion (44,2 % ) und der Wortflüssigkeit (33,3 %) festgestellt werden. In den meisten Bereichen blieb die kognitive Leistungsfähigkeit bis zum FU stabil, mit Ausnahme der Verbesserungen der allgemeinen kognitiven Funktion, der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Aufmerksamkeit. Bei etwa einem Drittel der Patienten waren auch drei Monate nach dem Schlaganfall noch beträchtliche kognitive Defizite vorhanden (allgemeine kognitive Funktion: 29,6 % , Exekutivfunktion: 33,3 % , Wortfluss: 30,2 % ).<br />Die hohe Prävalenz und in der Regel fehlende Verbesserung der kognitiven Defizite bis zu einem kurzfristigen FU bei jungen Schlaganfallpatienten heben die Bedeutung der kognitiven Bewertung in der Zeit nach dem Schlaganfall hervor. Mögliche Implikationen dieser Defizite (z.B. reduzierte Lebensqualität, Schwierigkeiten bei der Rückkehr zur Arbeit) machen die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen einschließlich der Entwicklung gezielter kognitiver Rehabilitationsstrategien deutlich (AS28-013).</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 3rd European Stroke Organisation Conference, 16. bis 18. Mai 2017, Prag
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...


