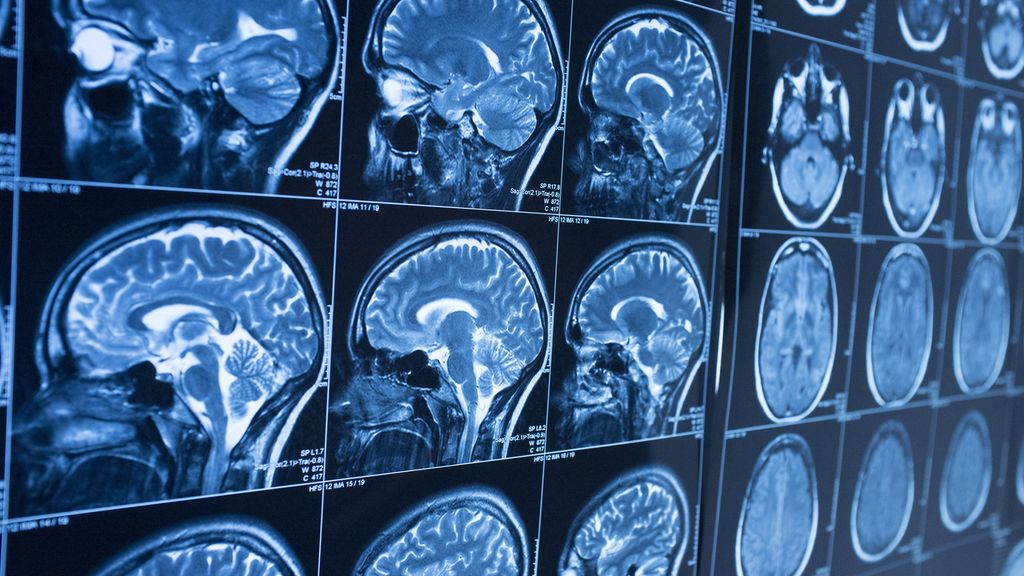
©
Getty Images/iStockphoto
Morbus Huntington – ein Überblick
Jatros
Autor:
Prim. Dr. Christoph Stepan, MSc
Rehaklinik Wien Baumgarten Betriebs-GmbH<br> Wien<br> E-Mail: christoph.stepan@rehawienbaumgarten.at
30
Min. Lesezeit
12.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Morbus Huntington ist eine autosomal dominante neurodegenerative Erkrankung. Das wichtigste Ziel ist es, den Patienten möglichst lange am täglichen Leben teilnehmen zu lassen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Es ist wichtig, frühzeitig mit der nicht medikamentösen Therapie zu beginnen.</li> <li>Die Behandlung kann nur in einem multiprofessionellen Team erfolgen.</li> <li>Ziel ist es, den Patienten möglichst lange in einem selbstständigen Leben zu halten.</li> </ul> </div> <p>Die Prävalenz beträgt 10 – 13/ 100 000 in Europa. Mit einem Krankheitsbeginn ist im Alter zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr zu rechnen. Die typische Klinik der Erkrankung besteht aus hyperkinetischer Bewegungsstörung, psychischen Störungen und kognitiven Abbauprozessen.<br /> Ursache ist eine CAG-Repeater-Expansion im Huntingtongen am Chromosom 4. Durch diese Schädigung kommt es zu einer Produktion eines mutierten Huntingtonproteins. Dieses Protein hat eine abnorm lange Polyglutamin-Repeater-Anzahl. Ab einer Zahl von 40 CAG-Repeatern kommt es zum Auftreten der Erkrankung. Man spricht von einer kompletten Penetration (Tab. 1).<br /> Interessant ist, dass bei Patienten mit gleicher CAG-Repeater-Zahl das Auftreten der Erkrankung nicht zum gleichen Zeitpunkt beginnt. Es konnte beobachtet werden, dass der Unterschied des Erkrankungsbeginns bis zu 25 Jahre betragen kann. Dies deutet auf genetische Einflussfaktoren hin, die aktuell noch nicht beschrieben werden konnten. Eine unauffällige Familienanamnese bei Patienten mit M. Huntington schließt eine erbliche Form nicht aus. Bei diesen kann es durch eine Spontanmutation (Erhöhung von 27 – 39 CAG-Repeatern auf ≥ 40) zu einem Ausbruch der Erkrankung kommen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1904_Weblinks_tab1.jpg" alt="" width="550" height="155" /></p> <h2>Diagnose</h2> <p>Bei der Untersuchung von Patienten mit choreatiformen Bewegungsstörungen ist die Anamnese (inklusive Familienanamnese und Medikamentenanamnese) ein wichtiger Faktor. Die Durchuntersuchung sollte neben einer neurologischen auch eine internistische beinhalten. Zusätzlich sollten ein neuropsychologischer Status sowie eine Bildgebung des zentralen Nervensystems erfolgen. Um einen eindeutigen Befund erheben zu können, ist eine molekulargenetische Untersuchung unumgänglich. Bei dieser wird die CAG-Wiederholung des Huntingtongens auf dem Chromosom 4 beurteilt.<br /> Wichtig ist bei choreatiformer Bewegungsstörung andere zugrunde liegende Ursachen auszuschließen:</p> <ul> <li>Autoimmun und paraneoplastisch bedingte choreatische Syndrome</li> <li>Infektiöse Ursachen</li> <li>Strukturelle Läsionen im Bereich der Basalganglien</li> <li>Metabolische, endokrine und toxische Ursachen</li> <li>Medikamentös oder drogeninduzierte Ursachen</li> <li>Andere Ursachen</li> </ul> <h2>Genetische Untersuchung</h2> <p>Die Bestimmung der CAG-Repeater- Länge kann zur differenzialdiagnostischen Untersuchung unter Angabe der Krankheitssymptome, nach Aufklärungsgespräch und schriftlicher Einwilligung durch den Arzt durchgeführt werden. Die genetische Untersuchung ist durch das Gentechnikgesetz geregelt. Patienten müssen auf ihre Rechte, z. B. das Recht auf Widerruf der Einwilligung, hingewiesen werden. In Österreich dürfen genetische Untersuchungen zur Feststellung von genetischen Erkrankungen nur im Rahmen einer genetischen Beratung vom Facharzt aus dem jeweiligen Indikationsgebiet beziehungsweise von einem Facharzt für Humangenetik veranlasst werden. Bei der Aufklärung sind die Aufklärungsrichtlinien der International Huntington Association zu befolgen. Sie schließen neben einer genetischen Beratung auch eine psychologische Beratung mit ein.<br />Die prädiktive Diagnostik setzt Einwilligungsfähigkeit und Volljährigkeit voraus. Zwischen der ersten Beratung und der Durchführung der genetischen Untersuchung sollte ein angemessener zeitlicher Abstand von mindestens vier Wochen liegen. Patienten sollen bis zur Befundmitteilung der prädiktiven Testung widerrufen können. Dieses Verfahren schließt im Allgemeinen ein, dass auch der Beratende bis zur Befundmitteilung nicht über das Ergebnis informiert sein sollte und den Laborbefund im verschlossenen Umschlag erhält, um eine unvoreingenommene Besprechung zu ermöglichen.<br />Die Ergebnisse genetischer Untersuchungen dürfen nur der untersuchten Person persönlich und nur durch den untersuchenden Arzt mitgeteilt werden. Eine spätere Weitergabe der Befunde darf nur mit einer schriftlichen Erlaubnis erfolgen.</p> <h2>Klinik</h2> <p>Bereits 12–15 Jahre vor dem diagnostischen Beginn können im Gehirn Veränderungen nachgewiesen werden. Diese führen zu subtilen Symptomen im Bereich Motorik, Kognition und Verhalten. Die klinische Manifestation konnte in der Beobachtungsstudie TRECK HD gezeigt werden. Hier wurden Patienten über 36 Monate in ihrem klinischen Verlauf beobachtet.<br /> Choreatiforme Bewegungsstörungen sind charakterisiert durch unwillkürliche, rasche, unregelmäßige und nicht vorhersehbare Bewegungen aller Körperregionen. Sie können sowohl in Ruhe als auch bei willkürlichen Bewegungen auftreten. Interessant ist, dass diese vom Patienten oft nicht als störend empfunden werden. Bewegungsstörungen können sowohl hyperkinetisch als auch hypokinetisch (Spätphase der Erkrankung) sein. In beiden Phasen treten Gleichgewichts- und Gangstörungen auf. Die hypokinetische Phase (z. B. Bradykinese, Dystonie) zeigt eine Korrelation mit der Dauer der Erkrankung.<br /> Sowohl kognitive als auch neuropsychiatrische Störungen können bereits einige Jahre vor dem Auftreten der ersten motorischen Symptome auftreten. Kognitive Symptome sind durch eine Beeinträchtigung des emotionalen Erkennens, der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit und der exekutiven Funktionen charakterisiert. Neuropsychiatrische Symptome können sehr unterschiedlich sein. Sie reichen von Apathie, Ängstlichkeit, Depression, impulsivem Verhalten bis zu Psychosen.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Die Betreuung muss durch ein multiprofessionelles Team erfolgen. Das Team besteht aus Ärzten, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Neuropsychologen und Pflegepersonen. Dies beinhaltet eine Kombination von pharmakologischen und nicht pharmakologischen Behandlungen. Das Ziel ist die Unterstützung bei der Anpassung an den Krankheitsverlauf und damit verbunden die Verbesserung der Lebensqualität.<br /> Bezüglich der medikamentösen Therapie ist aktuell von einer Behandlung der Symptome zu sprechen. Zur Behandlung der motorischen Symptome stehen Tetrabenazin und in weiterer Folge Deutetrabenazin zur Verfügung. Auch für Risperidon und Quetiapin werden positive Effekte für die Motorik beschrieben. Zur Behandlung von psychiatrischen Symptomen liegt eine geringe Evidenz bezüglich der zu verwendenden Medikamente vor. Die durchgeführten Studien sind zumeist von einer niedrigen Patientenzahl gekennzeichnet.<br /> Neben der medikamentösen Therapie sind rehabilitative Maßnahmen von großer Wichtigkeit. So zeigt sich zum Beispiel, dass regelmäßiges Ausdauer- und Krafttraining einen positiven Effekt auf die Neuroprotektion und die klinische Symptomatik hat. Dieser Effekt wird durch einen Anstieg von BDNF („brain-derived neurotrophic factor“) im Gehirn verursacht. Dieser BDNF-Anstieg wird durch die Freisetzung von Irisin durch Muskeltraining eingeleitet.<br /> Neben diesem Punkt ist es wichtig, frühzeitig mit einem Training zu beginnen. Es ist daher sinnvoll, bei Diagnosestellung eine klinische Durchuntersuchung, die auch eine Befundung durch Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Neuropsychologie beinhaltet, durchzuführen. Auf Basis dieser Befunde kann ein Trainingskonzept für die Patienten erstellt werden (Tab. 2). Eine jährliche Evaluierung und Anpassung des Trainingsprogramms sind empfehlenswert. Durch dieses Vorgehen können Defizite reduziert werden und der Patient kann möglichst lange in einem selbstständigen Leben gehalten werden. Denn die Beeinträchtigung der körperlichen Funktion ist oft mit dem Verlust des Arbeitsplatzes vergesellschaftet. Dies hat massiven Einfluss auf die Lebensqualität.<br /> Ziel der Behandlung ist daher, die Belastung durch die Symptome zu reduzieren, die Funktion zu maximieren und sicherzustellen, dass der Patient sich der Zukunftsentwicklung bewusst ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1904_Weblinks_tab2.jpg" alt="" width="895" height="700" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Schwelend-fortschreitende Multiple Sklerose
Dank innovativer immunmodulierender und krankheitsmodifizierender Medikamente sind Schübe heute oftmals vermeidbar und Patient:innen, die heute die Diagnose MS erhalten, haben eine ...
Parkinson: Früherkennung – der nächste Meilenstein für Forschung und Therapie
Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Schätzungsweise 30000 Menschen sind in der Schweiz betroffen. Dr. med. Ines Debove ist stellvertetende Leiterin des ...
«Das ausgehende Jahrtausend war sehr prägend für die MS-Forschung»
In kaum einem Bereich der Neurologie wurden in den vergangenen 30 Jahren so viele Medikamente entwickelt wie gegen Multiple Sklerose (MS). Die Lebensqualität der Patient:innen hat sich ...


