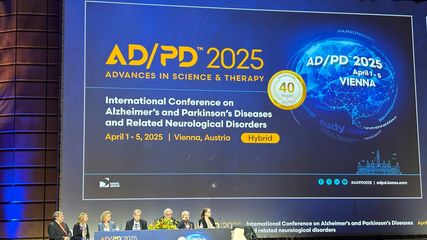©
Getty Images/iStockphoto
Mit neuen Medikamenten und neuen Biomarkern auf dem Weg zur individualisierten MS-Therapie
Jatros
Autor:
Dr. Ludger Riem
Medizinjournalist<br/> <br/> Quelle:<br/> 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis,<br/> 7.–10. Oktober 2015, Barcelona
30
Min. Lesezeit
10.12.2015
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In der MS-Therapie stehen Neurologen neuerdings immer mehr therapeutische Optionen zur Verfügung. Zumindest bei den schubförmig remittierenden Verlaufsformen umfasst die Palette in vielen Ländern bereits heute ein gutes Dutzend entsprechender Medikamente. Prall gefüllte Forschungspipelines versprechen schon in absehbarer Zeit nochmals kräftigen Zuwachs. „One pill fits all“ – diesem historischen Ansatz hat Prof. Dr. Xavier Montalban, Präsident und Tagungsleiter des 31. Jahreskongresses des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) in Barcelona, nun endgültig einen Platz im Bereich der Medizingeschichte zugewiesen. Die Hoffnung auf eine individualisierte, auf spezifische Patientenbedürfnisse zugeschnittene Therapie wird nach den Worten Montalbans inzwischen ganz massgeblich auch durch Fortschritte auf dem Feld der Biomarker genährt. Für eine Aufbruchstimmung haben in diesem Jahr nicht zuletzt auch die von Montalban vorgestellten Ergebnisse der ORATORIO-Studie gesorgt. Die in Barcelona präsentierten Daten zeigen nun erstmals auch für Patienten mit (primär) progressiven Verlaufsformen konkrete therapeutische Perspektiven auf.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Mit gut einer halben Million betrof­fe­ner Patienten zählt die multiple Sklerose (MS) in den Ländern der Eu­ro­- päischen Union (EU) zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen über­haupt. Betroffen sind vor allem Frauen; bei diesen wird die Erkrankung zumeist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr diagnostiziert. Im jungen Erwachsenenalter ist die MS eine der häufigsten Ursachen einer gravierenden (körperlichen) Behinderung und belastet die Gesundheitssysteme Jahr für Jahr mit Kosten in einer Größenordnung von circa 15 Milliarden Euro.<sup>1</sup><br /> Insbesondere mit den Möglichkeiten der modernen Bildgebung ist es inzwischen zwar möglich, die (Verdachts-)Diagnose einer MS immer frühzeitiger zu stellen. Eine Frage, die die Ärzte ihren MS-Patienten etwa nach dem ersten Schub einer RRMS (schubförmig remittierend verlaufende MS) jedoch nach wie vor nicht präzise be­antworten können, ist die nach der wei­teren Prognose. Das könnte sich mit der Entwicklung und Etablierung neuer Biomarker zukünftig ändern, zeigte sich Montalban optimistisch. „Die Pro­gnose eines individuellen Pa­tienten zu verstehen, die für ihn optimale Therapie auszuwählen, die Wirkungen und Nebenwirkungen einer Substanz bei dieser einzelnen Person vorauszusagen ist nicht leicht. Aber wir haben zunehmend Daten, einschließlich neuer Ergebnisse zu Biomarkern und anderen Prädiktoren, die uns dabei unterstützen.“</p> <h2>Prädiktive Liquordiagnostik</h2> <p>So hat eine Arbeitsgruppe um Mont­alban und Kollegen beim diesjährigen ECTRIMS etwa ein neues Testverfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe sich vergleichsweise präzise vorhersagen lassen soll, ob bei Patienten mit einem klinisch isolierten Syndrom (CIS) im weiteren Verlauf mit einer MS- Manifestation zu rechnen ist. Das Verfahren basiert auf der massenspek­trometrischen Bestimmung bestimmter Liquorproteine. In ihren Untersuchun­gen nahmen die Neurologen den Liquor von 25 CIS-Patienten, die in der Folge eine klinisch gesicherte MS (CDMS) entwickelt hatten, unter die Lupe und verglichen ihn mit dem Liquor von weiteren 25 CIS-Patienten ohne nachfolgende MS-Manifestation. Unter 24 als prognostisch relevant eingestuften Proteinen erwies sich demnach der kombinierte Nachweis von zweien dieser Proteine mit vergleichsweise hoher Spezifität und Selektivität (AUC=0,86) als aussagekräftiger Prädiktor für den zu erwartenden klinischen Verlauf bei CIS-Patienten – sprich für die Wahrscheinlichkeit einer späteren CDMS.<sup>2</sup><br /> <br /> Als prognostisch ungünstiger Biomarker hat sich bei CIS-Patienten den Ergebnissen einer großen multinationalen, longitudinalen Kohortenstudie zufolge auch der alleinige Nachweis von CHI-3L1 (Chitinase 3-like 1) im Liquor erwiesen.<sup>3</sup> Eben dieser Biomarker war bei insgesamt 813 Patienten mit isolierten neurologischen Syndromen (CIS) bestimmt worden. Mit den CHI- 3L1-Spiegeln stieg die Wahrscheinlichkeit einer CDMS-Konversion. Zudem erwies sich dieser Biomarker als unabhängiger Risikofaktor für die Entwicklung einer Behinderung (HR: 3,8).<br /> <br /> Auch mittels Sequenzierung von RNA, micro-RNA oder DNA lassen sich offenbar aussagekräftige Biomarker zur Ermittlung der Krankheitsaktivität gewinnen. In Untersuchungen von Co­mabella et al wurden zunächst DNA-Proben und im Blut zirkulierende mononukleäre Zellen von 12 gesunden Kontrollpersonen und 44 unbehandelten MS-Patienten gesammelt – darunter 11 Patienten mit benignem Verlauf (EDSS-Score 15 Jahre nach Erstdiagnose <3,0), 10 RRMS-Patienten mit frühzeitigen erneuten Schüben innert 5 Jahren nach Erstdiagnose, 12 Patien­ten mit sekundär progressivem (SPMS) und 11 mit primär progressivem (PPMS) Verlauf.<sup>4</sup> Die mittels aufwendiger Sequenzierungsverfahren erfolgten Analysen brachten unter anderem folgen­de Ergebnisse: Bei MS-Patienten mit eher benignem Verlauf (s.o.) fand sich eine signifikante Überexpression von HSPA1B, einem für bestimmte Hitze­schockproteine kodierenden Gen (adjustierter p-Wert <0,05). Patienten mit primär progressiven Verlaufsformen wiesen hingegen eine Up-Regulation solcher Gene auf, die durch proentzündliche Zytokine wie Interleukin-1 beta oder IL-6 induziert werden (p<0,01). Bei Patienten mit frühen Schüben (RRMS) wurde eine Überex­pression von microRNA 132 (hsa-miR-132) nachgewiesen, welche mit einer signifikanten Down-Regulation von HBEGF („heparin-binding EGF-like growth factor“) vergesellschaftet war (p<0,05). Abgesehen von der potenziellen Bedeutung in Hinblick auf neue Biomarker sind die in Barcelona vorgestellten Daten nach Einschätzung Comabellas und Kollegen nicht zuletzt ein Hinweis darauf, dass den unterschiedlichen Verlaufsformen der MS auch unterschiedliche molekulare Pathomechanismen zugrunde liegen. Auch diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit einer für bestimmte Patientenbedürfnisse (und Pathomechanismen) maßgeschneiderten, indi­vidualisierten Therapie.</p> <h2>Bildgebung als Prädiktor für Krankheitsverlauf</h2> <p>Praxistaugliche Prädiktoren für die zu erwartende Behinderungsprogression und/oder das Ansprechen auf eine MS-Therapie könnten sich nach Einschätzung Montalbans auch mithilfe moderner bildgebender Verfahren gewinnen lassen. In diesem Sinn hat der Neurologe nun auch aktuelle Analysen aus dem Datenpool der INFORMS-Studie interpretiert, in deren Rahmen das Ausmaß von zerebralen und spinalen Volumenverlusten bei Patienten mit primär progressiven Verlaufsformen der MS (PPMS) unter der Behandlung mit Fingolimod mit klinischen Parametern in Bezug gesetzt worden ist.<sup>5</sup> Im Rahmen des dreijährigen Beobachtungszeitraums kam es in Verum- und Placebogruppe gleichermaßen zu einer kontinuierlichen Zunahme der zerebral und spinal gemessenen Atrophie. Die Tatsache, dass das Ausmaß dieser Atrophie mit klinischen Parametern wie der Behinderungsprogression korrelierte, ist ein Hinweis darauf, dass die Ergebnisse einer entsprechenden Bildgebung als sinnvolle Surrogatmarker genutzt werden können.</p> <h2>Kognitive Funktion und funktionelle Konnektivität</h2> <p>Ein weiterer beim diesjährigen ECTRIMS breit diskutierter potenziell praxistauglicher Prädiktor für die Krankheitsprogression ist die kognitive Funktion.<sup>6</sup> „Die kognitive Funktion, MS-bezogene strukturelle Schädigungen von Hirnmasse, funktionelle Konnektivität und die Selbsteinschätzung der Patienten bezüglich ihres Gesundheitszustands erweisen sich bei Patienten mit schubförmig remittierender MS als Prädiktoren für das Fortschreiten der Behinderung“, berichtete Montalban. Es könne sich mit anderen Worten also als zweckmäßig erweisen, die kognitive Funktion und die Selbsteinschätzung der Patienten in Bezug auf ihre physische Gesundheit im klinischen Alltag routinemäßig zu erheben und damit wertvolle Informationen für Krankheitsverlauf und -management zur Hand zu haben.</p> <h2>ORATORIO bei PPMS: Licht am Ende des Tunnels?</h2> <p>Anders als bei der schubförmig remit­tierend verlaufenden MS, für die bereits heute eine ganze Reihe von krankheitsmodifizierenden Medikamenten verfügbar ist, stehen Ärzte bei ihren Patienten mit primär (wie auch sekundär) progressiven Verlaufsformen bislang eher mit dem Rücken zur Wand. Warum diese progressiven Verlaufsformen so herausfordernd sind, hat der Londoner Neurologe Prof. Dr. med. Alan Thompson bei der diesjährigen „ECTRIMS Lecture“<sup>7</sup> wie folgt auf den Punkt gebracht:</p> <ul> <li>Progressive Verlaufsformen der MS betreffen früher oder später jeden zweiten der insgesamt rund 2,3 Mio. MS-Patienten.</li> <li>Der Progressionsbeginn ist die wesentliche Determinante für den Weg in den Rollstuhl.</li> <li>Während für schubförmig remittierende Verlaufsformen inzwischen 12 neue Behandlungsoptionen verfügbar sind, gibt es für die progressive MS gegenwärtig keine einzige effektive Therapie.</li> <li>Die Suche nach effektiven Therapien bei progressiver MS hat für die Patienten höchste Priorität.</li> </ul> <p>Orientiert man sich an den von Kongresspräsident Montalban vorgestellten Ergebnissen der ORATORIO-Studie, so eröffnen sich mit dem selektiv gegen CD20-positive B-Zellen gerichteten rekombinanten, humanisierten monoklonalen Antikörper Ocrelizumab nun erstmals therapeutisch greifbare Perspektiven für PPMS-Patienten.<sup>8</sup><br /> <br /> Bei ORATORIO (NCT01194570) han­delt es sich um eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit dem Ziel, Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ocrelizumab bei PPMS-Patienten zu beurteilen. Die 732 randomisierten Patienten im Alter zwischen 18 und 55 Jahren mussten unter anderem folgende Einschlusskrite­­rien erfüllen: gesicherte PPMS-Diagnose (McDonald-Kriterien 2005), EDSS („Expanded Disability Status Scale“)-Score zwischen 3 und 6,5, maximale Erkrankungsdauer 15 Jahre bei EDSS >5 beziehungsweise 10 Jahre bei EDSS <5. Gefordert wurden zudem patho­logische Liquorbefunde im Sinne eines erhöhten Immunglobulinindexes und/oder eines Nachweises oligoklonaler Banden. Nach Studieneinschluss er­hiel­ten die Patienten alle sechs Monate zwei in 14-tägigen Abständen ver­abreichte Infusionen von je 600mg Ocrelizumab beziehungsweise Placebo. Primärer Studienendpunkt war die Zeit bis zum Auftreten einer bestätigten Behinderungsprogression – definiert als eine über mindestens 12 Wochen kontinuierlich fortschreitende Zunahme des EDSS-Scores. Im Studienprotokoll vorgesehen war zunächst ein Behandlungszeitraum von mindestens 120 Wo­chen. Zudem musste eine vordefinierte Mindestzahl der zuvor genannten Endpunktereignisse erreicht sein – insgesamt etwa 253.<br /> <br /> Den von Montalban vorgestellten Ergebnissen zufolge liess sich das Risiko für das Auftreten des primären Endpunktes – also eine über mindestens 12 Wochen kontinuierliche Verschlechterung im EDSS-Score – unter der Behandlung mit dem monoklonalen Antikörper um 24 % signifikant senken (p=0,0321). Im Verlauf von 24 Wochen war eine vergleichbare Risikoreduktion (25 % , p=0,0365) zu beobachten. Auch im Gehtest ergab sich nach Studien­ende eine signifikante Über­legenheit von Ocrelizumab gegenüber Placebo. Bezüglich weiterer sekundärer Studien­endpunkte berichtete Montalban auch über signifikante Verbesserungen im Rahmen bildgebender Verfahren. Während unter Ocrelizumab nach 120 Wo­chen das Volumen hyperintenser T2-Läsionen um 3,4 % abgenommen hatte, war in der Placebogruppe eine Zunah­me um 7,4 % zu beobachten (p< 0,0001). Auch mit Blick auf das Gesamthirn­volumen schnitten die Verumpatienten im Studienverlauf besser ab.<br /> <br /> Im Hinblick auf die unerwünschten Ereignisse fanden sich in den beiden Studiengruppen keine signifikanten Un­terschiede. Gleiches galt für die Zahl der schweren unerwünschten Ereignisse einschließlich schwerer Infektionen (20,4 % unter Ocrelizumab und 22,4 % unter Placebo). Fälle von progressiver multifokaler Leukoenzephalopathie wurden im Studienverlauf nicht bekannt. Infusionsreaktionen tra­­ten unter Gabe des monoklonalen Antikörpers in 39,9 % auf (Placebo: 25,5 % ) und waren damit das häufigste unerwünschte Ereignis. Anlass zur Vor­sicht (sorgfältiges Monitoring etc.) geben nach Einschätzung Montalbans folgende Zahlen: Numerisch kam es in der Verumgruppe zu einem vermehrten Auftreten von Krebserkrankungen (11 versus 2): Einem Todesfall in der Placebogruppe standen deren vier in der Verumgruppe gegenüber.</p> <h2>Überzeugende Daten auch bei RRMS</h2> <p>Keinesfalls minder beeindruckende Ergebnisse konnte der monoklonale B-Zell-Antikörper Ocrelizumab auch bei RRMS-Patienten erzielen, berichtete Dr. Stephen Hauser, San Francisco/USA, über die Ergebnisse zweier klinischer Phase-III-Studien mit identischem Studiendesign.<sup>9</sup> In den rando­misierten, doppelblinden OPERA-I- und -II-Studien war der Antikörper – in Abständen von einem halben Jahr in einer Dosierung von 600mg intravenös verabreicht – mit einer Interferon-Standardtherapie (IFN-β-1a 3x 44μg pro Woche s.c.) verglichen worden. Nach zweijähriger Behandlung erwies sich Ocrelizumab bei den insgesamt 1656 in die Studie eingeschlossenen Patienten gegenüber der Interferon-Standardtherapie in mehrfacher Hinsicht als signifikant überlegen.<br /> <br /> So konnte zunächst die jährliche Schubrate um 46 resp. 47 % (p<0,001) gesenkt werden. Das Risiko für eine mindestens 12- beziehungsweise 24-wöchige bestätigte Behinderungsprogression ließ sich um jeweils 43 bzw. 37 % vermindern. Zudem kam es zu einer hochsignifikanten Abnahme der MS-typischen Inflammation – abzulesen an einer Abnahme der T1-Gadolinium-anreichernden Läsionen um 94 bzw. 95 % (p<0,001). Im Vergleich mit Interferon beta-1a signifikant gesenkt werden konnte den Angaben Hausers zufolge auch die Zahl neuer oder sich vergrößernder T2-Läsionen (77 resp. 83 % ; p<0,001). In beiden Studiengruppen kam es bei jeweils 83,3 % der Patienten zu unerwünschten Ereignissen jedweder Art. Vergleichbar war auch die Rate schwerwiegender Ereignisse (6,9 versus 8,7 % ). Das nach Massgabe dieser Studiendaten eher günstige Nebenwirkungsprofil wirft nach Einschätzung Hausers die Frage auf, ob der erfolgreich getestete neue Antikörper bei RRMS-Patienten nicht womöglich bereits in frühen Erkrankungsstadien eine sinnvolle therapeutische Option sein könnte. Andererseits ist diesbezüg­lich zu bedenken, dass bei einer ande­ren Indikation (rheumatoide Arthritis) das Auftreten schwerer, auch tödli­cher opportunistischer Infektionen unter der Behandlung mit Ocrelizumab zu einem vorzeitigen Studienabbruch geführt hat.</p> <h2>Wegen Überfüllung geschlossen</h2> <p>Nach Angaben von Prof. Dr. med. Per Soelberg Sorensen, Sekretär des ECTRIMS Executive Committee und beim diesjährigen Kongress Vorsitzender des „Teaching Course Committee“, ist der ECTRIMS-Kongress inzwischen die weltweit größte jährlich stattfindende internationale Konferenz, die sich mit Grundlagen und klinischer Forschung zur multiplen Sklerose beschäftigt. Mehr als 8.000 in Barcelona registrierte Teilnehmer sorgten in diesem Jahr abermals für einen neuen Besucherrekord. Dieser hatte zur Folge, dass teilnehmenden Spätaufstehern der Zugang zur Eröffnungsveranstaltung wegen Überfüllung verwehrt wurde. Wer wollte, konnte immerhin einer in einen anderen Großraum übertragenen Livekonferenz beiwohnen. Alternativ hätte das ECTRIMS-Programm in Verbindung mit Veranstaltungsort und Witterungsbedingungen auch einen Spaziergang am Mittelmeerstrand von Barcelona nahegelegt. So stützen nämlich neue Studienergebnisse aus einer kanadischen Arbeitsgruppe um Helen Tremlitt die Hypothese, dass durch verminderte UV-B-Licht-Exposi­tion bedingte Defizite im Vitamin-D-Stoffwechsel als Risikofaktor für die Entstehung einer MS zu betrachten sind.<sup>10</sup> Demnach könnte der Vitamin- D-Status insbesondere im späteren Er­wachsenenalter für MS-Entstehung und -verlauf an Bedeutung gewinnen.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Medizinjournalist<br/>
<br/>
Quelle:<br/>
31st Congress of the European Committee
for Treatment and Research
in Multiple Sclerosis,<br/>
7.–10. Oktober 2015, Barcelona
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Olesen J et al: The economic cost of brain disorders in Europe. Europ J Neurology 2012; 19: 155-162<br /><strong>2</strong> Comabella M et al: Protein-based biomarker predicts conversion from clinically isolated syndrome to multiple sclerosis. Congress of the ECTRIMS 2015: abstract P1213<br /><strong>3</strong> Cantó E et al: Chitinase 3-like: prognostic biomarker in clinically isolated syndromes. Brain 2015; 138: 918-931<br /><strong>4</strong> Comabella M et al: Search of biomarkers for multiple sclerosis by RNA, microRNA, and exome sequencing approaches. Congress of the ECTRIMS 2015: abstract P1227<br /><strong>5</strong> Yaldizli O et al: Brain and cervical spinal cord atrophy in primary progressive multiple sclerosis: results from a placebo-controlled phase III trial (INFORMS). Congress of the ECTRIMS 2015: abstract 110<br /><strong>6</strong> Raghupathi R et al: Baseline cognitive function predicts clinical disability progression in an integrated RRMS clinical trial database. Congress of the ECTRIMS 2015: abstract P317<br /><strong>7</strong> ECTRIMS Lecture: Prof. Alan Thompson, London: „Therapeutic challenges of progressive MS“, Barcelona, 8. Oktober 2015 <br /><strong>8</strong> Montalban X et al: Efficacy and safety of ocrelizumab in primary progressive multiple sclerosis – results of the placebo-controlled, double-blind, Phase III ORATORIO study. Congress of the ECTRIMS 2015: abstract 228<br /><strong>9</strong> Hauser S et al: Efficacy and safety of ocrelizumab in relapsing multiple sclerosis – results of the interferon-beta-1a-controlled, double-blind, Phase III OPERA I and II studies. Congress of the ECTRIMS 2015: abstract 190<br /><strong>10</strong> Tremlett H et al: Sun exposure over the life-course and associations with multiple sclerosis. Congress of the ECTRIMS 2015: abstract 123</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...