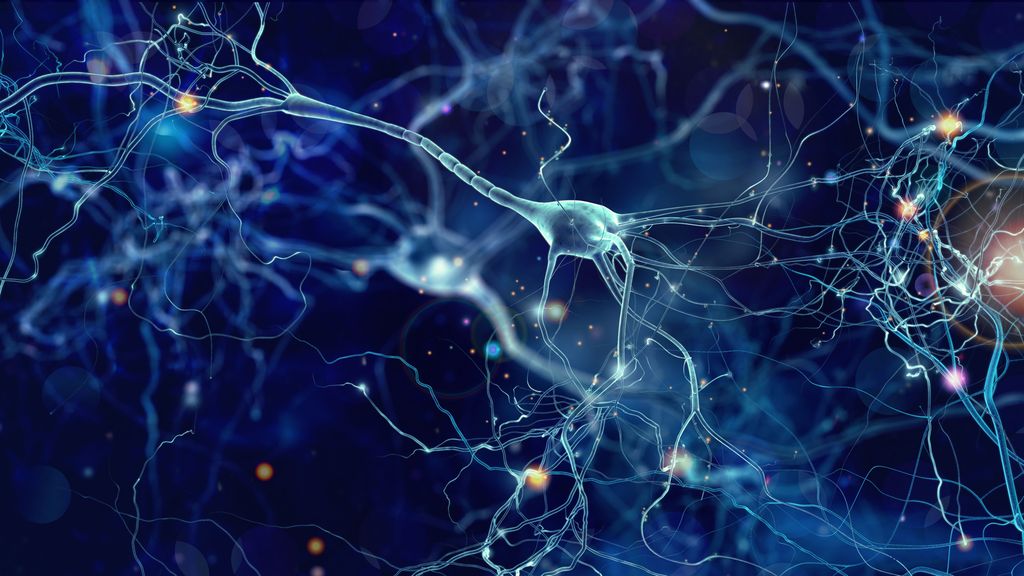
©
Getty Images/iStockphoto
Leistungen und Herausforderungen der modernen Neurologie
Jatros
30
Min. Lesezeit
15.06.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Einen umfassenden Überblick über die aktuellen Leistungen und Herausfor­derungen der österreichischen Neurologie bot die 14. Jahrestagung der ÖGN in Villach. Die Themen reichten von neuen, mittlerweile in Österreich weitgehend flächendeckend verfügbaren Verfahren für die Behandlung schwerster Schlaganfälle über den Vormarsch autoimmun bedingter Gehirnentzündungen und exotischer Virenerkrankungen bis hin zum steigenden Bedarf an neuropalliativmedizinischer Betreuung.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Schlaganfallbehandlung: eine Erfolgsgeschichte</h2> <p>Dass die am Kongress präsentierten Entwicklungen nicht nur wissenschaftliche Bedeutung, sondern ganz konkrete Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung haben, zeigte die ÖGN-Präsidentin am Beispiel der Schlaganfallbehandlung auf. „Die rasante Entwicklung der letzten eineinhalb Jahrzehnte ist nicht nur eine der signifikantesten Erfolgsgeschichten der jüngeren Medizingeschichte“, so ÖGN-Präsidentin Prim. Univ.-Doz. Dr. Elisabeth Fertl, Vorständin der Neurologischen Abteilung am Krankenhaus Rudolfstiftung und Gastprofessorin der MedUni Wien. „Sie zeigt auch, wie es in Österreich gelingen konnte, trotz knapper werdender Budgets die Behandlungsqualität einer so häufigen und gefürchteten Erkrankung erheblich zu verbessern.“<br />In Österreich sind jedes Jahr etwa 24 000 Menschen von einem Schlaganfall betroffen. Tendenz steigend – vor allem weil das Schlaganfallrisiko mit der steigenden Lebenserwartung zunimmt. Seit rund 15 Jahren gibt es die Möglichkeit, die schlaganfallauslösenden Blutgerinnsel in den Gehirngefäßen mittels Thrombolyse medikamentös aufzulösen. Diese Entwicklung hat die Versorgungsstruktur deutlich verändert. In manchen Spitälern war die Einrichtung von Schlaganfallüberwachungsstationen, den Stroke Units, die Initialzündung für die Gründung von eigenen neurologischen Abteilungen. Heute steht Österreich mit einem Netz von 38 Stroke Units auch im internationalen Vergleich vorbildlich da. </p> <h2>Neues Verfahren für besonders schwere Schlaganfälle auf breiter Basis verfügbar</h2> <p>„Rund zehn Prozent der Patienten haben einen Verschluss in den großen Gehirngefäßen. Ihnen konnten wir mit der Thrombolyse nicht oder nur selten helfen“, erklärte Prim. Fertl. Inzwischen gibt es aber auch für diese rund 2000 Fälle pro Jahr eine vielversprechende Behandlungsoption. „Nun haben wir die zusätzliche Möglichkeit der mechanischen Gerinnselentfernung“, so die ÖGN-Präsidentin. „Mit der endovaskulären Thrombektomie wird der Verschluss mit einem Katheter, der in der Leiste eingeführt und bis zum Gehirn geschoben wird, aus dem Gehirngefäß herausgezogen.“<br />Wie sich in internationalen Studien zeigte, ist das innovative Verfahren nicht nur sicher, sondern auch besonders effektiv. Aufgrund der positiven Datenlage gilt die endovaskuläre Thrombektomie für geeignete Schlaganfallpatienten inzwischen als Standardmethode.<br />„Diese Spitzenleistung der Schlaganfallbehandlung ist interdisziplinär und personalintensiv und stellt hohe Anforderungen an die Ausbildung“, betonte ÖGN-Präsidentin Fertl. „Wegen der nötigen Infrastruktur und der Qualitätsanforderungen ist das neue Therapieangebot überall auf einige spezialisierte Zentren konzentriert – in Österreich sind es derzeit zehn Standorte. Das setzt nicht zuletzt ein gut funktionierendes Transportwesen voraus.“ Die Zahl der so behandelten Fälle steigt beständig. „Waren es im Jahr 2011 noch weniger als 200 Interventionen in Österreich, so wurden im vergangenen Jahr bereits mehr als 1000 Eingriffe dieser Art durchgeführt“, so Prim. Fertl.</p> <h2>Autoimmun bedingte Gehirn­entzündungen nehmen zu</h2> <p>Wie dynamisch sich unterschiedliche Spezialbereiche der Neurologie entwickeln, zeigte auch der Kongressschwerpunkt Neuroimmunologie. Prim. Univ.-Prof. Dr. Jörg Weber, Vorstand der Abteilung für Neurologie am Klinikum Klagenfurt und Präsident des Kongresses: „Es gibt wenige Bereiche der Medizin, die sich in den letzten beiden Jahrzehnten derart rasant entwickelt haben. Vor wenigen Jahren standen wir dem Phänomen, dass körpereigene Antikörper intaktes Gehirngewebe angreifen und zerstören können, nahezu hilflos gegenüber. Heute verstehen wir die dahinterliegenden Mechanismen besser und können solche Erkrankungen in vielen Fällen heilen.“<br />Vor 20 Jahren waren etwa noch drei Viertel aller Gehirn- oder Gehirnhautentzündungen auf einen bakteriellen Erreger zurückzuführen. „Heute sind erregerbedingte Entzündungen dank der Impfprogramme deutlich zurückgegangen“, so Prof. Weber. „Dafür stellen wir bei vielen Fällen von Gehirnentzündung fest, dass bestimmte Antikörper, die das eigene Gehirngewebe angreifen, verantwortlich sind.“ Eine solche Fehlprogrammierung von Antikörpern kann die Folge einer Virusinfektion sein – genauso kann aber, wie man heute weiß, zum Beispiel ein Krebsgeschehen dahinterstecken.</p> <h2>Früher tödliche Gehirn­entzündungen werden heilbar</h2> <p>„Früher konnten wir in solchen Fällen keine ursächliche Behandlung anbieten“, weiß Prof. Weber. „Heute kommen Substanzen zur Unterdrückung des Immunsystems – wie beispielsweise Kortison – oder auch Blutwäscheverfahren zur Anwendung.“ Nur ein Beispiel für deren Wirksamkeit: Vor wenigen Jahren noch starb rund die Hälfte aller Patienten mit sogenannter NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, weitere 40 % trugen bleibende Behinderungen davon. „Heute können wir 60 bis 65 % nach einem guten Verlauf entlassen“, so Prof. Weber.</p> <h2>Spezialisierung Neurointensiv­medizin dringend erforderlich</h2> <p>Trotz aller Fortschritte sind derartige Autoimmunerkrankungen immer neurologische Notfälle, deren Behandlung eine hohe fachliche Kompetenz erfordert, so Prof. Weber: „Umso unverständlicher ist es, dass derzeit eine wichtige Säule der neurologischen Versorgung infrage gestellt wird.“<br />Der Hintergrund: Bis 2015 gab es in der Ärzteausbildungsordnung ein eigenes Additivfach „Neurointensivmedizin“ – mit der neuen Ausbildungsordnung sind solche Zusatzfächer aber nicht mehr vorgesehen und können durch die Möglichkeit einer sogenannten Spezialisierung ersetzt werden. Über eine solche verhandeln die ÖGN und die Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie mit der Ärztekammer, dem Gesundheitsministerium und den Ländern.<br />„Ohne diese Spezialisierung wäre die neurointensivmedizinische Versorgung gefährdet“, so Prof. Weber. „Im Sinne unserer Patienten ist sie unabdingbar. Wir sind heute zu Recht stolz darauf, dass es in allen Landeshauptstädten eigene, auf neurologische Fälle spezialisierte Intensivstationen gibt. Noch haben wir dafür auch genügend Kolleginnen und Kollegen mit Spezialausbildung. Wird diese nicht bald durch die angestrebte Spezialisierung ersetzt, würde an diesen Stationen zwangsläufig das hoch spezialisierte Wissen verloren gehen. Daher müssen wir sicherstellen, dass das heute vorhandene Wissen auch an die nächste Generation von Neurologinnen und Neurologen weitergegeben werden kann.“</p> <h2>Palliativmedizin gewinnt auch in der Neurologie an Bedeutung</h2> <p>Einen hohen Bedeutungszuwachs attestierte Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Kapeller auch einem anderen Spezialbereich: „Mit dem Kongressschwerpunkt Palliativneurologie wollen wir aufzeigen, dass es in der palliativen Behandlung um weit mehr geht als um die Betreuung am Lebensende“, so der Vorstand der Neurologischen Abteilung am LKH Villach. „Gerade neurologische Erkrankungen gehen oft mit sehr beeinträchtigenden Symptomen einher, der Bedarf an palliativer Betreuung ist daher besonders hoch.“<br />Anders als in der Onkologie, wo eine nicht mehr kurative, aber pflegende Behandlung meist erst im Endstadium notwendig wird, leiden Neurologiepatienten oft über einen langen Zeitraum an Krankheiten wie der amyotrophen Lateralsklerose (ALS), Demenzen oder Morbus Parkinson. Ebenso können aber auch die Folgen von schweren Schlaganfällen oder Gehirnentzündungen, Hirntumoren, Neurotraumen oder genetischen Erkrankungen für ein langes Stadium der Pflegebedürftigkeit sorgen. „Patentrezepte gibt es für diese Form der lebensbegleitenden Therapie keine“, weiß Prof. Kapeller. „Eine qualitätsvolle Palliativbetreuung ist immer von persönlichen Vorstellungen und Präferenzen sowie den besonderen Lebensumständen der Patienten abhängig.“</p> <h2>Neurologische Palliativbetreuung ist langfristig und personalintensiv</h2> <p>Das stellt auch besondere Anforderungen an die personellen Ressourcen der Versorgungseinrichtungen. „Zwar ist die Versorgung dieser Krankheitsbilder und ihrer Folgezustände seit jeher integraler Bestandteil neurologischen Arbeitens, dennoch sehen wir auch in unserem Fachgebiet die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Versorgung und Therapie von Menschen mit die Lebensqualität beeinträchtigenden Symptomen weiter zu schärfen“, so Prof. Kapeller. „Deshalb arbeiten wir derzeit gemeinsam mit anderen Fachrichtungen an der Realisierung einer neuen, interdisziplinären Ausbildung. Diese Spezialisierung in Palliativmedizin soll das Fachwissen vertiefen und zu einer noch qualitätsvolleren Gesamtversorgung beitragen. Ich bin optimistisch, dass wir die letzten offenen Abstimmungsfragen in allernächster Zeit abgeschlossen haben werden. Mit dieser Spezialisierung wird es gelingen, Behandlungsansätze und Strukturen zu schaffen, mit denen die Qualität palliativer Behandlungen noch einmal deutlich gehoben wird.“</p> <h2>Neuroinfektionen als globale Herausforderung</h2> <p>Ein anderer Spezialbereich, der an Bedeutung gewinnt, ist die Neuroinfektiologie. „Der Tourismus trägt ebenso wie weltweite Migrationsbewegungen dazu bei, dass auch exotische Erreger sehr rasch sehr große Verbreitung finden können“, erklärt Tagungspräsident Prof. Weber. „Aktuell beobachten wir etwa eine deutliche Zunahme von Fällen zerebraler Malaria.“<br />Ebenso tritt auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wieder verstärkt auf. Zwar ist Österreich – schon dank der hohen Impfdisziplin – bisher davon verschont geblieben, in den europäischen Endemiegebieten haben die Fälle der gefährlichen Viruserkrankung in den letzten 30 Jahren aber um 400 Prozent zugenommen. Mitverantwortlich dafür sind möglicherweise Wanderbewegungen innerhalb der EU.</p> <p><br />Quelle: <br />Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, 22.–24. März 2017, Villach</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...


