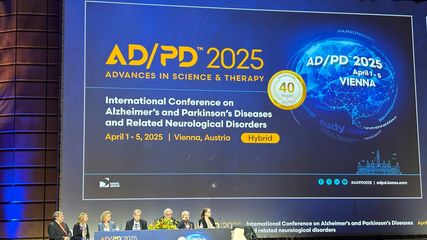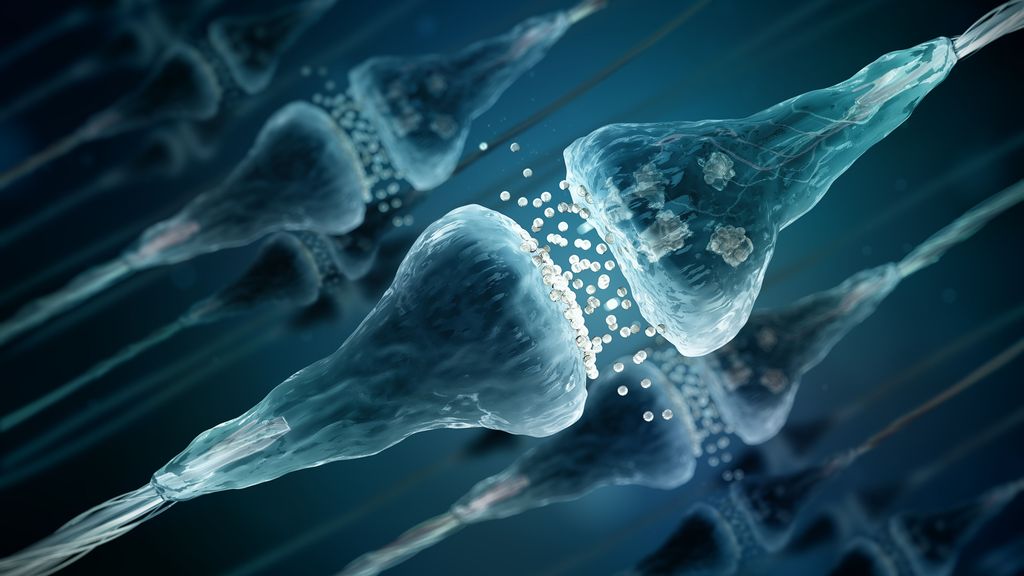
©
Getty Images/iStockphoto
Kombinierte Therapie von schweren Kopfschmerzen bei Medikamentenübergebrauch
Jatros
30
Min. Lesezeit
28.06.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Bei der Dreiländertagung der Kopfschmerzgesellschaften wurden auch aktuelle Zahlen zur Kopfschmerzversorgung vorgestellt. Ein stationäres Programm für Patienten mit schweren Medikamentenübergebrauchs-Kopfschmerzen setzt auf ein Zusammenspiel von Schulmedizin und traditioneller chinesischer Medizin. Erste Untersuchungen sprechen für eine gute Wirksamkeit.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>In ihrem Vortrag stellte PD Dr. Stefanie Förderreuther, Neurologischer Konsiliardienst an der LMU München, Klinikum Großhadern, die Resultate einer Befragung zur Kopfschmerzversorgung in Deutschland vor. „Diese Daten wurden zwischen September und November 2016 anhand von 2500 Face-to-Face-Befragungen in einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Wohnbevölkerung ab einem Alter von 14 Jahren erhoben“, erläuterte sie. Neben soziodemografischen Daten wurden dabei die Antworten auf 38 Fragen zum Thema Kopfschmerzen erfasst.</p> <h2>Prophylaxe zu selten eingesetzt</h2> <p>Die Befragung ergab eine 6-Monats- Prävalenz für Kopfschmerzen im Allgemeinen von 40,2 % und für Migräne von 7,6 % . „Unsere Umfrage zeigte zudem, dass Patienten mit Migräne im Vergleich zur Gruppe mit Kopfschmerzen nicht nur unter Schmerzen einer höheren Intensität litten, sondern auch häufiger innerhalb eines Monats und länger anhaltend davon betroffen sind“, so Dr. Förderreuther. Insgesamt 29 % der Befragten gaben an, an 4 bis 14 Tagen pro Monat unter Migräne zu leiden. „Dies stellt schon eine sehr erhebliche Belastung dar“, betonte die Referentin.<br /> Im Weiteren ergab die Befragung, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzpatienten vom Hausarzt/Internisten und knapp ein Viertel vom Neurologen betreut wird. Die wichtigste Informationsquelle stellte für die meisten Betroffenen (34,8 % ) denn auch der Arzt dar. Das Internet favorisierten lediglich 14 % . „Nur 53,5 % der Ärzte bekamen für ihre Leistung aber die Note 1 oder 2. Da ist also sicher noch Luft nach oben“, so Dr. Förderreuther. Auf die Möglichkeiten einer Migräneprophylaxe wiesen 48 % der Ärzte hin, unter den Fachärzten waren es 57 % . Von den Patienten mit 4 bis 14 Migränetagen pro Monat erhielten lediglich 22 % eine Prophylaxe. „Bei diesen Patienten gibt es jedoch eindeutig eine Indikation für eine Prophylaxe. An dieser Zahl müssen wir daher unbedingt arbeiten“, meinte die Referentin. Die Patienten gaben zudem an, dass sie sich insbesondere mehr Informationen über die Auslöser einer Migräne und über alternative Behandlungsmöglichkeiten wünschten.</p> <h2>Die stationäre Kopfschmerzrehabilitation</h2> <p>„Wir alle kennen den Teufelskreis, der über ein Zuviel an Akutmedikamenten zu einem Medikamentenübergebrauchs-Kopfschmerz führt“, erklärte der nächste Referent, Prof. Dr. Peter Sandor, Ärztlicher Direktor Neurologie, RehaClinic Bad Zurzach. Die Therapie eines Medikamentenübergebrauchs- Kopfschmerzes (MOH) kann in unterschiedlichen Settings stattfinden. „Sehr schwer Betroffenen bieten das Kantonsspital Baden und die RehaClinic Bad Zurzach gemeinsam einen stationären Entzug über 5 Tage an, gefolgt von einer spezialisierten Kopfschmerzrehabilitation“, berichtete er. Patienten, die sich für dieses Programm qualifizierten, hätten bereits mehrere erfolglose Therapieversuche, auch stationäre, hinter sich. Darüber hinaus würden oft bereits berufliche und private Schwierigkeiten (Elternschaft, Beziehung) als Folge der Migräne bestehen. Das Programm beinhaltet neben einer Pharmakotherapie komplementäre Maßnahmen, unter anderem ein Schmerzcoaching, Physiotherapie, Ausdauertraining und auch traditionelle chinesische Medizin (TCM).<br /> Im Rahmen eines neurowissenschaftlichen Begleitprogramms wurden bei bisher behandelten Patienten anhand von MRIAufnahmen im zeitlichen Querschnitt bestimmte Veränderungen im Hirnstamm, in striatalen Gebieten und im orbitofrontalen Kortex (OFK) festgestellt. Im zeitlichen Längsschnitt zeigten diejenigen Patienten, bei denen das Programm zu einer erfolgreichen Rückführung des MOH in einen episodischen Kopfschmerz geführt hatte, eine Normalisierung dieser Veränderungen.<sup>1</sup> Bei den Non-Respondern blieben die Veränderungen erhalten. „Zudem korrelierte das Ausmaß der Veränderungen im OFK mit der Erfolgswahrscheinlichkeit“, ergänzte Prof. Sandor. Damit scheinen der OFK und der Hirnstamm, zusätzlich zu bereits bekannten weiteren Abnormitäten, bei MOH pathophysiologisch wichtig zu sein. „Erste retrospektive Evidenz deutet zudem darauf hin, dass der von uns gewählte komplementäre Einsatz von Schulmedizin und TCM gut wirksam ist“, schloss Prof. Sandor.</p> <p><br /><span class="link-color"> <a class="article-link" href="http://at.universimed.com/fachthemen/1000000271" data-locked="0">hier weiterlesen</a></span></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 6. Dreiländertagung Kopfschmerzsymposium, 15. bis 17.
März 2018, Bad Zurzach, Schweiz
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Riederer F et al:. Decrease of gray matter volume in the midbrain is associated with treatment response in medication- overuse headache: possible influence of orbitofrontal cortex. J Neurosci 2013; 33(39): 15343-9</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...