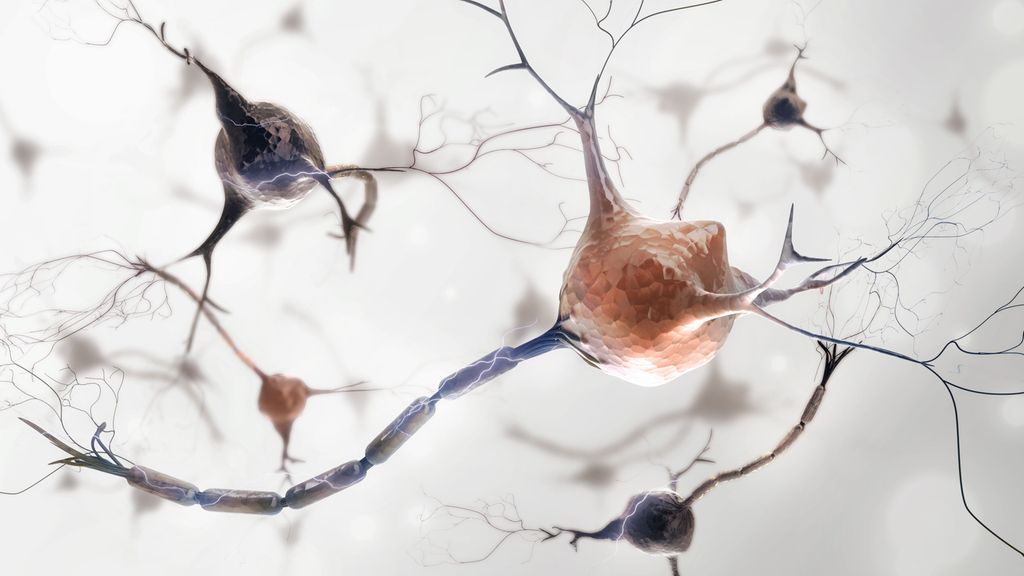<p class="article-intro">Mobilität ist in unserer Gesellschaft von sehr hoher Bedeutung. Dies betrifft gerade auch Senioren, welchen das Autofahren den Alltag erleichtern kann. Zwar werden in den Massenmedien mitunter spektakuläre Unfälle von Senioren dargestellt und diese als Risiko im Strassenverkehr bezeichnet. Doch trifft dies tatsächlich zu?</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Ob Senioren ein grösseres Risiko im Strassenverkehr darstellen oder nicht, lässt sich anhand des Faktors «Alter» alleine nicht beantworten. Poschadel et al.<sup>1</sup> haben in einem Forschungsprojekt zusammengetragen, was derzeit aus internationaler wissenschaftlicher Perspektive zur Frage von Leistungspotenzialen, Defiziten und Kompensationsmöglichkeiten älterer Kraftfahrer ausgesagt werden kann. Die Literaturbefunde wurden (zum Teil) in einer Fahrverhaltensprobe im Realverkehr überprüft.</p> <h2>Veränderungen beim normalen Altern</h2> <p>Die Autoren beschreiben eine Reihe von überwachenden kognitiven oder Kontrollfunktionen (vorwiegend Exekutivfunktionen), welche sich während des natürlichen Alterungsprozesses verschlechtern. Gemeint sind Funktionen der visuellen Aufmerksamkeit und Suche, der Inhibition (d. h. der Fähigkeit zur Hemmung von irrelevanter Information oder Vermeidung falscher Reaktionen), der Zeitwahrnehmung und des Trackings (Fähigkeit der kognitiven und motorischen Steuerung eines Fahrzeugs auf einem vorgegebenen Weg).<br /> Alle diese Funktionen können mehr oder weniger stark beeinträchtigt sein. In Laboruntersuchungen zeigte sich, dass ältere Fahrer in komplexeren Situationen mit Anforderungen ans Multitasking und unter Zeitdruck mehr Mühe haben, sichere und rasche Reaktionen zu zeigen. Ob und wieweit dies zu einer verminderten Fahrleistung im Realverkehr führt, lässt sich nicht mit Studien belegen.</p> <h2>Altersbedingte kognitive medizinische/pathologische Veränderungen</h2> <p>Von höherer Relevanz bezogen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Fahrzeugs sind insbesondere pathologische Veränderungen des Gehirns, wie sie etwa progredient bei demenziellen Erkrankungen vorliegen. Auch die mit den demografischen Änderungen zunehmende Häufigkeit von vaskulären Hirnveränderungen ist bei Fragen nach verkehrsrelevanten Leistungseinbussen von Bedeutung. Je nach Ätiologie und Läsionsort der neurologischen Grunderkrankung können unterschiedliche kognitive Leistungen beeinträchtigt sein, was im Einzelfall abzuklären ist. Besonders kritisch im Hinblick auf die Fahreignung sind frontale Hirnveränderungen oder -funktionsstörungen.<br /> In Studien mit Verwendung bildgebender Verfahren konnte gezeigt werden, dass der präfrontale Kortex eine wichtige Rolle in der Kontrolle kognitiver Funktionen spielt. Die Grundlagenforschung untersuchte die Aktivierungsmuster bei der Ausführung von verschiedenen alltäglichen Aufgabenanforderungen. Unterschiedliche Aktivierungsmuster wurden von den Autoren als kompensatorische Strategien der älteren Probanden zur effizienteren Nutzung der altersbedingten veränderten neuronalen Strukturen interpretiert.<br /> Bei demenziellen Verläufen liegt nicht generell eine Nichteignung zum Autofahren von Beginn der Erkrankung weg vor. Patienten mit einer beginnenden, leichten Alzheimerdemenz fahren meist noch sicher Auto. Regelmässige Kontrollen und ausführliche kognitive Leistungsuntersuchungen lassen den richtigen Zeitpunkt zur Aufgabe des Autofahrens bestimmen.</p> <h2>Vorhersagbarkeit der Fahrleistung bei kognitiven Leistungsdefiziten und Kompensationsmöglichkeiten</h2> <p>Zur Frage der Vorhersagbarkeit der Fahrleistung in einer Fahrverhaltensprobe bei vorliegenden (diagnostizierten) kognitiven Defiziten und bezüglich deren Kompensierbarkeit fehlen Studien, in denen tatsächlich überprüft wurde, welche Leistungsbereiche in Bezug auf das Autofahren durch welche anderen Leistungsbereiche kompensiert werden können. Der Verordnungsgeber in Deutschland etwa legt lediglich die Leistungsbereiche fest, welche begutachtet und in denen ausreichende Leistungen erwartet werden, damit die Fahreignung aus kognitiver Sicht bejaht werden kann. Das sind Belastbarkeit, Orientierungsleistung, Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleistung und Reaktionsfähigkeit. Daneben existieren spezifische kognitive Störungen wie etwa bei Schlaganfall Defizite der visuell-räumlichen Verarbeitung oder visuelle Vernachlässigung (visueller Neglect) oder Störungen der Impuls-, der Verhaltenskontrolle oder der Störungseinsicht nach Schädel- Hirn-Trauma, deren Vorhandensein bei der Einschätzung der Fahreignung ebenfalls berücksichtigt werden muss. Wichtig ist auch, die exekutiven Leistungen zu überprüfen.<br /> Zur Fähigkeit der Kompensation von nachlassenden kognitiven Leistungen bei älteren Menschen zeigen Studien, dass ältere Menschen Probleme bei bestimmten kognitiven Funktionen durch eine intensivere Aktivierung anderer Funktionen im Alltagsleben ausgleichen können, sodass im beobachtbaren Verhalten im Vergleich mit Jüngeren trotz bestehender Defizite nicht zwingend Veränderungen sichtbar sein müssen (Kompensation auf der Mikroebene).</p> <h2>Erhaltung und Trainierbarkeit der Fahreignung</h2> <p>Der aktuelle Forschungsstand verweist darauf, dass verloren gegangene kognitive Leistungen durch Training teilweise wiedererlangt werden können. Dies gilt nicht für Menschen mit chronischen degenerativen Hirnerkrankungen, bei welchen die kognitiven Leistungen sukzessive abnehmen. Eine Strategie der Kompensation von verlorenen (oder reduzierten) Fähigkeiten bei älteren Menschen ist, diese Funktionen durch ein gezieltes Training wieder zu reaktivieren bzw. durch ein moderates Ausdauertraining, welches das Herz und den Kreislauf gleichmässig belastet, zu stärken. Zusammenfassend lassen die Studien vermuten, dass auch das Gehirn älterer Menschen noch in der Lage ist, auf Anforderungen mit entsprechenden strukturellen Veränderungen zu reagieren und auch im höheren Alter noch plastisch ist.<br /> Allerdings weisen Bherer et al.<sup>2</sup> darauf hin, dass es nur sehr geringe Transfereffekte einer trainierten kognitiven Funktion auf einen anderen kognitiven Bereich gibt. Es wird sogar die Wichtigkeit der Ähnlichkeit der Aufgabenart des Trainings mit der Alltagssituation und ihrer Anwendbarkeit betont. Zudem muss zum Erhalt des neuronalen Zugewinns und der Funktionsverbesserungen das Training aufrechterhalten werden. Fahrsimulatoren eignen sich sehr gut als Trainingsinstrument. Weiter wurde der Nutzen des Trainings von strategischen und taktischen Kompensationsstrategien untersucht.<br /> Unter strategischen Kompensationsstrategien werden Vorbereitungen verstanden, welche vor Fahrantritt vorgenommen werden (günstigen Zeitpunkt der Fahrt festlegen, Route planen, Witterungsbedingungen berücksichtigen). Bei den taktischen Kompensationsstrategien handelt es sich um Anpassungen während der Fahrt (vorausschauendes Fahren, Anpassung von Geschwindigkeit, Abstand). Studien unterstreichen die Effektivität strategischer und taktischer Kompensationsstrategien bei älteren Autofahrern und deuten darauf hin, dass ein aktives Training vor allem die taktischen Kompensationsmöglichkeiten bei älteren Fahrern deutlich verbessern kann. Dies gilt allerdings nur für kognitiv rüstige, nicht eingeschränkte ältere Autofahrer.<br /> Eine Studie von Poschadel et al.<sup>3</sup> zeigte, dass insbesondere auch ein Fahrtraining im Realverkehr eine geeignete Trainingsmethode zur Verbesserung der Fahrleistung ist. Vor allem in komplexen Verkehrssituationen konnten sich die Teilnehmer signifikant verbessern. Dies lässt es ratsam erscheinen, dass Ältere ein auf ihre Probleme zugeschnittenes Fahrtraining im Realverkehr absolvieren, welches kritische Situationen und Verkehrsknotenpunkte einschliesst. Aufbauend auf dem oben skizzierten Wissensstand wurde eine empirische Untersuchung älterer Autofahrer mithilfe einer beobachteten Fahrt im Realverkehr durchgeführt. Es wurde vor allem untersucht, welche Kompensationsstrategien bei einer Fahrt im Realverkehr von älteren Probanden angewandt werden und ob es möglich ist, auf Basis von medizinischen und psychologischen Tests die Fahrbefähigung vorauszusagen.<br /> Es wurde ein Stichprobenumfang von n=40 Probanden realisiert. Hinsichtlich der Zuordnung in die beiden Untersuchungsgruppen entfielen jeweils 20 Teilnehmer auf die Gruppe der (mehrfach) erkrankten, hochaltrigen Wenigfahrer (Gruppe «Unfit») und die jüngere, gesündere, fahrroutiniertere Gruppe (Gruppe «Fit»). Die teilnehmenden Senioren waren insgesamt zwischen 65 und 85 Jahre alt, wobei das Durchschnittsalter der Gruppe «Fit» 69 Jahre und das Durchschnittsalter der Gruppe «Unfit» 74 Jahre betrug. Die Probanden wurden eingangs verkehrsmedizinisch auf Krankheiten untersucht, welche potenziell die Fahreignung beeinträchtigen können. Ferner wurden die Probanden augenärztlich, mittels Testverfahren zur Erfassung kognitiver Kompetenzen und im Hinblick auf ihre motorischen Funktionen untersucht. Die zentrale Annahme der Gruppenvergleiche und getesteten Hypothesen war dabei eine tendenziell schlechtere Leistung bzw. höhere Risikobelastung der Gruppe «Unfit» im Vergleich zur Gruppe «Fit», was sich bestätigte.<br /> Bei der Fahrverhaltensbeobachtung wurde deutlich, dass die Probanden insgesamt nur eine sehr geringe Ablenkbarkeit aufwiesen und ihre Aufmerksamkeit stark auf die Fahraufgabe fokussierten. Kompensation scheint somit insbesondere darin zu bestehen, zusätzliche Belastungen zur Fahraufgabe zu vermeiden, indem ablenkende Reize als «irrelevant» unterdrückt werden, um dadurch die Notwendigkeit weiterer Anpassungen und Veränderungen des Fahrverhaltens zu umgehen.<br /> Interessanterweise wiesen bei der Prüfung der kognitiven Kompetenzen nur 9 der 40 Probanden völlig unbeeinträchtigte Werte auf, 31 Probanden erzielten in mindestens 1 Testparameter einen ungenügenden Wert, was eigentlich schon als eine Unterschreitung der kognitiven Mindestanforderungen zu werten ist. Da 26 von 40 Probanden eine positive Fahrverhaltensbeurteilung erhielten, könnte man meinen, die Aussagefähigkeit der kognitiven Leistungsprüfung sei nicht zuverlässig. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass die als «fit» beurteilten Probanden eine bessere Gesundheit hatten, bessere visuelle Leistungen sowie auch bessere Leistungen bei der kognitiven Leistungsprüfung aufwiesen, dass somit die kognitive Leistungsprüfung bei der Einschätzung der Fahreignung einen wichtigen Stellenwert besitzt. Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass sich anhand einer umfassenden Berücksichtigung zentraler verkehrssicherheitsrelevanter Merkmale eine gute Klassifikation älterer Autofahrer erreichen lässt. Es zeigte sich, dass das Alter allein einen nur sehr geringen Beitrag leistet. Die fahrpraktischen Fähigkeiten sowie die Mindestanforderungen an die kognitive, visuelle und physisch-gesundheitliche Situation der älteren Fahrer weisen einen wesentlich höheren Erklärungswert auf.</p> <h2>Schlussfolgerungen</h2> <p>Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei der Diskussion um die Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit älterer Kraftfahrer eine Berücksichtigung der fahrpraktischen Fähigkeiten sinnvoll wäre. Die Messbarkeit und die Aussagekraft der Fahrleistung allein anhand von Untersuchungen ohne Fahrprobe im Realverkehr sind eingeschränkt. Auch wenn eine Berücksichtigung von Aspekten fahrrelevanter Kompetenz- und Leistungsbereiche insbesondere sinnvoll ist, um positive Beurteilungen «sicherer» älterer Kraftfahrer abzusichern, so sind isolierte Bewertungen der visuellen, der kognitiven Leistungsfähigkeit oder der verkehrsrelevanten gesundheitlichen Situation nur unzureichend geeignet, das Ausmass negativer Auswirkungen dieser Einschränkungen auf die fahrpraktischen Fähigkeiten zu beurteilen. Bei der Einschätzung der Fahreignung allein auf der Grundlage der Prüfung der kognitiven Leistungen sollte diese nur verneint werden, wenn akkumulierte und ausgeprägtere Defizite (d. h. Einschränkungen von mehreren verkehrsrelevanten kognitiven Leistungen) festgestellt worden sind. Senioren sind nicht generell ein Risikofaktor im Strassenverkehr. Die meisten von ihnen kompensieren erfolgreich, wenn auch die aktuelle Arbeit nicht beschreibt, wie genau dies geschieht. Es gilt, gesundheitlich angeschlagene und manifest kranke Senioren zu identifizieren und deren Fahreignung zu überprüfen. In nicht eindeutigen Fällen ist die Durchführung einer Fahrverhaltensprobe im Realverkehr anzustreben. Zudem sollten verstärkt Bemühungen unternommen werden, die Fahreignung älterer Menschen mit abnehmenden Fähigkeiten in verkehrsrelevanten Leistungsbereichen gezielt zu trainieren (durch theoretische Schulung sowie ein Fahrverhaltenstraining zur Verbesserung der taktischen Kompensationsstrategien und der effektiven Fahrleistung).</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Poschadel S et al.: Verkehrssicherheitsrelevante Leistungspotenziale, Defizite und Kompensationsmöglichkeiten älterer Kraftfahrer. Bundesanstalt für Strassenwesen. Bericht M 231. 2012 <strong>2</strong> Bherer L et al.: Testing the limits of cognitive plasticity in older adults: application to attentional control. Acta Psychol (Amst) 2006; 123(3): 261-78 <strong>3</strong> Poschadel S et al.: Ältere Autofahrer: Erhalt, Verbesserung und Verlängerung der Fahrkompetenz durch Training. In: Schriftenreihe «Mobilität und Alter» der Eugen-Otto-Butz- Stiftung. Köln: TÜV Media GmbH, 2012</p>
</div>
</p>