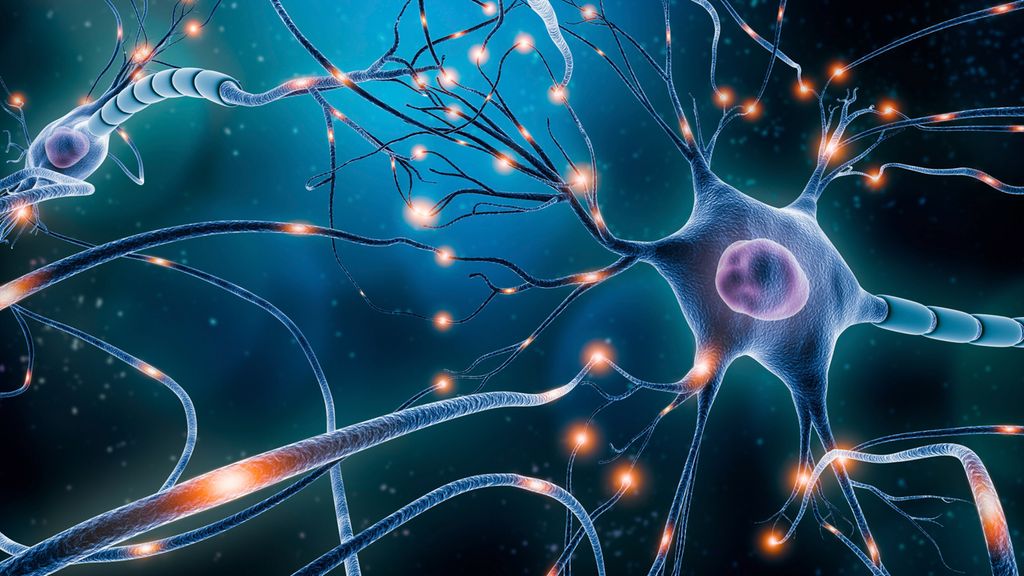
Aktuelle Entwicklungen bei Multipler Sklerose und Alzheimerdemenz
Bericht:
Mag. Harald Leitner
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Krankheitsmodifizierende Therapien gegen Morbus Alzheimer, eine neue Definition der Progression der multiplen Sklerose (MS) – aktuelle Entwicklungen in diesen beiden Bereichen zählten zu den Highlights der 20. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) 2023, die von ausgewiesenen Expertinnen und Experten präsentiert wurden.
Alzheimertherapie vor dem Durchbruch
Der Nachweis von Amyloid-β(Aβ)-Plaques im Gehirn mittels PET ist heute ein Standardinstrument in der Diagnose der Alzheimerdemenz (AD). Um die Ergebnisse der PET-Untersuchungen unabhängig vom verwendeten Tracer vergleichbar zu machen, wurde das Konzept der Centiloide entwickelt.1 Dabei handelt es sich um ein semiquantitatives Mass, wobei 0 für vollständiges Fehlen von Aβ im Gehirn und Freiheit von Symptomatik bedeutet und ein Wert von 100 leichte bis mittelschwere AD mit entsprechendem durchschnittlichem Aβ. 26 Centiloide gelten als Schwellenwert, ab dem Patient*innen mit grosser Wahrscheinlichkeit im Laufe von sechs Jahren eine AD entwickeln werden. Mittlerweile gibt es eine Reihe von monoklonalen Antikörpern, die Aβ reduzieren, wobei die einzelnen Substanzen in verschiedenen Stadien der Aβ-Entwicklung ansetzen. «Alle Antikörper, die an den stärker formierten Aβ-Plaques ansetzen, wie Lecanemab, Donanemab und Aducanumab, scheinen dieses Aβ42 besonders gut senken zu können», sagt Univ.-Prof. Dr. med. Reinhold Schmidt, Univ.-Klinik für Neurologie, Graz. So konnte etwa für Donanemab gezeigt werden, dass dieser Antikörper die Aβ-Last nach einem Jahr um 82% senkt.2
Eine neuropathologische Untersuchung des Gehirns einer Patientin, die über 32 Monate mit Aducanumab behandelt worden war, hat ergeben, dass nicht nur Aβ gesenkt wurde, sondern auch die Tau-Pathologie günstig beeinflusst wurde.3 Die Erkenntnis, dass die Clearance von Aβ mit einer Reduktion des Tau sowohl im Tau-PET als auch in den Serumwerten assoziiert ist, wurde auch für andere Antikörper bestätigt.4–6
Klinisches Update
Die Ergebnisse der Phase-III-Studien für Gantenerumab und Lecanemab wurden anlässlich des 16. CTAD(Clinical Trials on Alzheimer’s Disease)-Kongresses im Oktober 2022 in San Francisco präsentiert. Für Gantenerumab konnte in den Studien GRADUATE I und II allerdings nur ein nicht signifikanter Trend von 6–8% Reduktion des Risikos für kognitive Verschlechterung (CDR Sum of Boxes) gezeigt werden.7 Ursache für dieses enttäuschende Resultat ist laut Schmidt, dass es nur bei 28% der behandelten Patient*innen gelungen ist, das Aβ nach 116 Wochen auf unter 24 Centiloide zu senken.
Im Gegensatz dazu ist es gelungen, mit Lecanemab das Amyloid signifikant zu senken und sämtliche klinische Variablen zu verbessern.8 So betrug die Reduktion der Aβ-Last nach 3 Monaten 59,1 Centiloide, der kognitive Verlust (ADAS-Cog14) wurde um 26% reduziert, die Progression (ADCOMS) um 24% verlangsamt und die funktionale Verschlechterung (ADCS-MCI-ADL) um 37% gesenkt.
Schmidt schliesst aus den bisher vorliegenden Daten, dass die Amyloid-Clearance der Schlüssel für die Therapie der AD ist. Wenn es gelingt, die Aβ-Last effektiv und rasch zu senken, können wahrscheinlich auch klinische Effekte erzielt werden. Mit Spannung werden die Resultate der Phase-III-Studie zu Donanemab erwartet. Sind diese positiv, könnten sie die Hypothese der Amyloid-Senkung zur Behandlung der AD untermauern.
Ein Problem dieser Therapien ist das mögliche Auftreten von ARIA («Amyloid-Related Imaging Abnormality») im Sinne von Ödembildung (ARIA-E) oder Hämorrhagien und Mikroblutungen (ARIA-H). Risikofaktoren für ARIA und klinische Effekte sind allerdings noch nicht systematisch analysiert.
Neudefinition der MS-Progression
In der klassischen Klassifikation der MS werden schubförmige und progrediente und bei Letzterer die primär und die sekundär progrediente MS unterschieden.9 Progression ist dabei definiert als stetig zunehmende objektivierbare neurologische Dysfunktion bzw. Behinderung ohne eindeutige Besserung. Traditionell ist die MS eine zweiphasige Erkrankung mit Inflammation im Vordergrund in der ersten und Neurodegeneration in der zweiten Phase. Im heutigen Verständnis handelt es sich bei der MS um ein Kontinuum, in dem fortschreitende Behinderung und neuropathologische Prozesse, die für die Progression verantwortlich sind, bereits zu Beginn vorhanden sind. Als neue Bezeichnungen, die unabhängig von der klinischen Klassifikation in schubförmig oder progredient sind, wurden die Begriffe schubassoziierte Verschlechterung (RAW, «relapse-associated worsening») und Progression unabhängig von Schüben (PIRA, «progression independent of relapse activity») geprägt.10
Die schubunabhängige Progression existiert nicht nur bei der sekundär progredienten MS, sondern kann bereits in der schubförmigen Phase auftreten. Kriterien für eine PIRA sind zunehmende Behinderung ohne Schub bzw. mehr als 90 Tage nach einem Schub sowie deren Bestätigung nach weiteren 3 oder 6 Monaten. Die Behinderungsprogression wird wie folgt definiert:10
-
EDSS
≥1,0 – Baseline ≤5,5
≥0,5 – Baseline >5,5
oder
-
20% Anstieg im 25 Feet Walking Test (T-25FW)
oder
-
20% Anstieg der Störung der Feinmotorik (9HPT, 9 Hole Peg Test)
Die Auswertung der Daten von mehr als 5000 MS-Patient*innen mit Natalizumab in der TOP-Studie hat gezeigt, dass insgesamt 30% über 288 Wochen eine Progression aufwiesen.11 Bei 70% davon war alleine PIRA die Ursache für die Verschlechterung. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Analyse der gepoolten Daten der OPERA-I- und -II-Studien, in denen Ocrelizumab vs. Interferon evaluiert wurde.10 Dabei zeigte sich, dass unter Ocrelizumab die Progression signifikant geringer als unter Interferon war (16% vs. 24%). Bei 88% davon in der Ocrelizumab-Gruppe und bei 80% im Interferon-Arm lag der Progression eine PIRA zugrunde. Nur 17% der Progression konnten durch Schübe erklärt werden.
Eine wesentlich geringere PIRA-Rate ergab eine Studie, in der PIRA allerdings ausschliesslich über EDSS-Verschlechterung, ohne Berücksichtigung von Gehfähigkeit und Feinmotorik, definiert war.12 Prädiktoren für eine PIRA waren dabei eine hohe Schubrate sowie höherer EDSS zu Baseline.
Biologische Marker der Progression
«Ziel ist, die Patienten möglichst früh zu erkennen und zu behandeln. Dafür brauchen wir eine biologische Definition und Marker der Progression», so Dr. med. Franziska Di Pauli, PhD, Abteilung für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck. Die Progression der MS wird durch eine Vielzahl von Mechanismen getrieben, wobei u.a. die anhaltende Inflammation und Läsionen wichtige Rollen spielen.13 MR-Untersuchungen haben gezeigt, dass das Vorhandensein chronisch aktiver Läsionen mit motorischer und kognitiver Behinderung assoziiert ist und diese bereits bei schubförmiger MS nachgewiesen werden können.14 Darüber hinaus treten diese Läsionen unabhängig von der Verlaufsform und einer krankheitsmodifizierenden Therapie auf. Das Vorliegen der Läsionen erlaubt eine prognostische Einschätzung, therapeutisch können sie jedoch laut Di Pauli nicht adressiert werden.
Ein guter Marker für den axonalen Schaden ist das Serum-Neurofilament (sNFL).15 sNFL wird exklusiv im ZNS exprimiert. Ein axonaler Schaden resultiert in erhöhtem NFL sowohl in der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) als auch im Serum. Es hat sich gezeigt, dass sNFL vor allem mit Schüben und chronisch aktiven Läsionen korreliert und ein guter Marker für das Therapieansprechen ist.16
Ein vielversprechender Biomarker für die Progression ist GFAP («glial fibrillary acidic protein»). In einer Metaanalyse konnte gezeigt werden, dass GFAP bei progredienter MS deutlich erhöht ist.17 Hohe Aussagekraft kann durch die Kombination von NFL und GFAP erzielt werden. Di Pauli: «Ist das NFL niedrig und das GFAP hoch, ist das Risiko für eine zukünftige Behinderungsprogression gross.»
Quelle:
20. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), 22.–24. März 2023, Bregenz
Literatur:
1 Amadoru S et al.: Alzheimers Res Ther 2020; 12(1): 22 2 Pontecorvo MJ et al.: JAMA Neurol 2022; 79(12): 1250-9 3 Plowey ED et al.: Acta Neuropathol 2022; 144(1): 143-53 4 Haeberlein SB et al.: J Prev Alzheimers Dis 2022; 9(2): 197-210 5 Swanson CJ et al.: Alzheimers Res Ther 2021; 13(1): 80 6 Ostrowitzki S et al.: Alzheimers Res Ther 2017; 9(1): 95 7 Bateman R et al.: J Prev Alzheimers Dis 2022; 9(Suppl 1): S10 8 van Dyck CH et al.: N Engl J Med 2023; 388(1): 9-21 9 Lublin FD et al.: Neurology 2014; 83(3): 278-86 10 Kappos L et al.: JAMA Neurol 2020; 77(9): 1132-40 11 Kappos L et al.: Mult Scler 2018; 24(7): 963-73 12 Lublin FD et al.: Brain 2022; 145(9): 3147-61 13 Kulmann T et al.: Lancet Neurol 2023; 22(1): 78-88 14 Absinta M et al.: JAMA Neurol 2019; 76(12): 1474-83 15 Khalil M et al.: Nat Rev Neurol 2018; 14(10): 577-89 16 Benkert P et al.: Lancet Neurol 2022; 21(3): 246-57 17 Abdelhak A et al.: Nat Rev Neurol 2022; 18(3): 158-72
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...


