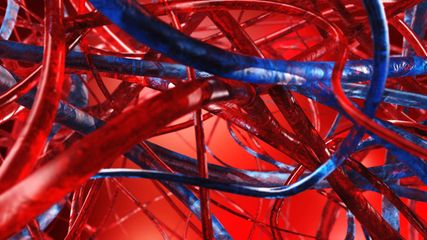©
Getty Images/iStockphoto
Spannende Vorträge zu klassischen und weniger klassischen Themen rund um die Nephrologie
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
01.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ein spezieller Schwerpunkt am diesjährigen Kongress der ERA/EDTA (European Renal Association/European Dialysis and Transplantation Association) war der Prävention der chronischen Niereninsuffizienz («chronic kidney disease», CKD) gewidmet. Weitere spannende Themen dieser wissenschaftlich hochkarätigen Veranstaltung waren u.a. die Assoziation zwischen dem intestinalen Mikrobiom und den IgA-Nephropathien sowie das Absetzen der Kortikosteroide bei nierentransplantierten Kindern.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die chronische Niereninsuffizienz ist häufig eine Folgeerkrankung von Diabetes mellitus (DM) und Hypertonie. In Österreich wurde ein eigenes CKD-Präventionsprogramm entwickelt, das sich durch enge Kooperation zwischen Allgemeinmedizinern und Nephrologen sowie Ärzten aus den involvierten Fachdisziplinen in den Spitälern auszeichnet. Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie, Prof. Dr. med. Karl Lhotta, LKH Feldkirch, zeigte sich erfreut, dass infolge der Implementierung des sog. «60/20-Programms» eine abnehmende Inzidenz an Neudiagnosen zu verzeichnen ist: «Hinsichtlich der Prävention weist Österreich einen Modellcharakter auf, der für viele andere europäische Länder eine Vorbildwirkung haben könnte», konstatierte Lhotta. Die Kernpunkte des «60/20-Konzepts» bestehen darin, dass ab einer Reduktion der Nierenfunktion auf 60 % und dem Vorliegen einer Risikokonstellation die Zuweisung an einen niedergelassenen Nephrologen oder ein Zentrum erfolgen sollte. Bei einer Reduktion auf 20 % sollen eine umfassende Information über die verfügbaren Optionen und eine Entscheidungsfindung über die optimale Form einer Nierenersatztherapie erfolgen.</p> <h2>Neue Antidiabetika dürften nephroprotektiv wirksam sein</h2> <p>Nahezu jeder zweite Patient mit Typ-2-Diabetes (DMT2) entwickelt an einem bestimmten Punkt seiner Erkrankung eine Steigerung der Albuminurie oder einen Abfall der glomerulären Filtrationsrate. Angesichts der erzielten Verbesserungen im Hinblick auf das Überleben bei kardiovaskulären Erkrankungen und der Zunahme der DMT2-Inzidenz ist mit einer Erhöhung der CKD-Prävalenz rechnen.<sup>1</sup><br /> Gemäss der aktuellen Guideline der KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)<sup>1</sup> stellt der HbA<sub>1c</sub>-Wert trotz der damit assoziierten Störfaktoren den geeignetsten Parameter zur Bestimmung der gesamten glykämischen Kontrolle bei CKD dar. Der HbA<sub>1c</sub>-Zielwert wird für die meisten Patienten mit 7 % angegeben. Allerdings wird in den KDIGO-Guidelines darauf hingewiesen, dass Patienten mit diabetischer Niereninsuffizienz im Allgemeinen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Hypoglykämien aufweisen, das mit Fortschreiten der Nierenerkrankung ebenso zunimmt wie die Gesamtmortalität. Der HbA<sub>1c</sub>-Zielwert sollte in diesem Kollektiv demnach höher angesetzt werden. Eine Reduktion dieser Risiken kann möglicherweise auch durch eine Modifikation der Medikation erzielt werden.<br /> In den letzten Jahren kamen einige neue Antidiabetika auf den Markt, die unabhängig von ihrer blutzuckersenkenden Wirkung auch nephroprotektive Effekte ausüben dürften. Dazu zählen die DPP-4-Inhibitoren, die GLP1-Rezeptoragonisten und die SGLT2-Inhibitoren. «Unter einer DPP4-Inhibitor-Therapie und einer gleichzeitigen Blutdruckkontrolle mit RAAS-Antagonisten konnte bei DMT2-Patienten eine Reduktion der Albuminurie beobachtet werden», berichtete die Endokrinologin Dr. med. Drazenka Pongrac Barlovic, Universitätsspital Ljubljana, Slowenien, und betonte, dass bei Diabetikern neben der Blutzuckerkontrolle auch eine effektive Blutdruckkontrolle zu den Grundpfeilern der CKD-Prävention sowie der Verlangsamung der CKD-Progression zählt.</p> <h2>Verbesserung der Lebensqualität von älteren Dialysepatienten</h2> <p>Bei älteren Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung geht der Beginn der Dialysepflichtigkeit mit enormen Auswirkungen auf den funktionellen Status einher.<sup>2</sup> «Das Ausmass an Unabhängigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens wie Essen, Körperpflege etc. nimmt bis drei Monate nach Dialyseinitiierung um mehr als 30 % ab, der funktionelle Status kann nur bei einem von acht Patienten aufrechterhalten werden», berichtete Prof. Dr. med. Vincenzo Bellizzi, Universitätsspital Salerno. Dementsprechend ist auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQOL) im Vergleich zur Normalpopulation in diesem Patientenkollektiv vermindert, was die CKD-Patienten als die grösste Beeinträchtigung empfinden. «Zugunsten einer besseren Lebensqualität und mit dem Ziel, ein aktiveres Leben zu führen, sind manche Patienten bereit, eine verkürzte Lebensspanne in Kauf zu nehmen», erklärte Bellizzi und betonte die Relevanz einer patientenzentrierten Behandlung, die basierend auf der Identifikation der individuellen Patientenziele erfolgen soll.<br /> Ein erstes Modell zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit einer Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD) wurde von Nissensons entwickelt. Es ist gekennzeichnet durch den Wechsel von einer auf der Biochemie zentrierten hin zu einer patientenzentrierten Behandlung. Neben Berücksichtigung der klassischen Indikatoren für die Lebensqualität wie Anämie oder Gewicht ist der Fokus durch Miteinbezug von Faktoren wie Flüssigkeits-, Diabetes-, Medikationsmanagement auf die Verbesserung der komplexen intermediären klinischen Outcomes gerichtet, um so eine Verbesserung der Lebensqualität zu erzielen.<sup>3</sup> <br /> Auch der Vortrag von Dr. med. Anne Kolko-Labadens, Paris, war der Lebensqualität von älteren Dialysepatienten gewidmet. Die Nephrologin plädierte für mehr körperliche Aktivitäten in diesem Patientenkollektiv. Sie bedauerte, dass nur an wenigen Zentren entsprechende Übungsprogramme implementiert werden, und veranschaulichte anhand von Beispielen, wie auf einfache Weise sogar die Zeit während der Dialyse für Kräftigung und Ausdauertraining genutzt werden kann. «Radfahren kann auf einfache Weise mit der Dialyse kombiniert und so die Zeit genutzt werden, um einer Dekonditionierung entgegenzuwirken. Intensität und Dauer können dabei individuell angepasst und graduell gesteigert werden. Krafttraining mittels elastischer Bänder ist ebenfalls während der Dialyse möglich, genauso wie körperliche Aktivitäten mit einem Coach oder Physiotherapeuten an den dialysefreien Tagen», erklärte die Expertin und berichtete von einer guten Patientenadhärenz beim Praktizieren dieser Programme. Alter sollte keinen Barrierefaktor darstellen, ganz im Gegenteil: Ältere Dialysepatienten profitieren von der Teilnahme an Bewegungsprogrammen, indem dadurch eine Verbesserung der Lebensqualität und des Performancestatus und in weiterer Folge eine Aufrechterhaltung der Autonomie in den Aktivitäten des täglichen Lebens bewirkt werden können.</p> <h2>Absetzen von Kortikosteroiden bei Nierentransplantation</h2> <p>Jahrelang umfasste die immunsuppressive Therapie bei Kindern nach Nierentransplantation (NTx) die Gabe von Kortikosteroiden. Es ist jedoch bekannt, dass Kortikosteroide nicht nur zu den langfristigen substanzassoziierten Nebenwirkungen wie z.B. der Induktion einer Osteoporose, sondern auch zu einer Hemmung des Grössenwachstums führen.<sup>4</sup> Aus diesem Grund gehen seit gut einem Jahrzehnt die Bestrebungen dahin, die Verabreichung von Steroiden entweder zu vermeiden bzw. früh (<7 Tage nach der NTx), mittelfristig (>7 Tage und <1 Jahr) oder später (>12 Monate) abzusetzen.<sup>5</sup> <br /> So konnte in der von Höcker et al durchgeführten Studie bei Absetzen der Kortikosteroide bis drei Monate nach der Nierentransplantation eine signifikante Überlegenheit gegenüber der Kontrollgruppe mit fortgesetzter Einnahme in mehreren Bereichen nachgewiesen werden: 2 Jahre nach Absetzen wies die Gruppe ohne Kortiko-steroide ein besseres Wachstum, eine Reduktion der kardiovaskulären Risikofaktoren, eine niedrigere Prävalenz des metabolischen Syndroms sowie bessere Glukose- und Lipidspiegel auf. Gleichzeitig konnte kein erhöhtes Risiko für eine akute Abstossung oder eine instabile Transplantatfunktion festgestellt werden.<sup>4</sup><br /> In einer Metaanalyse von Studien zum Absetzen der Kortikosteroide bzw. zur Vermeidung der Gabe von Kortikosteroiden konnte ebenfalls gezeigt werden, dass alle untersuchten Studienprotokolle hinsichtlich der Prävention einer akuten Abstossung und der Aufrechterhaltung der Transplantatfunktion effektiv waren. Im Prinzip wurden die von Höcker nachgewiesenen Effekte bestätigt.<br /> Der Zeitpunkt des Absetzens der Kortikosteroide bestimmt, ob monoklonale Antikörper zum Einsatz kommen – dies ist beim Verzicht auf Kortikosteroide sowie bei einem frühen Absetzen derselben der Fall. In der erwähnten Übersichtsarbeit kamen bei Patienten mit niedrigem Risiko monoklonale Antikörper in Kombination mit Mycophenolat mofetil + Tacrolimus zur Anwendung. Bei Hochrisikopatienten hat sich die polyklonale Induktion als effektiv erwiesen. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Substanzen, die in verschiedenen Protokollen beim Absetzen der Kortikosteroide zum Einsatz kamen.<br /> Zurzeit liegt noch keine klare Evidenz darüber vor, ob das Absetzen der Kortikosteroide Auswirkungen auf das Rezidivrisiko einer primären Glomerulonephritis hat. Ebenso ist noch nicht geklärt, ob bei steroidfreien Patienten die Wahl des bei der Induktion verwendeten Antikörpers (Lymphozyten-depletierend vs. Anti-IL2R-Inhibitor) für die Produktion von spenderspezifischen Anti-HLA-Antikörpern eine Rolle spielt. Diese Aspekte müssen – unter Messung der Anti-HLA-Antikörper-Spiegel – in zukünftigen Studien noch weiter abgeklärt werden.<sup>5</sup><br /> «Zusammenfassend kann jedoch konstatiert werden, dass das Absetzen der Kortikosteroide bei Kindern mit Nierentransplantation eine sichere und effektive Strategie darstellt, sofern die individuellen Pros und Cons sorgfältig gegeneinander abgewogen werden», resümierte Prof. Dr. med. Dr. Ryszard Grenda, Children’s Memorial Health Institute, Warschau.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Innere_1604_Weblinks_Seite90.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Intestinales Mikrobiom und IgA-Nephropathie: Interaktionen</h2> <p>Das intestinale Mikrobiom in seiner Funktion zur Aufrechterhaltung eines intakten Immunsystems ist zunehmend Gegenstand intensiver Forschung. Für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen ist inzwischen nachgewiesen, dass sie mit einer Dysbiose hinsichtlich der Zusammensetzung des Mikrobioms assoziiert sind. Aber auch bei der IgA-Nephropathie, der häufigsten glomerulären Erkrankung, gibt es immer mehr Hinweise, dass die sog. «Mukosa-Nieren-Achse» eine relevante Rolle spielen dürfte: Die systemische Immunresponse auf mukosale Antigene ist bei der IgA-Nephropathie erhöht. Darüber hinaus wurde eine erhöhte Reaktivität auf diätetische Proteine beobachtet, die mit einer subklinischen mukosalen Inflammation einherging. Ebenso wurden Korrelationen zwischen dem Vorliegen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und IgA-Nephropathie nachgewiesen, wenn auch noch unklar ist, ob diese auf eine gemeinsame Pathogenese zurückzuführen sind.<sup>6</sup><br /> Insgesamt dürfte bei der IgA-Nephropathie eine multifaktorielle Genese vorliegen, wobei der auslösende Mechanismus bislang noch nicht identifiziert ist. Dem intestinalen Immunsystem dürfte jedenfalls eine tragende Rolle zukommen: Das Mikrobiom trägt zur Immunfunktion von MALT («mucosa-associated lymphoid tissue») bei, dessen Aktivität wiederum von diätetischen und Umweltfaktoren beeinflusst wird. Das intestinale Mikrobiom kontrolliert die Reifung von lymphatischem Gewebe und trägt zur Immunfunktion von MALT bei, z.B. indem es die Ausgewogenheit der T-Helferzellen kontrolliert.<sup>7</sup><br /> In einer kürzlich durchgeführten genomweiten Studie konnten interessante neue Assoziationen zwischen IgA-Nephropathie und Genloci gefunden werden, die mit der Aufrechterhaltung der mukosalen Barriere und der intestinalen MALT-Response auf Pathogene sowie mit dem Risiko für die Entwicklung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen assoziiert sind und die Hypothese einer starken Interaktion zwischen Intestinum und Niere bei IgA-Nephropathie untermauern (Abb. 2).<sup>7, 8</sup><br /> «Diese Hypothese klingt auch insofern verlockend, als sie neue Therapieoptionen bietet, die auf die subklinische intestinale Inflammation abzielen», ergänzte Prof. Dr. med. Rosanna Coppo, Regina Margherita Children’s Hospital, Torino.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Innere_1604_Weblinks_Seite91.jpg" alt="" width="" height="" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Molitch E at al: Diabetic kidney disease: a clinical update from Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Kidney Int 2015; 87: 20-30 <br /><strong>2</strong> Kurella Tamura M et al: Functional status of elderly adults before and after initiation of dialysis. N Engl J Med 2009; 361: 1539-47 <br /><strong>3</strong> Nissensons AR: Improving outcomes for ESRD patients: shifting the quality paradigm. Clin J Am Soc Nephrol 2014; 9: 430-4 <br /><strong>4</strong> Höcker B et al: Improved growth and cardiovascular risk after late steroid withdrawal: 2-year results of a prospective, randomised trial in paediatric renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2010; 25: 617-24 <br /><strong>5</strong> Grenda R: Steroid withdrawal in renal transplantation. Pediatr Nephrol 2013; 28: 2107-12 <br /><strong>6</strong> Floege J, Feehally J: The mucosa-kidney axis in IgA nephropathy. Nat Rev Nephrol 2016; 12: 147-56 <br /><strong>7</strong> Coppo R: The intestine-renal connection in IgA nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2015; 30: 360-6 <br /><strong>8</strong> Kiryluk K et al: Discovery of new risk loci for IgA nephropathy implicates genes involved in immunity against intestinal pathogens. Nat Genet 2014; 46: 1187-96</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen
Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...
Therapie der ANCA-assoziierten Vaskulitis: Gibt es steroidfreie Alternativen?
Noch in den 1950er-Jahren verstarben rund 90% der Patient:innen, die an einer mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierten Vaskulitis litten, im ersten Jahr ...
Spannende Fälle
Neben ihren Forschungsergebnissen stellten Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen am Jahreskongress 2024 in Basel auch einige spannende und lehrreiche Fälle vor. Wir präsentieren Ihnen ...