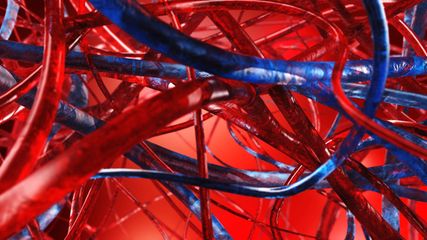<p class="article-intro">In der täglichen Praxis beschäftigt uns häufig die Frage nach der Indikation für die Zuweisung zur spezialärztlichen Mitbeurteilung. So auch bei Patienten mit Nierenproblemen: Wann sollte der Nephrologe zu Rate gezogen werden? Und bringt das überhaupt etwas in Bezug auf harte Endpunkte? Zur Behandlung von Nierenarterienstenosen: Wann ist eine Dilatation wirklich indiziert? Oder ist ein konservatives Management doch besser?</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Zuweisung in die nephrologische Sprechstunde spätestens bei eGFR <30ml/min</li> <li>Bei Hypertonie, insbesondere mit koexistenter Albuminurie, und bei Diabetikern konsequenter Einsatz einer RAAS-Blockade (ACE-Hemmer oder Sartan)</li> <li>Im Rahmen der Abklärung sekundärer Hypertonieursachen auch Suche nach Nierenarterienstenosen und interdisziplinärer Entscheid für die Behandlung dieser Stenosen – meist ist ein konservatives Management einer Angioplastie vorzuziehen.</li> </ul> </div> <h2>Fallbericht</h2> <h2>Anamnese und Befunde</h2> <p>Die Zuweisung der 56-jährigen Patientin erfolgte zur Blutdruck- und Blutzucker- einstellung. Langjährige Hypertonie- anamnese und zuletzt Hypertonie Grad 2 unter antihypertensiver Zweifachtherapie (Calciumantagonist und Betablocker). 1988 Erstdiagnose eines Diabetes mellitus, Insulintherapie seit 1999 (HbA<sub>1c</sub>-Wert 8,1 % ); keine Sekundärkomplikationen.<br />An relevanten Begleiterkrankungen war neben einer koronaren Herzerkrankung eine chronisch progrediente Niereninsuffizienz mit positivem Eiweissnachweis im Streifentest bekannt.<br />Bei den Abklärungen fiel eine schwere Niereninsuffizienz mit nephrotischer Proteinurie (CKD Stadium G4 A3) auf. Ein eigentliches nephrotisches Syndrom (Trias Proteinurie, Hypoalbuminämie, Ödeme) lag nicht vor. Das Urinsediment war bland, sonomorphologisch Nachweis eines mässigen Nierenparenchymschadens und leichte Differenz der Poldistanzen (links 9cm, rechts 10cm). Die Duplexsonografie der Nierenarterien zeigte links eine mindestens 70 % ige arteriosklerotische Nierenarterienstenose. Der Widerstandsindex betrug links 0,59 und rechts 0,71, sodass wir aufgrund der apparativen Untersuchungen von einer relevanten Nierenarterienstenose links ausgingen.</p> <h2>Beurteilung</h2> <p>Präterminale Niereninsuffizienz unter hypertensiven Blutdruckwerten mit Nachweis einer einseitigen Nierenarterienstenose. Was tun?</p> <h2>Differenzialdiagnose und weitere Abklärungen</h2> <p>In Bezug auf die Entität der Nephropathie kamen differenzialdiagnostisch in erster Linie eine Nephroangiosklerose bei langjähriger Hypertonie oder eine diabetische Nephropathie in Betracht. Die häufig mit einer diabetischen Nephropathie assoziierten Stigmata einer beidseitigen Nierenhypertrophie und einer begleitenden diabetischen Retinopathie fehlten bei unserer Patientin. Die ausgeprägte Albuminurie könnte auch vor dem Hintergrund einer sekundären fokal segmentalen Glomerulosklerose (FSGS) erklärt werden, wie sie häufig bei verschiedenen Nierenerkrankungen im Endstadium aufgrund eines glomerulären Hyperfiltrationsschadens beobachtet wird. Wir entschieden uns für die Durchführung einer Nierenbiopsie links mit zwei Fragestellungen: <br />1. Identifizierung der Nierengrunderkrankung. Da die Patientin für eine Nierentransplantation qualifiziert, ist es in Hinblick auf ein mögliches Rekurrenzrisiko im Transplantat opportun, die Nierenpathologie zu kennen.<br />2. Aussage über die Chronizität und Reversibilität des Nierenschadens zur Abschätzung der Prognose und potenziellen Effektivität einer Dilatation der stenosierten Nierenarterie <br />In den feingeweblichen Untersuchungen des Nierengewebes zeigten sich eine schwere Nephroangiosklerose als Folge der arteriellen Hypertonie und auch eine beginnende diabetische Nephropathie (noduläre Glomerulosklerose Kimmelstiel- Wilson), daneben ein hoher Anteil verödeter Glomerula und viel Tubulusatrophie und interstitielle Fibrose als Ausdruck der Chronizität der Nierenerkrankung.</p> <h2>Behandlung</h2> <p>Bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz begleitet von hypertensiven Blutdruckwerten ist in Bezug auf die Physiologie bekannt, dass nach erfolgreicher Blutdruckeinstellung (welche zur Verhinderung von kardiovaskulären Ereignissen prioritär ist) aufgrund der Reduktion des glomerulären Filtrationsdruckes auch die GFR abfallen wird. Blieb also die Frage: Können wir uns mittels Angioplastie der Nierenarterienstenose Nierenfunktion und Zeit erkaufen und zusätzlich die Blutdrucksituation verbessern? Da wir nach Blutdruckeinstellung von einer Dialyse- indikation ausgingen, die noch relativ niedrigen Widerstandsindices auf der nichtstenosierten rechten Niere für eine funktionelle Reserve sprachen<sup>1</sup> und wir bioptisch zwar viel Chronizität, allerdings auch ein Verbesserungspotenzial der Nierenfunktion sahen, entschieden wir uns für eine Angioplastie der Nierenarterie. Begleitend wurden ein ACE-Hemmer (Indikation: grundsätzliche Erstlinienthe-rapie bei arterieller Hypertonie mit Proteinurie, Diabetes und Nierenarterienstenose) sowie ein Statin (Indikation: Fettstoffwechselstörung und generalisierte Arteriosklerose sowie Minimierung des Risikos von Cholesterinembolien im Rahmen der Katheterintervention) begonnen.</p> <h2>Verlauf</h2> <p>Nach erfolgter Dilatation der Nierenarterienstenose (Abb. 1) kam es einerseits zu einer Konsolidierung der Blutdrucksituation und andererseits zu einer Verbesserung der Nierenfunktion (eGFR nach CKD-EPI vor Intervention 6ml/min, nach Intervention 15ml/min). Aktuell wird die Patientin für eine Nierentransplantation abgeklärt. Als überbrückendes Dialyseverfahren bis zur Transplantation optiert die Patientin für eine Peritonealdialyse-Behandlung.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Innere_1703_Weblinks_s40.jpg" alt="" width="1417" height="998" /></p> <h2>Diskussion</h2> <p>Die frühzeitige Zuweisung zur nephrologischen Mitbetreuung ist Prognose-bestimmend und nach internationalen Richtlinien (KDIGO 20122, Abb. 2) spätestens bei einer eGFR <30ml/min empfohlen. Ferner sollten eine Albuminurie wie auch eine glomeruläre Hämaturie abgeklärt werden. Auch eine therapierefraktäre Hypertonie, Nephrolithiasis, hereditäre Nierenerkrankungen (z.B. ADPKD) rechtfertigen eine nephrologische Konsultation. <br />In der Nierensprechstunde stellt sich zunächst die Frage nach der Ursache der Nierenerkrankung und es erfolgt die Indikationsstellung für eine allfällige Nierenbiopsie. Danach steht neben der Behandlung der Sekundärkomplikationen (renale Anämie, renale Osteodystrophie, arterielle Hypertonie und metabolische Azidose) eine Progressionsverzögerung der Nierenerkrankung im Zentrum der Betreuung. Dazu gehören neben einer möglichst kausalen Therapie Massnahmen wie eine optimierte Blutdruckeinstellung, bei Diabetikern eine adäquate Blutzuckerkontrolle, die Behandlung von Fettstoffwechselstörungen sowie die Initiierung von Lebensstilveränderungen und die Information über potenzielle Nephrotoxine (z.B. NSAR). Ferner erfolgen eine Aufklärung über die möglichen Verläufe der Erkrankung sowie die frühzeitige Orientierung über die Optionen für Nierenersatzverfahren (Hämodialyse, Peritonealdialyse, Transplantation). Diese können dann adäquat vorbereitet werden: Im Falle einer gewünschten Hämodialysebehandlung sollte frühzeitig operativ ein Gefässzugang (arteriovenöse Fistel) angelegt werden, im Falle einer Transplantation können die notwendigen Abklärungen von Empfänger und Spender sorgfältig geplant werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Innere_1703_Weblinks_s40_2.jpg" alt="" width="1419" height="1256" /><br />Bei unserer Patientin zeigte sich bioptisch eine diabetische Nephropathie. Der klassische Verlauf der «Zuckerniere» imponiert zunächst durch tiefnormale Serumkreatininwerte (als Ausdruck einer kompensatorischen Hyperfiltration – die Niere ist allerdings bereits krank). Parallel zeigt sich eine zunehmende Albuminurie, welche als Mikroalbuminurie bereits lange vor dem Kreatininanstieg nachweisbar ist. Es besteht eine strenge Indikation für eine RAAS-Blockade, einerseits zur Blutdruckeinstellung, andererseits zur Reduktion der auch prognostisch wichtigen Proteinurie. Rasch progrediente Verläufe können innerhalb weniger Jahre von einer normalen Nierenfunktion zur terminalen Niereninsuffizienz führen.<br />Die Therapie von relevanten Nierenarterienstenosen hat sich im Verlauf der letzten Jahre stark gewandelt. Während die Indikation für Angioplastien zuvor inflationär gestellt wurde, weisen die Daten der STAR-3 und ASTRAL-Studie<sup>4 </sup>(2009) und der grossen CORAL-Studie5 von 2014 sowie einer aktuellen kumulativen Metaanalyse<sup>6</sup> darauf hin, dass ein konsequentes konservatives Management (inkl. optimierter Blutdruckkontrolle mittels RAAS-Blockade, bedarfsweise ergänzt mit einem Thiaziddiuretikum, Calciumantagonisten oder Aldosteronantagonisten) in den meisten Fällen einer Angioplastie überlegen ist. In der Praxis können allerdings nach sorgfältiger Prüfung folgende Patientengruppen dennoch von einer Angioplastie profitieren: therapierefraktäre Hypertonie, rezidivierendes «flash pulmonary edema» (Lungenödem) oder sich rasch verschlechternde Nierenfunktion. In unserer Institution wird der Entscheid für eine Ballonangioplastie bei relevanten Nierenarterienstenosen im Rahmen eines interdisziplinären Hypertonie-Boards gefällt.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Radermacher J et al: Use of Doppler ultrasonography to predict the outcome of therapy for renal-artery stenosis. N Engl J Med 2001; 344: 410-7 <strong>2</strong> Kidney Disease: Improv- ing Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group: KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int 2013; 3(Suppl): 1-150 <strong>3</strong> Bax L et al: Stent placement in patients with atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function: a randomized trial. Ann Intern Med 2009; 150: 840-8 <strong>4</strong> Wheatley K et al: Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis. N Engl J Med 2009; 361: 1953-62 <strong>5</strong> Cooper CJ et al: Stenting and medical ther-apy for atherosclerotic renal-artery stenosis. N Engl J Med 2014; 370: 13-22 <strong>6</strong> Raman G et al: Comparative effectiveness of management strategies for renal artery stenosis: an updated systematic review. Ann Intern Med 2016; 165: 635-49</p>
</div>
</p>