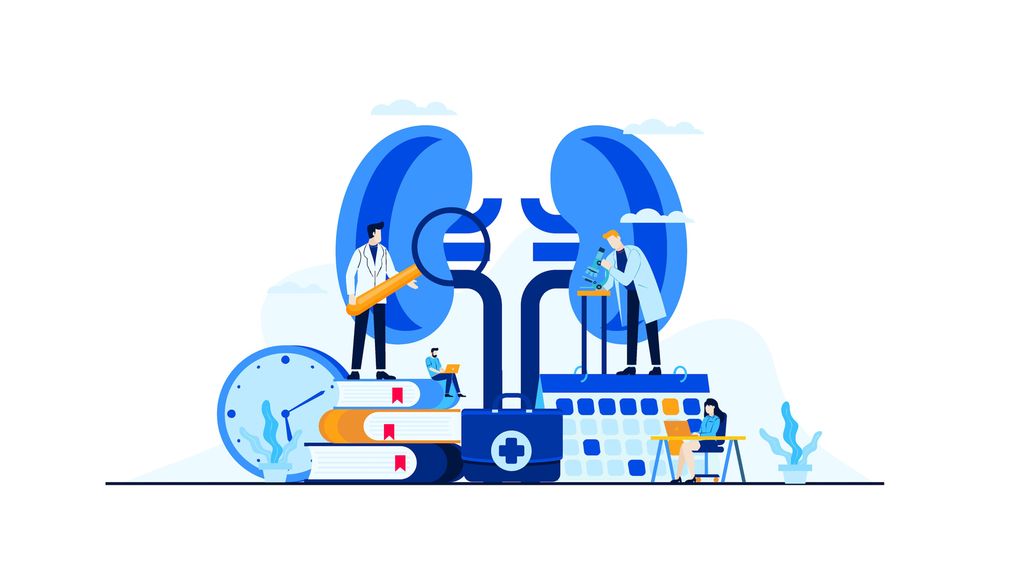
«Nie zuvor gab es in der Nephrologie so viele Fortschritte»
Bericht:
Dr. med. Sabina Ludin
Chefredaktorin
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
In der medikamentösen Behandlung der chronischen Niereninsuffizienz (CKD) hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Neuerungen gibt es aber auch in Bezug auf die Definition der CKD und die Schätzung der glomerulären Filtrationsrate. Prof. Dr. med. Sophie De Seigneux, Chefärztin, Abteilung für Nephrologie und Hypertonie, Universitätsspital Genf, gab in der Hot-Topics-Session der SGN-Jahresversammlung einen Überblick über die wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiet der CKD.
Keypoints
-
In der Formel CKD-EPI 2021 werden nur noch Alter und Geschlecht berücksichtigt.
-
Der Korrekturkoeffizient für Menschen schwarzer Hautfarbe ist nicht mehr zeitgemäss.
-
Altersspezifische eGFR-Schwellenwerte für die Diagnose einer CKD bringen Vorteile:
-
Bei älteren Menschen mit einem rein altersbedingten GFR-Verlust können dadurch unnötige Behandlungen vermieden werden.
-
Bei jungen Menschen kann eine beginnende Niereninsuffizienz in einem früheren Stadium entdeckt werden.
-
Finerenon senkt bei CKD-Patienten mit Typ-2-Diabetes das kardiorenale Risiko.
-
Bei positiver PLAR2-Serologie kann für die Diagnose einer membranösen Nephropathie in der Regel auf die Biopsie verzichtet werden.
-
Orale Steroide könnten künftig Einzug halten in die Behandlung der IgA-Nephropathie.
Neue Formel: CKD-EPI 2021
Die bislang verwendete Formel «CKD-EPI 2009» zur Schätzung der glomerulären Filtrationsrate (eGFR) enthält einen Koeffizienten für die sog. «racial correction» bei Menschen schwarzer Hautfarbe. Dieser Koeffizient beruht auf einer Beobachtung in der ursprünglichen Kohorte: Man hatte dort bei den Afroamerikanern im Vergleich zur restlichen Population höhere Kreatininspiegel bei gleichen mGFR-Werten gesehen. Seit einiger Zeit ist in den USA eine Diskussion um diesen Koeffizienten im Gang, da Rasse kein biologisches Merkmal, sondern ein soziales Konstrukt ist. Die Task Force der National Kidney Foundation und der American Society of Nephrology (NFK-ASN) empfiehlt deshalb seit Kurzem die Verwendung einer neuen Formel ohne Korrektur für die Rasse (CKD-EPI 2021).1,2
Die Gruppe von Andrew S. Levey untersuchte anhand eines grossen Datensatzes verschiedene eGFR-Formeln.3 Dabei zeigte sich, dass die bisher gebräuchliche Kreatinin-Formel, die Alter, Geschlecht und Rasse verwendet, die gemessene GFR (mGFR) bei Schwarzen im Median um 3,7ml/min/1,73m2 unterschätzt, in geringerem Mass auch bei Nicht-Schwarzen (Median: 0,5ml/min/1,73m2). Wird die «racial correction» in der bisherigen Formel weggelassen, resultiert bei Schwarzen eine im Median um 7,1ml/min/1,73m2 unterschätzte mGFR. Auch die neue Kreatinin-Formel, die Alter und Geschlecht verwendet und die Rasse ausklammert, unterschätzt die mGFR bei Schwarzen (Median: 3,6ml/min/1,73m2) und überschätzt sie bei Nicht-Schwarzen (Median: 3,9ml/min/1,73m2). Eine genauere Schätzung und geringere Unterschiede zwischen Schwarzen und Nicht-Schwarzen ergeben sich bei Verwendung der neuen Kreatinin-Cystatin-C-Formel, welche die Rasse ebenfalls ausklammert.
«In Genf haben wir uns nach ausführlicher Diskussion dazu entschieden, die neue Kreatinin-Formel zu verwenden, da wir in Genf eine sehr gemischte Population haben und die neue Formel fairer ist. Ausserdem waren wir bisher immer unsicher, ob wir den Koeffizienten auch bei Afrikanern verwenden sollen. Die Einführung desselben beruht nämlich lediglich auf Beobachtungen bei Afroamerikanern und wurde nie in schwarzen Populationen ausserhalb der USA validiert», erklärte DeSeigneux. «Im Übrigen ist der Fehlerbereich für eine geschätzte GFR, die immer eine gewisse Abweichung von der gemessenen GFR aufweist, im klinischen Alltag akzeptabel.»
Die KDIGO empfiehlt, für das CKD-Screening für die Schätzung der GFR neben dem Serumkreatinin auch das Serum-Cystatin-C zu verwenden, da die Schätzung dadurch genauer wird.4 «Über diese Empfehlung müssen wir meines Erachtens noch diskutieren. Persönlich bin ich nicht davon überzeugt, da diese Strategie mit mehr Kosten verbunden ist und ich nicht sicher bin, ob sich die Behandlung dadurch wesentlich verbessert – ausser in sehr wenigen speziellen Situationen», so die Spezialistin.
Altersspezifische GFR-Schwellenwerte
Eine weitere Neuerung betrifft die Definition der CKD resp. den eGFR-Schwellenwert. Bisher gilt für die Diagnose einer CKD für alle Altersgruppen ein Grenzwert von 60ml/min/1,73m2. Anhand einer ausgedehnten Literaturrecherche konnten Delanaye et al. jedoch zeigen, dass die eGFR auch bei nierengesunden Menschen mit zunehmendem Alter kontinuierlich abnimmt.5 Zudem ist die eGFR-Schwelle, ab der das Sterberisiko erhöht ist, nicht für alle Altersgruppen gleich. Bei jungen Menschen steigt das Risiko schon bei einer eGFR <75ml/min/1,73m2, bei älteren erst bei <45ml/min/1,73m2. Die Autoren fordern deshalb, für die Definition der CKD bei jungen Menschen einen höheren und bei älteren Menschen einen niedrigeren GFR-Grenzwert zu verwenden.5 Dies hätte zur Folge, dass auf der einen Seite die CKD-Inzidenz in der älteren Population abnimmt und unnötige Behandlungen vermieden werden können. Auf der anderen Seite könnte bei jungen Menschen eine beginnende Niereninsuffizienz früher erkannt werden, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem eine progressive Nierenschädigung noch vermeidbar ist.
In einer grossen Kohortenstudie mit über 200000 Teilnehmern wurde untersucht, welche Auswirkungen die Anwendung von altersspezifischen Schwellenwerten im Vergleich zum fixen Schwellenwert hat.6 Es zeigte sich, dass bei den älteren Probanden die Verwendung eines altersspezifischen niedrigeren Schwellenwerts keinen Einfluss auf das Risiko für eine Niereninsuffizienz oder renal bedingten Tod hat. Die aktuellen CKD-Kriterien, bei denen für alle Altersgruppen derselbe eGFR-Schwellenwert verwendet wird, führen zu einer Überschätzung der CKD-Last in der älteren Bevölkerung, zu Überdiagnosen und zu unnötigen Behandlungen bei vielen Menschen mit einem altersbedingten GFR-Verlust. «Dies zeigt, dass es wahrscheinlich richtig ist, altersspezifische Grenzwerte zu verwenden», so De Seigneux.
MedikamentöseBehandlung der CKD
2021 wurden bekanntlich die SGLT2-Inhibitoren und die GLP-1-Rezeptoragonisten in die KDIGO-Guidelines zur Behandlung der CKD aufgenommen.4 Noch nicht in den Leitlinien berücksichtigt sind die Resultate zum nichtsteroidalen Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten Finerenon. Agarwal et al. führten eine Post-hoc-Analyse der FIDELIO-CKD- und der CREDENCE-Studie durch.7 Auf den ersten Blick sind die Resultate der beiden Studien sehr unterschiedlich. In Bezug auf den primären Endpunkt ergab FIDELIO-CKD eine Risikoreduktion von 18% unter Finerenon und CREDENCE eine Risikoreduktion von 30% unter Canagliflozin. Da sich die beiden Studien hinsichtlich Ein- und Ausschlusskriterien, Studienpopulation und Definition des Endpunkts (renal in FIDELIO-CKD, kardiorenal in CREDENCE) unterscheiden, können die Resultate jedoch nicht direkt miteinander verglichen werden. In der nun publizierten Post-hoc-Analyse sollte für diese Unterschiede korrigiert werden: So wurden aus FIDELIO-CKD nur die Probanden in die Analyse eingeschlossen, die die Einschlusskriterien der CREDENCE-Studie erfüllen, und es wurde ein kombinierter kardiorenaler Endpunkt verwendet. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich auch für Finerenon eine Reduktion des relativen Risikos um 26%. Nach Korrektur der Studienunterschiede, zeigt sich somit, dass Canagliflozin und Finerenon das kardiorenale Risiko bei CKD-Patienten mit Typ-2-Diabetes und einer hohen Albuminurie gleichermassen senken. «Diese Analyse spricht dafür, dass Finerenon für die entsprechende Patientenpopulation in die Guidelines aufgenommen wird», folgerte die Spezialistin und ergänzte: «In den neusten Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Nephrologie wird Finerenon bereits als zusätzliche Behandlungsoption für CKD-Patienten mit Typ-2-Diabetes erwähnt.»8
Behandlung der Hyperphosphatämie
Die Behandlung der Hyperphosphatämie mit Phosphatbindern, welche die Phosphatresorption im Darm hemmen, ist für die meisten Patienten mit Schwierigkeiten verbunden. Es wird deshalb eifrig nach neuen Substanzen gesucht. Zwei vielversprechende Kandidaten sind Tenapanor und EOS789, die die Phosphatresorption im Darm durch Blockierung des passiven (parazellulären) resp. aktiven (transzellulären) Transports hemmen.
Die 2021 publizierte AMPLIFY-Studie ergab, dass die Hyperphosphatämie bei Dialysepatienten durch die Kombination von Tenapanor mit einem Phosphatbinder besser behandelt werden kann als mit einem Phosphatbinder allein.9 Ausserdem kann durch die zusätzliche Gabe von Tenapanor die tägliche Dosis des Phosphatbinders von durchschnittlich 14,7 Tabletten auf 3 Tabletten reduziert werden, wie eine weitere Studie zeigt.10 In beiden Studien war als Nebenwirkung eine hohe Rate an milden bis moderaten Diarrhöen zu verzeichnen.
EOS789 ist ein neuer Pan-Phosphattransporter-Blocker. In präklinischen Studien erhöhte EOS789 bei gesunden Mäusen die fäkale Phosphatausscheidung und senkte die Phosphatämie. Auch bei Mäusen mit einer Niereninsuffizienz senkt die Substanz das Serumphosphat sowie FGF-23 und PTH. Bei Mäusen, die mit phosphatreicher Nahrung gefüttert wurden, reduzierte EOS789 ausserdem sehr stark vaskuläre Kalzifikationen und verbesserte die Nierenfunktion.11 Ob sich diese vielversprechenden Resultate in klinischen Studien bestätigen werden, bleibt abzuwarten.
Membranöse Nephropathie: Kann die PLA2R-Serologie die Biopsie ersetzen?
70–80% der Patienten mit einer membranösen Nephropathie weisen Anti-Phopholipase-A2-Rezeptor(PLA2R)-Antikörper auf. Ende 2018 publizierte eine Gruppe der Mayo Clinic eine Single-Center-Studie, in welcher gezeigt wurde, dass die Biopsie bei Patienten mit Proteinurie, positiver PLA2R-Serologie und erhaltener Nierenfunktion keine relevanten zusätzlichen Informationen bringt.12 Dieses Ergebnis wurde nun von der gleichen Gruppe in einer Studie an verschiedenen Zentren in den USA und Spanien bestätigt: Bei Patienten mit erhaltener Nierenfunktion ohne Begleiterkrankungen oder Diabetes und der üblichen klinischen Präsentation bestätigt ein positiver Anti-PLA2R-Test (ELISA) oder ein positiver Immunfluoreszenztest die Diagnose einer membranösen Nephropathie und macht eine Nierenbiopsie überflüssig. «Letztere kann hingegen bei Patienten mit verminderter eGFR zusätzliche Informationen bringen, die unter Umständen die Behandlung verändern», ergänzte De Seigneux.
IgA-Nephropathie: Die Steroide sind wieder im Spiel
Die TESTING-Studie untersuchte, ob Patienten mit einer IgA-Nephropathie von einer oralen Steroidbehandlung zusätzlich zur Standardbehandlung, inkl. maximal dosierter RAAS-Blockade, profitieren. Die Patienten erhielten während 2 Monaten Methylprednisolon 0,6–0,8mg/kg/d (max. 48mg/d) mit anschliessendem Ausschleichen über 6–8 Monate oder Placebo. Nach dem Einschluss von 262 Probanden musste die Studie wegen des gehäuften Auftretens schwerer Infektionen vorzeitig abgebrochen werden.14 Mit verändertem Studiendesign – Methylprednisolon in niedriger Dosis (0,4mg/kg/d, max. 32mg/d) plus antibiotische Prophylaxe gegen Pneumocystis-Pneumonie während der ersten 12 Wochen – wurde die Studie 2016 wieder aufgenommen.
An der Kidney Week der American Society of Nephrology im November 2021 präsentierte Vlado Perkovic nun die Ergebnisse der gesamten Studie.15 Insgesamt wurden 503 Patienten mit IgA-Nephropathie randomisiert, der primäre Endpunkt war definiert als 40%ige Abnahme der eGFR oder Nierenversagen (Dialyse, Transplantation oder renal bedingten Tod) und das mittlere Follow-up betrug 4,2 Jahre. Die Behandlung mit Methylprednisolon führte zu einer eindrücklichen Reduktion des primären Endpunkts um 47% (HR: 0,53%; 95% CI: 0,39–0,72; p<0,0001). Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten unter der Steroidbehandlung häufiger auf als unter Placebo (28 vs. 7 Patienten, p=0,0004), wobei dies vor allem für die hohe Dosis gilt (22 vs. 4, p=0,0003).Unter der reduzierten Dosis war die Rate an schwerewiegenden Nebenwirkungen deutlich geringer (6 vs. 3, p=0,50). «Um eine endgültige Einschätzung geben zu können, müssen wir auf die Publikation der Ergebnisse warten. Aber es ist gut möglich, dass wir die Behandlung der IgA-Nephropathie aufgrund dieser Ergebnisse künftig anpassen werden. Ein offener Punkt, der noch diskutiert werden muss, sind die zu erwartenden metabolischen Nebenwirkungen», so die Referentin.
Fazit
«Wir erleben gerade eine aufregende Zeit in der Nephrologie. Noch nie gab es so viele Fortschritte wie in den letzten Jahren. Die grösste Herausforderung ist es nun, diese Veränderungen in den klinischen Alltag zu übertragen. Nicht alle neuen Substanzen werden zu grossen Veränderungen in der Behandlung führen, aber die Entwicklung im Bereich der chronischen Niereninsuffizienz ist generell sehr positiv», schloss De Seigneux.
Quelle:
53. Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Nephrologie (SGN), 9. und 10. Dezember 2021, Interlaken
Literatur:
1 Delgado C et al.: J Am Soc Nephrol 2021; 32: 2994-3015 2 https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator/formula 3 Inker LA et al.; Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration: N Engl J Med 2021; 385: 1737-49 4 Shlipak MG et al.; Conference Participants: Kidney Int 2021; 99: 34-47 5 Delanaye P et al.: J Am Soc Nephrol 2019; 30: 1785-805 6 Liu P et al.: JAMA Intern Med 2021; 181: 1359-66 7 Agarwal R et al.: Nephrol Dial Transplant 2021. Epub ahead of print 8 Seeger H et al.; Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie: https://www.swissnephrology.ch/wp/wp-content/uploads/2021/11/161121_SGN_Pocketguide_CKD_Web_A4_d.pdf 9 Pergola PE et al.: J Am Soc Nephrol 2021; 32: 1465-73 10 Akizawa T et al.: Kidney Int Rep 2021; 6: 2371-80 11 Tsuboi Y et al.: Kidney Int 2020; 98: 343-54 12 Bobart SA et al.: Kidney Int 2019; 95: 429-38 13 Bobart SA et al.: Clin J Am Soc Nephrol 2021; 16: 1833-9 14 Lv J et al.; TESTING Study Group: JAMA 2017; 318: 432-42 15 Perkovic V et al.: ASN Kindey Week, November 2021, FR-OR61
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen
Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...
Einblicke in die aktuelle Forschung
Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen gaben an ihrem Jahreskongress 2024 in Basel spannende Einblicke in ihre aktuelle Forschung. Wir stellen Ihnen hier einige dieser Arbeiten vor.
Spannende Fälle
Neben ihren Forschungsergebnissen stellten Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen am Jahreskongress 2024 in Basel auch einige spannende und lehrreiche Fälle vor. Wir präsentieren Ihnen ...


