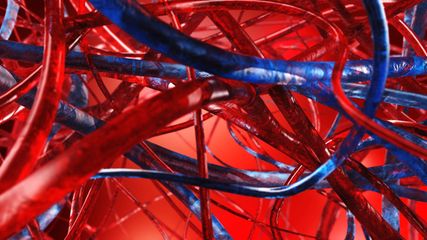©
Getty Images/iStockphoto
Längerer Erhalt von Nierentransplantaten durch genomweite Analyse
<p class="article-intro">Die Übereinstimmung von genetischen Merkmalen ist wesentlich für die Langzeitfunktion einer Spenderniere nach Transplantation. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Studie mit rund 500 Patienten nach Nierentransplantation, die an der MedUni Wien unter der Leitung von Prof. Dr. med. Rainer Oberbauer, Leiter der Klinischen Abteilung für Nephrologie und Dialyse, durchgeführt wurde.<sup>1</sup></p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Einführung des HLA(humanes Leukozyten- Antigen)-Matchings war ein Durchbruch in der Nierentransplantation. Noch immer werden jedoch 50 % der Transplantate innerhalb von 15 Jahren abgestossen. Epidemiologische Daten zeigen, dass hier die Non-HLA-Alloimmunität eine wichtige Rolle in der Abstossungsreaktion spielt.<br /> «Schon bisher war klar, dass die Übereinstimmung in einem Bereich des Haupthistokompatibilitätskomplexes auf Chromosom 6 einen wesentlichen Teil des Transplantatüberlebens erklärt», so Oberbauer, «allerdings gingen bisher auch bei perfekter Übereinstimmung von Spenderorgan und Empfänger in dieser Region noch etwa 20 % der Transplantate in den ersten fünf Jahren verloren.» Das Team der MedUni Wien hat nun herausgefunden, dass dies voraussichtlich durch die fehlende Übereinstimmung in einer Vielzahl anderer genetischer Regionen verursacht wird. «Das konnten wir experimentell durch die Bestimmung von spenderspezifischen Antikörpern gegen diese nicht übereinstimmenden Regionen bestätigen », betonen die Studienautoren.<br /> Für die Studie wurden 477 Spender- Empfänger-Paare, die zwischen Dezember 2005 und April 2015 transplantiert wurden, genotypisiert. Genetische Mismatches in nicht synonymen Einzelnukleotid- Polymorphismen («non-synonymous single nucleotide polymorphisms», nsSNP) wurden bestimmt, um Inkompatibilitäten zu identifizieren. Individuen unterscheiden sich nämlich in mehreren Tausend nicht synonymen SNP voneinander. Der Zusammenhang zwischen nsSNPMismatch und Transplantatverlust wurde mittels Cox-Regression geschätzt, wobei für HLA-Mismatch und klinische Kovariaten adjustiert wurde. Es zeigte sich, dass die Anzahl der nsSNP-Mismatches, die für Transmembran- oder sekretorische Proteine kodierten, prognostisch für eine Transplantatabstossung war. Bei 25 Patienten mit mittels Biopsie bestätigter chronischer antikörpervermittelter Abstossung wurden zudem individuelle Peptid-Arrays generiert, um Antikörper gegen nicht übereinstimmende Epitope von Spender und Empfänger zu screenen.<br /> Nicht HLA-kodierte Genprodukte können alloreaktive T-Zellen stimulieren und eine Immunantwort triggern, wenn sie in ein anderes Individuum transplantiert werden. Die Wiener Studie ist die erste Studie, die zeigt, dass genomweite genetische Fehlpaarung in Nicht-HLA-Epitopen ein wichtiger Prädiktor für das Überleben des Transplantats ist. Die Ergebnisse der Studie lassen darauf schliessen, dass genetische «non-HLA mismatches» eine wesentliche Auswirkung auf die Lebensdauer eines Nierentransplantats haben. Ein erhöhtes Risiko für eine von HLA unabhängige Transplantatabstossung ist besonders dann gegeben, wenn bei Empfängern und Spendern die Transmembran- und sekretorischen Proteine nicht übereinstimmen. Vor allem vor der Transplantation von Lebendspendernieren sollte deshalb eine genomweite Analyse von Spender und Empfänger durchgeführt werden, um die Gewebeübereinstimmung zu testen. «Das wird an der MedUni Wien bei schlechter Gewebeübereinstimmung im Haupthistokompatibilitätskomplex schon seit einigen Jahren routinemässig und mit sehr gutem Erfolg durchgeführt», führt Oberbauer an.<br /> Gleichzeitig konnte in der Studie gezeigt werden, dass das Immunsystem des Empfängers nach einer Nierentransplantation Antikörper gegen die körperfremden Proteine bildet, die ebenfalls die Lebensdauer des eingesetzten Organs beeinflussen und dieses schädigen können.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Medienmitteilung der Medizinischen Universität Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Reindl-Schwaighofer R et al.: Contribution of non-HLA incompatibility between donor and recipient to kidney allograft survival: genome-wide analysis in a prospective cohort. Lancet 2019 [Epub ahead of print]</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen
Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...
Therapie der ANCA-assoziierten Vaskulitis: Gibt es steroidfreie Alternativen?
Noch in den 1950er-Jahren verstarben rund 90% der Patient:innen, die an einer mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierten Vaskulitis litten, im ersten Jahr ...
Spannende Fälle
Neben ihren Forschungsergebnissen stellten Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen am Jahreskongress 2024 in Basel auch einige spannende und lehrreiche Fälle vor. Wir präsentieren Ihnen ...