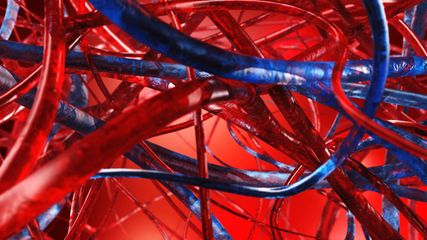Covid-19 ist auch in der Nephrologie ein Thema
Bericht: Dr. med. Sabina Ludin
Chefredaktorin
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Wie viele andere nationale und internationale Kongresse musste auch der europäische Nephrologiekongress ERA-EDTA, der in diesem Jahr in Milano hätte stattfinden sollen, in den virtuellen Raum verlegt werden. Während vier Tagen wurden Anfang Juni 93 Liveübertragungen, 12000 Minuten Kurse und 1850 E-Poster geboten. Mehr als 5000 Teilnehmer aus 100 Ländern nutzten das breite Angebot und tätigten neben dem Besuch der virtuellen Vorträge und Kurse 69000 Downloads. Wir haben für Sie einige interessante Studienresultate zusammengefasst, die unter anderem im Rahmen der «Late breaking clinical trials»-Session präsentiert wurden.
Das omnipräsente Thema Covid-19 durfte auch am ERA-EDTA-Kongress nicht fehlen. Nierenpatienten scheinen ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf zu haben, wenn sie an Covid-19 erkranken, und eine Nierenbeteiligung ist auch bei Covid-19-Patienten ohne vorbestehende Nierenerkrankung nicht selten zu beobachten, ebenso wie ein akutes Nierenversagen bei Patienten mit einem schweren Verlauf.
«In Deutschland wurden ungefähr 2% der Dialysepatienten positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Prognose der betroffenen Patienten war schlecht, mit einer Mortalitätsrate von 20%», sagte PD Dr. med. Elion Hoxha vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ähnliche Raten wurden aus anderen europäischen Ländern berichtet. «Die Covid-19-Rate ist bei Dialysepatienten höher als in der Allgemeinbevölkerung», bestätigte auch Dr. med. María José Soler Romeo vom Universitätsspital Vall d’Hebron in Barcelona. In ihrem Zentrum erkrankten 5% der Dialysepatienten an Covid-19, verglichen mit 0,5% in der Allgemeinbevölkerung. Die Mortalität lag bei 24%. Aus Italien wurde berichtet, dass 20% der an Covid-19 gestorbenen Patienten eine chronische Niereninsuffizienz hatten.
Um möglichst rasch viele Daten zu Covid-19 bei Dialysepatienten und solchen mit einer Nierentransplantation zu sammeln, hat die ERA-EDTA im März 2020 ERACODA, «The ERA-EDTA Covid-19 database for patients on dialysis or living with a kidney transplant», aufgeschaltet. Bis 1. Juni wurden die Daten von 1073 Patienten aus 26 Ländern in die Datenbank eingegeben. «Das 28-Tage-Follow-up dieses Kollektivs zeigte, dass 21% der nierentransplantierten und 25% der an Covid-19 erkrankten Dialysepatienten verstarben», sagte Prof. Dr. med. Luuk Hilbrands vom Radboud University Medical Center in Nijmegen (Niederlande). «Die Mortalitätsrate, der Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt wurden, lag bei 45% für Nierentransplantierte und bei 53% für Dialysepatienten.» Auch in dieser Population war das Alter >75 Jahre der wichtigste Risikofaktor für einen fatalen Verlauf. Entwarnung gab Hilbrands für jüngere, relativ gesunde nierentransplantierte Patienten, die kein erhöhtes Mortalitätsrisiko zu haben scheinen. «Trotzdem sollten sie sich natürlich strikt an die Hygiene- und Abstandsregeln halten», betonte er.
Covid-19 und Nierenfunktion
Eine Arbeit aus China, die bereits im März publiziert wurde, zeigte, dass 44% der in einem tertiären Lehrkrankenhaus hospitalisierten Covid-19-Patienten beim Eintritt eine Proteinurie aufwiesen und 26,7% eine Hämaturie.1 Bei 14% waren die Kreatininwerte erhöht, bei 13% die Harnstoff-Stickstoff-Werte, 13% hatten eine eGFR <60ml/min/1,73m2 und 5,1% entwickelten im weiteren Verlauf ein akutes Nierenversagen (AKI). «Es ist noch nicht klar, ob die pathologischen Urinwerte ein Indikator für einen schwereren Covid-19-Verlauf oder für ein erhöhtes Komplikationsrisiko sind, aber das sollten wir im Auge behalten», so Hoxha.
Auch eine Studie mit 5449 Patienten, die in einem von 13 New Yorker Spitälern hospitalisiert waren, zeigt, dass viele Covid-19-Patienten mit einem schwereren Verlauf ein AKI entwickeln.2 Insgesamt trat bei 36% dieser Patienten, unter denen keine Dialysepatienten und keine Nierentransplantierten waren, ein AKI auf und 14% davon mussten dialysiert werden. Von den beatmeten Patienten entwickelten sogar 90% ein AKI und rund ein Viertel davon benötigte eine Dialyse. «Das akute Nierenversagen ist keine Seltenheit bei Covid-19, es tritt früh auf, meistens in zeitlichem Zusammenhang mit dem respiratorischen Versagen, und es geht mit einer schlechten Prognose einher», kommentierte Hoxha.
Weshalb Covid-19-Patienten ein so hohes Risiko für die Entwicklung eines akuten Nierenversagens haben, ist noch nicht geklärt. Eine mögliche Erklärung wäre, dass das Virus die Nieren direkt angreift. Dafür gibt es zwar gewisse Hinweise, aber noch keine gesicherten Erkenntnisse.
Belimumab wirksam bei Lupusnephritis
Der monoklonale BAFF(«anti-B-cell-activating factor»)-Antikörper Belimumab ist bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) in Kombination mit der Basistherapie zur Verminderung der Krankheitsaktivität indiziert. Zur Anwendung von Belimumab bei Lupusnephritis (LN) gab es bisher nur gepoolte Daten aus Post-hoc-Analysen von zwei Phase-III-Studien, die Hinweise auf einen günstigen Effekt hinsichtlich renaler Endpunkte zeigten. Am ERA-EDTA-Kongress wurden nun die Resultate der BLISS-LN-Studie vorgestellt, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Belimumab bei aktiver LN untersuchte.3
In die doppelblind randomisierte, placebokontrollierte Phase-III-Studie wurden 448 erwachsene SLE-Patienten mit aktiver, bioptisch bestätigter LN eingeschlossen. Während einer Dauer von 104 Wochen erhielten die Patienten einmal pro Monat entweder Belimumab 10mg/kgKG i.v. oder Placebo. Primärer Endpunkt war das primäre renale Ansprechen («primary efficacy renal response»), definiert als Protein-Kreatinin-Ratio im Urin ≤0,7, eGFR <20% unter dem Wert vor Aufflammen der LN oder ≥60ml/min/1,73m2 und keine Notfalltherapie. Der hauptsächliche sekundäre Endpunkt war das vollständige renale Ansprechen(«complete renal response», CRR), definiert als Protein-Kreatinin-Ratio im Urin <0,5, eGFR <10% unter dem Wert vor Aufflammen der LN oder >90ml/min/1,73m2 und keine Notfalltherapie.
In Woche 104 hatten 43% der Patienten im Belimumab-Arm und 32,3% im Placebo-Arm den primären Endpunkt erreicht (OR: 1,55; 95% CI: 1,04–2,32; p=0,0311) und 30% resp. 19,7% die CRR (OR: 1,74; 95% CI: 1,11–2,74; p=0,0167). Das Risiko für das Eintreten eines renalen Ereignisses (terminale Niereninsuffizienz, Verdoppelung des Serumkreatinins, renale Verschlechterung, Therapieversagen hinsichtlich der Nierenerkrankung) oder zu versterben war unter Belimumab um 49% niedriger als unter Placebo. Bezüglich der Sicherheit gab es keine neuen Signale.
Damit zeigte Belimumab in der Behandlung der aktiven LN verglichen mit Placebo signifikant bessere renale Resultate.
ANCA-assoziierte Vaskulitis (AAV)
Rituximab zur Prävention von Rezidiven
Rituximab ist bei AAV eine effektive Therapie zur Remissionsinduktion. Die Wirkung hält allerdings nicht an, weshalb die Rückfallrate relativ hoch ist, besonders bei Patienten, die vorher schon Rezidive erlitten haben. In der internationalen, multizentrischen, randomisierten Open-label-Studie RITAZAREM wurde nun untersucht, welche Strategie sich bei Patienten mit AAV und Rezidiven nach der Induktion einer Remission besser für die Rezidivprophylaxe eignet.4 Verglichen wurden Rituximab (1000mg alle 4 Monate, total 5 Dosen) und Azathioprin (2mg/kg/d) als Erhaltungstherapie. Die Patienten wurden während mindestens 36 Monaten beobachtet und der primäre Endpunkt war definiert als Zeit bis zum Auftreten des ersten Rezidivs.
190 AAV-Patienten wurden beim Auftreten eines Rezidivs rekrutiert und erhielten zur Remissionsinduktion Rituximab und Glukokortikoide. Die 170 Patienten, die nach 4 Monaten in Remission waren, wurden anschliessend 1:1 in die beiden Therapiearme randomisiert. Rituximab erwies sich in der Prävention von Rezidiven als signifikant überlegen mit einer Gesamt-Hazard-Ratio von 0,36 (95% CI: 0,23–0,57; p<0,001). Dabei hatten ANCA-Typ, Glukokortikoid-Induktionstherapie und Schweregrad des Rezidivs keinen Einfluss auf das Resultat. 20 Monate nach der Randomisierung war bei 13% der Patienten unter Rituximab und bei 38% unter Azathioprin ein Rezidiv aufgetreten, wobei im Rituximab-Arm 18% der Rezidive als schwer eingestuft wurden und im Azathioprin-Arm 38%. Es traten keine neuen Sicherheitssignale auf.
Bei AAV-Patienten, die schon Rückfälle erlitten haben, eignet sich Rituximab somit besser als Azathioprin zur Prävention weiterer Rezidive nach Remissionsinduktion.
Avacopan – eine neue Therapieoption bei AAV
Ein neuer Kandidat für die Behandlung der ANCA-assoziierten Vaskulitis, der sich aktuell in klinischer Prüfung befindet, ist die oral verabreichte Substanz Avacopan. Als selektiver Antagonist des auf Neutrophilen vorhandenen C5a-Rezeptors blockiert das Medikament die Zellaktivierung, die durch das Komplementfragment C5a ausgelöst wird, und damit einen in der Pathogenese der AAV wichtigen Mechanismus. Im Mausmodell konnte gezeigt werden, dass Avacopan die durch Anti-Myeloperoxidase-Antikörper ausgelöste Entwicklung einer Glomerulonephritis verhindern kann.5 Positive Daten ergaben auch die klinischen Phase-II-Studien.6 Die Phase-III-Studie ADVOCATE, die am ERA-EDTA-Kongress präsentiert wurde, untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit von Avacopan bei AAV sowie dessen Potenzial zur Verminderung der Glukokortikoidgabe und der damit verbundenen Nebenwirkungen.7
330 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen und erhielten während 52 Wochen entweder Prednison oder Avacopan in Kombination mit entweder a) Cyclophosphamid (oral oder i.v.) gefolgt von Azathioprin oder b) Rituximab. Primärer Endpunkt war der Anteil an Patienten, die zu Woche 26 eine Remission erreicht hatten, welche bis Woche 52 anhielt. In Woche 26 waren 72,3% im Avacopan-Arm in Remission verglichen mit 70,1% im Prednison-Arm (p<0,0001 für Nichtunterlegenheit). In Woche 52 waren 65,7% der Patienten unter Advacopan immer noch in Remission versus 54,7% unter Prednison, womit Avacopan zu diesem Zeitpunkt Nichtunterlegenheit und Überlegenheit gegenüber der Behandlung mit Prednison erreicht hat (p für Überlegenheit = 0,0066). Gleichzeitig wurde unter Avacopan eine signifikante Verminderung der Glukokortioid-bezogenen Toxizität (gemessen mit dem «Glucocorticoid Toxicity Index of Cumulative Worsening Score») beobachtet.
Bei den Patienten mit Nierenbeteiligung war im Avacopan-Arm nach 52 Wochen eine Zunahme der eGFR von 7,3ml/min/1,73m2 zu verzeichnen, verglichen mit 4,1ml/min/1,73m2 im Prednison-Arm (p=0,029). In der Subgruppe der Patienten mit einer eGFR <30 bei Studienbeginn war der Unterschied sogar noch grösser (13,7 vs. 8,2ml/min/1,73m2; p<0,005). Das Sicherheitsprofil war akzeptabel.
Die ADVOCATE-Studie hat somit gezeigt, dass Avacopan eine effektive Therapie für Patienten mit AAV ist.
Initialer eGFR-Abfall unter Empagliflozin hat keinen Einfluss auf renale Endpunkte
Der SGLT2-Hemmer Empagliflozin reduziert bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und etablierter kardiovaskulärer Erkrankung das kardiovaskuläre und das renale Risiko. Nach Beginn der Behandlung kommt es zu einem Abfall der eGFR, der zum grössten Teil reversibel und wahrscheinlich hämodynamisch bedingt ist. Um das Phänomen besser zu verstehen, untersuchte nun eine internationale Forschergruppe, ob dieser initiale GFR-Abfall abhängig ist von Basischarakteristika der Patienten und/oder einen Einfluss hat auf die nephroprotektive Wirkung von Empagliflozin.8 Dafür wurden die Daten von 6668 Teilnehmern der EMPA-REG-OUTCOME-Studie untersucht, die mindestens eine Dosis der Studienmedikation erhalten hatten und von denen eGFR-Werte bei Studieneinschluss und zu Woche 4 vorhanden waren.
Bis Woche 4 wurde bei 28,3% der Patienten im Empagliflozin-Arm und bei 13,4% im Placebo-Arm ein eGFR-Abfall von >10% beobachtet. Ein starker Abfall von >30% war in beiden Gruppen sehr selten (1,4 vs. 0,9%). Die Patienten, die unter Empagliflozin einen eGFR-Abfall von >10% zeigten, waren signifikant älter, hatten eine längere Diabetesdauer und gehörten einer höheren KDIGO-Risikokategorie an. Eine Behandlung mit Diuretika und/oder eine höhere KDIGO-Risikokategorie bei Studieneinschluss waren prädiktiv für einen initialen eGFR-Abfall von >10% unter Empagliflozin. Insgesamt betrug die mittlere Odds-Ratio für einen eGFR-Abfall von >10% unter Empagliflozin 2,7 (95%CI: 2,3–3,0).
Auf die günstigen Auswirkungen von Empagliflozin auf renale Endpunkte hatte der initiale eGFR-Abfall keinen Einfluss. Die Wahrscheinlichkeit eines initalen eGFR-Abfalls von >10% nach Beginn der Empagliflozin-Therapie war bei Typ-2-Diabetikern mit einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung und/oder einer Diuretikatherapie höher. Die Behandlung mit Empagliflozin war aber trotzdem mit einer günstigen Wirkung auf renale Endpunkte assoziiert, und dies unabhängig von den für einen eGFR-Abfall prädiktiven Basischarakteristika.
Hoch dosierte i.v. Eisentherapie bei Dialysepatienten
In der multizentrischen Open-label-Studie PIVOTAL mit verblindeter Endpunktevaluation wurden zwei verschiedene Regime zur intravenösen Eisentherapie bei Dialysepatienten miteinander verglichen: Die proaktive monatliche Gabe von 400mg Eisensaccharose (die nur pausiert wurde, wenn das Ferritin >700μg oder die Transferrinsättigung ≥40% war) und die reaktive Gabe von 0–400mg Eisensaccharose bei Ferritinwerten <200μg oder einer Transferrinsättigung <40%.9 Am ERA-EDTA-Kongress wurden nun die Ergebnisse von zwei vordefinierten sekundären Analysen vorgestellt.
Substanzielle Reduktion der Myokardinfarktrate
In der ersten Analyse wurden die Myokardinfarktrate und der Einfluss der beiden Eisenregime darauf untersucht.10 Im Verlauf von im Median 2,1 Jahren trat bei 8,4% der eingeschlossenen 2141 Dialysepatienten ein Myokardinfarkt (MI) auf. Dabei war die Rate an klassischen MI (Typ 1) 2,5-mal so hoch wie die Rate an Typ-2-MI (3,2 vs. 1,3/100Patientenjahre) und NSTEMI waren 6,6-mal häufiger als STEMI (3,3 vs. 0,5/100Patientenjahre). Die Mortalität nach einem nicht tödlichen MI war mit einer 30-Tages-Mortalität von 11,3% und einer 1-Jahres-Mortalität von 39,8% hoch, was in diesem Patientenkollektiv jedoch nicht überrascht.
In der Gruppe mit proaktiver hoch dosierter intravenöser Eisentherapie fand sich im Vergleich zum reaktiven Regime eine signifikante Reduktion der Rate an nicht tödlichen MI (HR: 0,69, 95% CI: 0,51–0,93; p=0,01) und des kombinierten Endpunkts aus nicht tödlichem und tödlichem MI (HR: 0,69; 95% CI: 0,52–0,93; p=0,015).
Relative und absolute Risikoreduktion in Bezug auf Herzinsuffizienz-bedingte Ereignisse
In der zweiten Analyse wurde der Einfluss der beiden Eisenregime auf die Rate an Herzinsuffizienz(HF)-bedingten Ereignissen (tödliches HF-Ereignis, HF-bedingte Hospitalisation) untersucht.11 Während der medianen Beobachtungsdauer von 2,1 Jahren trat bei 4,7% der Patienten unter hoch dosierter Eisentherapie und bei 6,7% unter niedrig dosierter Eisentherapie ein erstes tödliches oder nicht tödliches HF-Ereignis auf (HR: 0,66; 95% CI: 0,46–0,94; p<0,001). Auch die Anzahl aller HF-Ereignisse (erstes oder wiederholtes Ereignis) war mit 63 vs. 98 Ereignissen unter der hoch dosierten Eisentherapie signifikant niedriger als unter der Vergleichstherapie (RR: 0,59; 95% CI: 0,40–0,87; p=0,0084). Verglichen mit dem reaktiven Eisenregime verminderte die hoch dosierte Eisentherapie somit das Auftreten von HF-bedingten Ereignissen bei Dialysepatienten und war mit einer substanziellen relativen und absoluten Risikoreduktion assoziiert.
Quelle:
57th ERA-EDTA Congress, fully virtual, 6. bis 9. Juni 2020
Literatur:
1 Cheng Y et al.: Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with Covid-19. Kidney Int 2020; 97: 829-38 2 Hirsch JS et al.: Acute kidney injury in patients hospitalized with Covid-19. Kidney Int 2020; 98: 209-18 3 Rovin B et al.: Efficacy and safety of belimumab in patients with active lupus nephritis: a phase 3, randomised, placebo-controlled trial. ERA-EDTA 2020; LB001 4 Smith R et al.: A randomized, controlled trial of rituximab versus azathioprine after induction of remission with rituximab for patients with ANCA-associated vasculitis and relapsing disease. ERA-EDTA 2020; LB004 5 Xiao H et al.: C5a receptor (CD88) blockade protects against MPO-ANCA GN. J Am Soc Nephrol 2014; 25: 225-231 6 Jayne DR et al.; CLEAR Study Group: Randomized trial of C5a receptor inhibitor avacopan in ANCA-associated vasculitis. J Am Soc Nephrol 2017; 28: 2756-67 7 Jayne DR et al.: A randomized, double-blind, active controlled study of avacopan in anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. ERA-EDTA 2020; LB003 8 Kraus BJ et al.: Kidney implications of the initial eGFR response to SGLT2 inhibition with empagliflozin: the ‘eGFR dip’ in EMPA-REG OUTCOME. ERA-EDTA 2020; LB005 9 Macdougall IC et al.: Intravenous iron in patients undergoing maintenance N Engl J Med 2019; 380: 447-58 10 Petrie M et al.: Myocardial infarction in the pivotal study of iv iron in haemodialysis: a pre-specified secondary analysis. ERA-EDTA 2020; MO016 11 Jhund P et al.: Heart failure hospitalisations in the PIVOTAL trial of iv iron in haemodialysis patients: a pre-specified secondary analysis. ERA-EDTA 2020; P1371
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen
Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...
Therapie der ANCA-assoziierten Vaskulitis: Gibt es steroidfreie Alternativen?
Noch in den 1950er-Jahren verstarben rund 90% der Patient:innen, die an einer mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierten Vaskulitis litten, im ersten Jahr ...
Spannende Fälle
Neben ihren Forschungsergebnissen stellten Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen am Jahreskongress 2024 in Basel auch einige spannende und lehrreiche Fälle vor. Wir präsentieren Ihnen ...