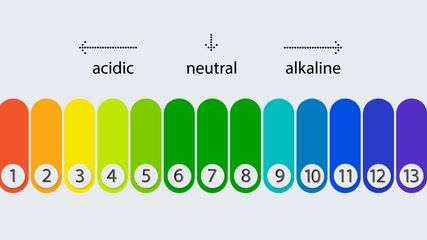Die neue ADPKD-Guideline von KDIGO
Bericht:
Dr. Corina Ringsell
Redaktorin
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Im Januar 2025 veröffentlichte KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) erstmals eine dezidierte Leitlinie zu Diagnostik und Therapie der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenkrankheit (ADPKD).1 Am FOMF Experten-Forum Update Nephrologie erläuterte Dr. med. Christian Kuhn, Oberarzt mbF, Kantonsspital St. Gallen, HOCH Health Ostschweiz, die wichtigsten Empfehlungen.
DieADPKD ist die häufigste monogenetische Nierenkrankheit, die zum Nierenversagen führen kann. Die Prävalenz liegt bei etwa 1:1000. In der Schweiz sind laut Kuhn rund 10000, weltweit etwa 12 Millionen Menschen betroffen. Ursache der ADPKD sind Genmutationen, in 90% der Fälle der Gene PKD1 und PKD2. Ist ein Elternteil betroffen, besteht bei den Kindern aufgrund des autosomal-dominanten Erbgangs eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, die Krankheit zu entwickeln. Zudem hat die ADPKD eine sehr hohe Penetranz, das heisst, dass sie fast sicher ausbrechen wird, wenn die Anlage dazu vererbt wurde. Bei etwa 20% der Erkrankten liegt eine Neumutation ohne positive Familienanamnese vor.1
Die ADPKD führt zur progressiven Entwicklung multipler Zysten in beiden Nieren, die das normale Nierengewebe verdrängen. Die Folge ist ein zunehmender Funktionsverlust, der bis zur Notwendigkeit eines Nierenersatzverfahrens führen kann. Die ADPKD kann sich auch extrarenal manifestieren; häufig sind hier Leberzysten und Hirnaneurysmen.1
Diagnostisches Vorgehen
Bezüglich der Diagnostik stelle sich die Frage, ob eine Person mit positiver ADPKD-Familienanamnese überhaupt eine Abklärung wünsche, ob sie betroffen ist, sagte Kuhn. Sollte eine Abklärung gewünscht sein, so ist der erste diagnostische Schritt eine Sonografie. Dabei wird die Anzahl der Nierenzysten anhand altersabhängiger diagnostischer Kriterien beurteilt, um eine ADPKD zu bestätigen.1
In Fällen mit unklaren Ultraschallbefunden kann eine Magnetresonanztomografie (MRT) eingesetzt werden, die auch sehr kleine Zysten darstellt. Ist die in der Familie vorliegende Mutation bekannt, so kann auch eine gezielte Segregationsanalyse dieser spezifischen Mutation erfolgen.1 Bei Erwachsenen, bei denen im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung zufällig Nieren- oder Leberzysten gefunden werden, die aber keine oder keine bekannte Familienanamnese haben, werden weitere Untersuchungen empfohlen.1
Kuhn hob hervor, dass bei einer klinisch typischen Präsentation einer ADPKD eine negative oder eine unklare genetische Untersuchung eine vererbte Form der Krankheit nicht ausschliesst. Die Betroffenen sollten genauso behandelt werden wie Personen mit nachgewiesener ADPKD.
Prognostische Faktoren
Prognostisch ungünstig sind die Mutationen von PKD1 und PKD2.1 Dabei sei PKD1 mit schwereren Krankheitsverläufen assoziiert und führe im Schnitt etwa 20 Jahre früher als die PKD2-Mutation zur Notwendigkeit eines Nierenersatzverfahrens, erklärte Kuhn. Andere prognostisch ungünstige Faktoren sind männliches Geschlecht, Übergewicht, hohe Kalorien- und Salzzufuhr sowie eine bereits eingeschränkte Nierenfunktion oder ein hohes totales Nierenvolumen.1
Um die Verschlechterung der Nierenfunktion und den Zeitpunkt eines Nierenversagens zu prognostizieren, empfiehlt die Leitlinie, die Mayo-Imaging-Klassifikation anzuwenden. Dazu muss das totale Nierenvolumen bestimmt werden, das zusammen mit der Grösse und dem Alter der Person in einen Onlinerechner ( www.mayo.edu/research/documents/pkdcenter-adpkd-classification/doc-20094754 ) eingegeben wird. Dieser berechnet das höhenadjustierte totale Nierenvolumen (htTKV), das angibt, wie viele Milliliter Nierenvolumen pro Meter Körpergrösse ein:e Patient:in hat. Das Resultat wird abhängig vom Alter in die Mayo-Klassifikation eingestuft. Diese reicht von 1A bis 1E, wobei eine höhere Klasse eine schnellere Verschlechterung der Nierenfunktion und ein früheres Nierenversagen anzeigt. Die Mayo-Klassifikation ist nur für die «typische» ADPKD (Klasse 1) und für PKD1- und PKD2-Mutationen validiert.1 Als «typisch» gelten bilaterale und diffus verteilte Nierenzysten, die beide Nieren komplett durchsetzen; atypische Formen (Klasse 2) sind zum Beispiel ein unilateraler, ein segmentaler oder ein sehr asymmetrischer Befall.
Manifestationen der ADPKD
Bluthochdruck
Die häufigste und früheste klinische Manifestation der ADPKD ist eine arterielle Hypertonie, die meist vor dem 30. Lebensjahr auftritt. Bei Patient:innen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren mit einer chronischen Nierenkrankheit (CKD) im Stadium 1 und 2 (eGFR >60ml/min/1,73m2) und hohem Blutdruck (>130/85mmHg) sollte ein Blutdruckziel <110/75mmHg (in Blutdruck-Selbstmessungen zu Hause) angestrebt werden, sofern dies toleriert wird.1 Für Patient:innen dieser Altersgruppe mit einem Blutdruck zwischen 110/75mmHg und 130/85mmHg gibt die Leitlinie keine Empfehlung ab, da die Datenlage hierzu nicht ausreicht. Allerdings gibt es einen Practice Point, der zu einem individualisierten Vorgehen auf Basis eines Shared Decision Making mit den Patient:innen rät.1 Für über 50-Jährige wird unabhängig vom CKD-Stadium ein durchschnittlicher systolischer Zielblutdruck von <120mmHg vorgeschlagen (standardisierte Blutdruckmessung). Sollte eine medikamentöse Therapie indiziert sein, wird primär ein ACE-Hemmer oder ein Sartan empfohlen.1
Chronische Nierenschmerzen und Harnwegsinfekte
Oft kommt es zu chronischen Flanken-, Abdominal- und Lumbalschmerzen. Hier müssen Differenzialdiagnosen, zum Beispiel eine Spinalkanalstenose, ausgeschlossen werden. Sind die Schmerzen aber ADPKD-bedingt, sollten sie am besten von einem inter-/multidisziplinären Team behandelt werden. Die Therapien reichen von nichtinvasiven Massnahmen wie Hitze-Wärme-Applikationen über zunehmend invasivere Massnahmen bis hin zur Nephrektomie, wenn alle anderen Optionen versagen.1
Eine häufige Komplikation sind auch Nierensteine, die genauso behandelt werden wie bei der Normalbevölkerung: Betroffenen sollte geraten werden, die Trinkmenge zu erhöhen, und sie sollten über Risikofaktoren wie Übergewicht und Diabetes aufgeklärt werden. Wenn möglich, sollten eine Steinanalyse und eine Analyse prolithogener Faktoren erfolgen.1
Auch Harnwegsinfekte werden grundsätzlich genauso behandelt wie bei der Normalbevölkerung. Präsentiert sich ein:e Patient:in mit ADPKD jedoch mit Fieber, akuten Bauch- oder Flankenschmerzen und erhöhten CRP-Werten, dann sollte an einen Zysteninfekt gedacht werden.1 Meist reiche ein starker Verdacht für den Beginn einer antibiotischen Therapie aus, sagte Kuhn. Diese sollte laut Leitlinie über vier bis sechs Wochen vorzugsweise mit einem lipidlöslichen Antibiotikum wie Ciprofloxacin oder Sulfamethoxazol/Trimethoprim erfolgen.1
Fortschreitendes Nierenversagen und Nierenersatztherapie
Generell unterscheide sich das Management der CKD bei ADPKD nicht von dem bei anderen Nierenkrankheiten, erklärte der Referent. Einzige wichtige Ausnahme: SGLT2-Inhibitoren würden – zumindest zurzeit – nicht bei ADPKD empfohlen, da die Krankheit ein Ausschlusskriterium für die grossen Studien zu diesen Wirkstoffen gewesen sei, betonte Kuhn. Nierenersatzverfahren der Wahl ist die Nierentransplantation.1 Ein neuer und spannender Punkt sei, dass das geschätzte Gewicht der Nierenzysten und der Zystenleber vom Körpergewicht der Patient:innen abgezogen werden sollte, vor allem dann, wenn das Transplantationszentrum ein BMI-Limit für die Transplantation habe, sagte der Referent.
Krankheitsprogression verzögern
Um ein Fortschreiten der Krankheit hinauszuzögern, kann die Wirkung des antidiuretischen Hormons auf den ADH-Rezeptor in der Niere blockiert werden. Das hierfür am besten untersuchte und in der Leitlinie empfohlene Medikament ist Tolvaptan.1 Es hat einen positiven Einfluss auf die GFR-Abnahme und verzögert die Zunahme des totalen Nierenvolumens (TKV). Zudem reduzierte es in Studien im Vergleich zu Placebo die Inzidenz von Harnwegsinfekten, Nierensteinen, Hämaturie und Nierenschmerzen signifikant.2,3 Die Hauptnebenwirkungen sind Folgen der Blockade der Wasserrückresorption in den Nierentubuli, unter anderem Durst, Polyurie und Nykturie. Zudem kann es zur Leberschädigung kommen, weshalb Transaminasen und Bilirubin vor und während der ersten 18 Monate nach dem Beginn der Therapie monatlich, danach alle drei Monate überwacht werden müssen. Bei Anzeichen eines Leberschadens sollte die Behandlung pausiert werden.1Indiziert ist Tolvaptan laut Leitlinie bei einer eGFR ≥25ml/min/1,73m2 und hohem Risiko für eine schnelle Krankheitsprogression, definiert durch die Mayo-Klasse oder die Dokumentation einer schnellen GFR-Abnahme ≥3ml/min/1,73m2pro Jahr.1
Voraussetzungen in der Schweiz
Kuhn wies darauf hin, dass in der Schweiz vor Therapiebeginn immer eine Kostengutsprache einzuholen ist. Die Kosten werden nur für Erwachsene mit «typischer» ADPKD (Klasse 1) übernommen, die eine CKD im Stadium 1–3 (eGFR ≥30ml/min/1,73m2) aufweisen. Das totale Nierenvolumen (TKV) müsse mindestens 750ml betragen und falls die eGFR ≥90ml/min/1,73m2 liege, müsse die Mayo-Klasse 1D oder 1E vorliegen, damit die Therapie bezahlt wird.4 Bei einer eGFR von 30–90ml/min/1,73m2 reiche Klasse 1C aus, sagte der Referent. Die Verordnung und die Überwachung der Therapie müssen zudem durch Fachärzt:innen für Nephrologie erfolgen, die an einem vom BAG definierten Spital tätig sind.4
Andere Interventionen
Von anderen Massnahmen zur Verzögerung der Krankheitsprogression wie mTOR-Inhibitoren, Metformin, SGLT2-Hemmern oder einer ketogenen Diät rät die KDIGO-Leitlinie derzeit ab. Eine Massnahme, die mit niedriger Evidenz vorgeschlagen wird, ist die Steigerung der täglichen Wasserzufuhr auf mindestens zwei bis drei Liter.1 Dadurch soll die ADH-Freisetzung reduziert und so das Zystenwachstum gebremst werden. Die Datenlage sei aber schwach, erklärte Kuhn.
Quelle:
FOMF Experten-Forum Update Nephrologie, 6. März 2025, online
Literatur:
1 KDIGO ADPKD Work Group: KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Evaluation, Management, and Treatment of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD). Kidney Int 2025; 107(2S): S1-239 2 Casteleijn NF et al.: Tolvaptan and Kidney Pain in Patients With Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: Secondary Analysis From a Randomized Controlled Trial. Am J Kidney Dis 2017; 69(2): 210-9 3 Casteleijn NF et al.: Novel treatment protocol for ameliorating refractory, chronic pain in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 2017; 91: 972-81 4 Bundesamt für Gesundheit BAG: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/arzneimittel/beurteilungen-bag-von-arzneimitteln-der-spezialitaetenliste/beurteilungen-01.11.2016/jinarc-neuaufnahme-01.11.2016.pdf.download.pdf/Jinarc%20Neuaufnahme%2001.11.2016.pdf
Das könnte Sie auch interessieren:
Chloride in the spotlight – the hidden driver of acid-base homeostasis
Chloride is the most abundant extracellular anion and contributes fundamentally to osmolality, electroneutrality, and acid-base balance. Despite this central role, it has often received ...
Nierenkrebs – gegenwärtige Strategien und zukünftige Trends in der Therapie
Nichtklarzellige Nierenzellkarzinome (non-ccRCC) sollen zwar nach den gleichen Standards wie ccRCC behandelt werden, die Outcomes sind jedoch schlechter. Bei ccRCC hat sich die adjuvante ...
Prä- und postoperatives Transplantationsmanagement in der hausärztlichen Praxis
Hausärzte spielen in der Betreuung von Patienten vor und nach Nierentransplantation, aber auch bei der Begleitung von potenziellen Lebendspendern von der Auswahl bis zur Nachbetreuung ...