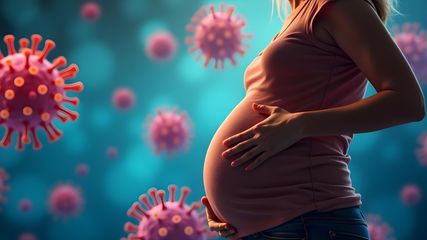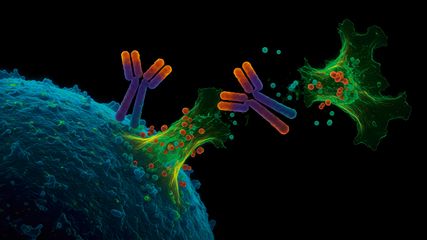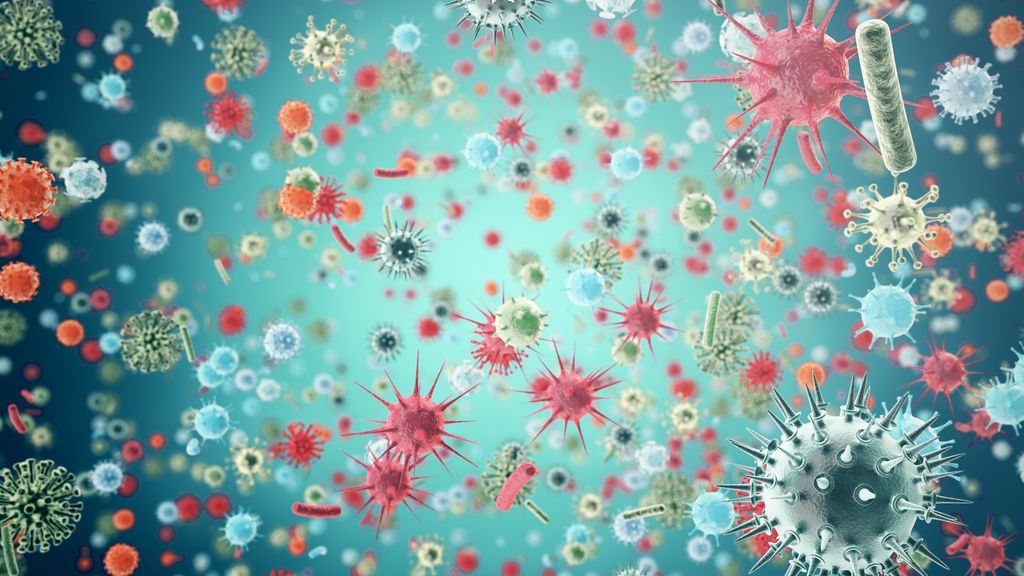
©
Getty Images/iStockphoto
Verbessertes Langzeitmanagement und neue Therapieoptionen
Jatros
Autor:
OA Dr. Bernhard Haas
Abteilung für Innere Medizin<br>LKH Graz Süd-West, Graz<br>E-Mail: bernhard.haas@kages.at
30
Min. Lesezeit
08.06.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Auch heuer gab das wissenschaftliche Programm der Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) einen umfassenden Überblick über die bedeutendsten aktuellen Entwicklungen im Bereich der HIV-Therapie.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Prävention der HIV-Infektion</h2> <p>Die Beeinflussung der HIV-Transmission war schon immer ein großes Thema in der HIV-Forschung, wir erinnern uns an die ersten Studien zur Verhinderung der Übertragung von Mutter zu Kind durch die antiretrovirale Therapie (ART). Später trat die frühzeitige und universelle Behandlung von HIV-Infizierten in den Mittelpunkt, „treatment as prevention“ (TasP) war ein zusätzlicher Faktor, der zur Adaptierung sämtlicher Behandlungsleitlinien im Jahre 2015 führte. Diese beinhalten, dass alle Erwachsenen mit HIV-Infektion unabhängig von der CD4-Zahl eine ART beginnen sollen.</p> <h2>Initiale ART-Regime</h2> <p>In den Empfehlungen für die initiale Therapie fast aller Leitlinien dominieren derzeit Integraseinhibitor-hältige Regime. Mit Ritonavir (Norvir®) geboostertes Darunavir (Prezista®) findet sich darin als einziges aktuell empfohlenes Protease­inhibitor(PI)-hältiges Regime. Fast alle dieser Regime enthalten zudem in irgendeiner Weise Tenofovir, mit der Ausnahme von Dolutegravir (DTG) als Integraseinhibitor plus den zwei NRTI Abacavir (ABC) und Lamivudin (3TC), erhältlich als Fixdosiskombination Triumeq®.<br />Tenofovir steht mittlerweile in zwei verschiedenen Formen zur Verfügung, einerseits als Tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) und andererseits als Tenofovir­ala­fenamid (TAF), das 2016 in Europa in verschiedenen Kombinationen zugelassen worden ist. Auf der CROI wurden nun die finalen 144-Wochen-Resultate der Head-to-head-Vergleichsstudie der beiden Eintabletten-Fixdosiskombinationen mit dem mit Cobicistat(COBI)-geboosterten Integra­se­inhibitor Elvitegravir (EVG) Stribild® (EVG/COBI/FTC/TDF) und Genvoya® (EVG/COBI/FTC/TAF) vorgestellt.<sup>1</sup> In den bisherigen Analysen konnte Letzteres die für die Zulassung geforderte Nichtunterlegenheit demonstrieren. Nach fast drei Jahren Studiendauer – zu Woche 144 – erreichte Genvoya® in der statistischen Auswertung hinsichtlich Wirksamkeit erstmals Überlegenheit gegenüber der Vergleichssubstanz. Die höheren Raten an viro­logischer Suppression (HIV-RNA <50c/ml) ergaben sich nicht durch Unterschiede im virologischen Versagen – ein solches mit Resistenzentwicklung war mit 1,4 % in beiden Armen sehr niedrig –, sondern durch höhere Abbruchraten im Stribild®-Arm. Insgesamt betrug die Rate an Abbrüchen bedingt durch Nebenwirkungen 3,3 % im TDF-haltigen versus 1,3 % im TAF-haltigen Regime. <br />Am augenscheinlichsten waren die Unterschiede bei Nieren- bzw. Knochen-assoziierten Nebenwirkungen, die zu Abbrüchen führten. Hier muss man sich in Erinnerung rufen, dass dies eine doppel­blind randomisierte Studie war, d.h., ein „Patientenwunsch“ nach der moderneren Substanz kann keine Rolle gespielt haben. Knochendichte und nierenspezifische Labormarker (eGFR, Proteinurie u.a.) waren im TAF-haltigen Arm ­signifikant besser als im TDF-haltigen. Wie zu erwarten fanden sich bei Einnahme von TAF höhere Lipidwerte (Gesamtcholesterin, LDL und HDL), da der lipidsenkende Effekt von TDF wegfällt – eine Folge der niedrigeren Tenofovir-Plasmaspiegel.</p> <h2>Integraseinhibitoren und Daten bei Frauen</h2> <p>Frauen sind in den großen klinischen Studien zumeist unterrepräsentiert, so soll hier eine der wenigen mit nur weiblichen Teilnehmern – bei WAVES waren es 575 – Erwähnung finden. In einer offenen Anschlussstudie wurden diejeni- gen Frauen, die 48 Wochen mit Ritonavir (Norvir®) geboostertes Atazanavir (Reyataz®) plus FTC/TDF (Truvada®) einnah- men, randomisiert auf EVG/COBI/FTC/ TAF (Genvoya®) umgestellt oder sie blieben unter der PI-haltigen Therapie. Nach 48 Wochen zeigte sich ein Trend zu einem besseren Abschneiden der Therapie mit dem Integraseinhibitor. Auch hier ist der numerische Unterschied im Erreichen einer Virus­last von <50c/ml durch höhere Abbruchraten im PI-Arm bedingt. Resistenzentwicklung war in keinem der beiden Arme zu beobachten.<sup>2</sup> Somit haben wir anhand dieser Analyse zusammen mit der ebenfalls nur Frauen (hier waren es 495) re­krutierenden ARIA-Studie, welche eine Überlegenheit von DTG/ABC/3TC (Triumeq®) gegenüber dem PI-haltigen Komparator-Regime gezeigt hat, neuerlich einen Hinweis, dass Therapiekombinationen mit Integraseinhibitoren bei Frauen gleich gut wirken wie bei Männern.</p> <h2>Mögliche Entwicklung einer Integraseresistenz bei initialer ART mit Dolutegravir</h2> <p>Bei Einsatz von Dolutegravir zusammen mit 2 NRTI bei therapienaiven HIV-infizierten Patienten konnte man bislang, weder in den zahlreichen Studien noch im bereits erfolgten breiten Einsatz in der Praxis, die Entstehung von Integraseresistenzen beobachten. Deshalb erregte folgende Fallvorstellung viel Aufsehen (Abb. 1).<sup>3</sup> Ein 45-jähriger Mann hatte ausgeprägte Symptome eines akuten retroviralen Syndroms, zeigte einen schlechten Allgemeinzustand und entwickelte eine Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie (PCP). Entsprechend der akuten HIV-Infektion fand sich eine sehr hohe Viruslast (>106c/ml) und er erhielt umgehend eine ART bestehend aus DTG (Tivicay®) plus FTC/TDF (Truvada®). Nach initial beachtlichem Virusabfall zeigte sich zu Woche drei ein Wiederanstieg der HIV-RNA und es wurde zusätzlich Darunavir (Prezista®) plus Ritonavir (Norvir®) verabreicht, woraufhin die Viruslast wieder abfiel. In der Resistenzanalyse zu Woche drei zeigte sich eine Integraseresistenz (Mutation G163E), die sich nach Ansicht der Autoren unter der Therapie entwickelt hatte. Schwachpunkt in der Kausalitätskette ist, dass zu Baseline keine Integraseresistenztestung durchgeführt worden war. Somit ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass sich der Patient mit einem integraseresistenten Virus angesteckt hatte und dieses weiter selekti­o­niert wurde. Derzeit wird dies jedoch als der erste Fall einer Resistenzentwicklung unter DGT bei bei einem the­rapie­naiven Patienten angesehen. Die Tat­sache, dass seit der Markteinführung von Dolutegravir nahezu 4 Jahre vergangen sind und es sich um den ersten derartigen Fallbericht im Rahmen einer großen internationalen Konferenz handelt, zeigt uns, wie ungewöhnlich eine solche Resistenzentwicklung ist und dass dieser Integraseinhibitor eine hohe Resistenzbarriere aufweist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Infekt_1702_Weblinks_s28_1.jpg" alt="" width="1051" height="1094" /></p> <h2>Therapiewechsel – Switch-Studien</h2> <p>Ein Therapiewechsel bei virologisch supprimierten Patienten kann heutzutage aus verschiedensten Gründen indiziert sein bzw. auch vom Patienten gewünscht werden. Auf der CROI wurden zahlreiche Switch-Studien vorgestellt, die meisten zeigten gute Ergebnisse für das neu eingewechselte Regime. Hervorheben möchte ich einige Studien, die den Ansatz einer Substanzreduktion verfolgen.<br />LAMIDOL klingt bei uns wie ein Schmerzmittel, das Akronym dieser französischen Studie an 110 Patienten beinhaltet jedoch jene zwei Substanzen, auf die gewechselt wurde: LAMIvudin (3TC) und DOLutegravir (DTG).<sup>4</sup> Um eingeschlossen zu werden, mussten Patienten für mindestens 2 Jahre unter ART virussupprimiert sein (HIV-RNA <50c/ml), die ART durfte zudem in den letzten 6 Monaten nicht modifiziert worden sein und die CD4-Zellzahl musste >200/μl betragen. In der ersten Umstellungsphase wurde der zuvor gegebene PI, NNRTI oder Integraseinhibitor auf Dolutegravir umgestellt, das NRTI-Backbone wurde vorerst beibehalten. Wenn nach 8 Wochen die HIV-RNA weiterhin <50c/ml betrug, wurde das Backbone auf Lamivudin (3TC) 300mg 1x tgl. umgestellt. Die Zwischenauswertung zu Woche 48, d.h. nach 40 Wochen dualer Therapie, zeigte bei 97 % ein Fortbestehen der viralen Suppression, drei Patienten hatten ein virologisches Versagen, aber bei keinem konnten Integraseresistenzen gefunden werden. Bei der CROI wurde jedoch nur eine Zwischenauswertung vorgestellt, der primäre Endpunkt gemäß Protokoll ist zu Woche 56 erreicht, d.h. nach 48 Wochen dualer Therapie. Derzeit laufen drei große Phase-III-Studien, worin DTG + 3TC in initialer ART evaluiert werden.<br />Die gute Wirksamkeit und die hohe Resistenzbarriere von Dolutegravir ließen manche glauben, dass sogar eine alleinige Gabe dieser Substanz ausreichend sein könnte. DOMONO untersuchte eine DOLutegravir-MONOtherapie in einem Switch-Setting von zuvor virussupprimierten ART-Patienten.<sup>5</sup> Nach der 48-Wochen-Auswertung musste die Studie vorzeitig abgebrochen werden, da im Monotherapie-Arm vermehrt virologisches Versagen zu beobachten war (8 von 77 Patienten versus 3 von 152 im Kombinationstherapie-Arm). Die Hälfte der Mono­therapie-Versager entwickelte auch Integraseresistenzen. Eine zweite Studie aus Spanien zeigte ähnlich enttäuschende Ergebnisse.<sup>6 </sup>11 von 112 Patienten, die auf Monotherapie gewechselt hatten, hatten ein virologisches Versagen, bei 9 von ihnen konnte eine Integraseresistenz nachgewiesen werden.<br />Eine Kombination von zumindest zwei antiretroviralen Substanzen wurde in den SWORD-1- +-2-Studien untersucht.<sup>7</sup> Hier mussten die Patienten mindestens 12 Monate unter voll suppressiver Erst- oder Zweitlinien-ART (<50c/ml) stehen. Diese musste 2 NRTI beinhalten plus NNRTI, PI oder Integraseinhibitor; ein vorangegangenes virologisches Versagen war nicht erlaubt. Eingeschlossen wurden 1024 Patienten (>70 % erhielten ein TDF-basiertes Regime), diese wurden – randomisiert so­fort oder verzögert – auf eine duale Therapie mit Dolutegravir (DTG) plus Rilpivirin (RPV) umgestellt. Nach Woche 48 hatten 95 % eine HIV-RNA <50c/ml, das virologische Nichtansprechen war in beiden Armen ≤1 % . In absoluten Zahlen waren zum Abbruch führende Nebenwirkungen im Switch-Arm häufiger, aber es zeigte sich kein signifikantes Muster. SWORD ist meines Wissens nach die einzige aktuelle Switch-Studie, die auch Knochen-Turn­over-Marker inkludierte, und diese zeigten alle eine signifikante Verbesserung zu Woche 48 nach Wechsel auf DTG + RPV.<br />Ein Patient entwickelte zu Woche 36 eine NNRTI-Mutation (K101K/E Mixture) und erfüllte damit die Kriterien für einen virologisch bedingten Abbruch. Zu diesem Zeitpunkt lag eine dokumentierte Nichtadhärenz vor, bei Einberufung des Patienten war er bereits wieder virussupprimiert, und das blieb auch unter Fortführung der Therapie mit DTG + RPV bis dato so. Integraseresistenzen waren zu keinem Zeitpunkt nachweisbar.<br />Die Kombination DTG + RPV wird als koformulierte Einzeltablette herauskommen und sicherlich durch ihre geringe Größe bestechen, die Einschränkungen hinsichtlich notwendiger Nahrungsaufnahme zum Einnahmezeitpunkt und Einnahme von Magensäurehemmern werden aber naturgemäß bestehen bleiben und von manchen Patienten wahrscheinlich nicht als Vereinfachung angesehen. Als mitursächlich für die guten Ergebnisse wurden in der Diskussion auch höhere DTG-Spiegel durch die Nahrungsaufnahme zum Einnahmezeitpunkt angesehen. Was die Studie nicht beantwortet, ist, wie gut eine Kombination von DTG + RPV bei Vorhandensein von NRTI-Mutationen, wie z.B. M184V, wirkt. Folgestudien, die derzeit auch Patienten mit solchen Mutationen rekrutieren, werden dazu in Zukunft hoffentlich Daten liefern.</p> <h2>Antiretrovirale Substanzen in Entwicklung</h2> <p>Raltegravir (Isentress®) wird wohl bald in einer Einmal-täglich-Formulierung auf den Markt kommen, es werden aber zwei Tabletten zu je 600mg sein, die gleichzeitig eingenommen werden, d.h., plus Backbone zählen wir zumindest 3 Tabletten. Es folgen allerdings auch neue Integraseinhibitoren. Vorgestellt wurden auf der CROI Phase-II-Ergebnisse von Bictegravir (BIC) + FTC/TAF vs. DTG + FTC/TAF.<sup>8</sup> Diese zeigten eine gute virologische Wirksamkeit, für eine aussagekräftige Abschätzung der Nebenwirkungen und Laborabnormitäten reichen naturgemäß Phase-II-Daten nicht aus. Aber vier große Phase-III-Studien sind bereits voll rekrutiert, und bei guten Ergebnissen könnte das nächste Eintablettenregime mit einem Integraseinhibitor, ohne Booster 2018 verfügbar sein.<br />Doravirin (DOR) ist ein neuer NNRTI, der sowohl hinsichtlich virologischer Effektivität bei vorbestehenden Resistenzen als auch hinsichtlich Einnahmerestriktionen Vorteile gegenüber den derzeitigen NNRTI hat. DOR kann einmal täglich unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden, die Gabe von Säureblockern ist ebenfalls möglich und es bestehen generell nur wenige Interaktionen mit anderen Medikamenten. Vorgestellt wurde eine Vergleichsstudie von DOR plus FTC/TDF oder ABC/3TC versus Ritonavir-geboostertes Darunavir mit dem gleichen Backbone. In jeden Arm wurden 383 Patienten randomisiert, die virologische Effektivität war in beiden Armen vergleichbar, ebenso die Rate an Nebenwirkungen. Auch Rash und neuropsychiatrische Nebenwirkungen waren im NNRTI-Arm nicht höher. DOR wird als Koformulierung mit generischem TDF und 3TC herausgebracht werden. Interessant wird die Beurteilung in den Leitlinien, da die Substanz bislang nicht mit einem Integraseinhibitor verglichen worden ist.<br />Für Patienten mit vielen Vortherapien und akquirierter Mehrklassenresistenz ist folgende Substanz mit neuem Wirkmechanismus in Entwicklung: Ibalizumab<sup>9</sup> (TaiMed Biologics) ist ein lang wirksamer monoklonaler Antikörper, der durch Bindung an ein Epitop des CD4-Rezeptors das Eindringen von HIV in CD4-Zellen blockiert. Es handelt sich dabei um einen Post-­Attachment-Inhibitor, ähnlich wie Fostemsavir (früher BMS, jetzt ViiV). In der vorgestellten Studie wurde 40 Patienten, bei denen die HIV-Therapie versagt hatte, zusätzlich Ibalizumab verabreicht, was zu einer HIV-RNA-Reduktion ≥2,0 log<sup>10</sup> bei 48 % der Patienten führte. In der Folge wurde das „Optimized background“-Regime angepasst. Zu Woche 24 hatten 43 % eine Viruslast <50c/ml und 50 % <200c/ml. Ibalizumab muss alle 14 Tage i.v. verabreicht werden, es hat von den Zulassungsbehörden einen Fast-Track-Status Orphan Drug erhalten, d.h., große Phase-III-Studien mit mehreren Hundert Patienten werden nicht notwendig sein.<br />Einen Überblick über aussichtsreiche Substanzen, die sich aktuell in Entwicklung befinden, bietet Tabelle 1.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Infekt_1702_Weblinks_s28_2.jpg" alt="" width="1051" height="1096" /></p> <h2>Therapiekomplikationen und Komorbiditäten</h2> <p>Wir können uns an das Aufsehen der Publikationen der D:A:D-Kohorte hinsichtlich der Assoziation einer Therapie mit Proteaseinhibitoren und Myokardinfarkt bzw. auch die umstrittene Auswertung bezüglich Abacavir erinnern. Heuer wurden nun Daten zu Darunavir und kardiovaskulären Erkrankungen (MI, invasive Koronarin­terventionen, plötzlicher Herztod und Schlaganfall) vorgestellt.<sup>10</sup> Diese wurden prospektiv seit 2009 bei >3500 Patienten erhoben, und man erfasste seither 1157 Patienten (3,2 % ) mit einem kardiovas­kulären Event. Die Einnahme von mit Ritonavir geboostertem Darunavir (DRV/RTV) war mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert. Das Risiko steigt mit kumulativer Exposition, in einer multi­variaten Analyse zeigte sich ein relativer Risikoanstieg von 59 % nach 5-jähriger Einnahme von DRV/RTV im Unterschied zu geboostertem Atazanavir (ATV/RTV). Adjustiert wurde für BMI, CD4, Viruslast, Hyperlipidämie und Nierenfunktionsstörungen. Somit erscheint diese Assoziation nicht durch erhöhte Blutfette vermittelt zu sein. Wie immer gibt es bei Beobachtungsstudien die Gefahr einer Scheinkorrelation durch Störfaktoren (Confounder-Variable). Eine weitere Limitation ist, dass in der Analyse nicht zwischen den zwei möglichen Tagesgesamtdosen von 1200/200mg bzw. 800/100mg DRV/RTV unterschieden wurde. Die Studie beweist aber wieder einmal, wie wichtig Kohortendaten für das Erfassen von möglichen Langzeitkomplikationen von Therapien sind.</p> <p>Quelle: <br />CROI – Conference on Retroviruses and Opportunistic ­Infections, 13. bis 16. Februar 2017, Seattle, USA</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Arribas J: CROI 2017, Abstract 453 <strong>2</strong> Hodder S: CROI 2017, Abstract 443 <strong>3</strong> Fulcher JA: CROI 2017, Abstract 500LB <strong>4</strong> Joly V: CROI 2017, Abstract 458 <strong>5</strong> Wijting I: CROI 2017, Abstract 451LB <strong>6</strong> Blanco JL: CROI 2017, Abstract 42<br /><strong>7</strong> Llibre JM: CROI 2017, Abstract 44LB <strong>8</strong> Sax PE: CROI 2017, Abstract 41 <strong>9</strong> Lewis S: CROI 2017, Abstract 449LB <strong>10</strong> Ryom L: CROI 2017, Abstract 128LB</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...