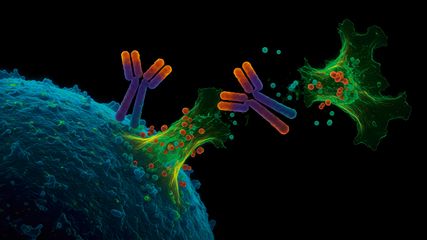©
Getty Images/iStockphoto
Tropenmedizinisch relevante Parasitosen der Leber
Leading Opinions
Autor:
Prof. Dr. med. Herbert Auer
Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin<br> Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, Wien<br> E-Mail: herbert.auer@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
01.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Leber, als das wichtigste Stoffwechselorgan des Menschen, kann von Bakterien und Viren, aber auch von zahlreichen parasitären Krankheitserregern befallen werden. Darunter finden sich einerseits Parasiten, die die Leber bzw. die intrahepatischen Gallengänge als Hauptlokalisation benützen, andererseits aber auch Erreger, die sich in anderen Organen lokalisieren, dabei aber auch die Leber schädigen können (z.B. Leishmania spp.). Viele dieser Leberparasiten weisen in den warmen Gebieten unserer Erde eine deutlich höhere Prävalenz auf. Im Folgenden sollen nur jene drei Erreger genauer beschrieben werden, denen hohe medizinische Relevanz zukommt.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Weltweit kommen zahlreiche Parasiten vor, die sich in der Leber des Menschen lokalisieren können, einige davon bevorzugt in den warmen Regionen unserer Erde.</li> <li>Drei der wichtigsten Leberparasiten sind Entamoeba histolytica (Erreger der Amöbenruhr und des Amöbenleberabszesses), Fasciola hepatica (Erreger der Fasziolose) und Echinococcus granulosus (Erreger der zystischen Echinokokkose).</li> <li>Alle drei Parasitosen lassen sich labordiagnostisch leicht abklären und in der Regel erfolgreich behandeln, vorausgesetzt, es wurde differenzialdiagnostisch daran gedacht.</li> </ul> </div> <h2>Entamoeba histolytica und der Amöbenleberabszess</h2> <p>Die Ruhramöbe ist ein weltweit verbreiteter, einzelliger Parasit des Menschen, der aber in den Tropen (vor allem aufgrund mangelnder Hygienestandards) sehr leicht akquiriert werden kann. Die Infektion des Menschen erfolgt durch orale Aufnahme von vierkernigen Zysten (Ø: ca. 15µm, Abb. 1), die von anderen Menschen über die Fäzes ausgeschieden worden sind und über Schmutz- und Schmierinfektion, meist über die Hände nach Kontakt mit kontaminiertem Erdboden und kontaminierten Nahrungsmitteln (Bewässerung von Gemüse mit kontaminiertem Wasser), oder auch durch Insekten (z.B. Fliegen) in den Mund gelangen. Im Darm des Menschen befreit sich die Amöbe von der sie in der Umwelt vor Austrocknung schützenden Zystenmembran und beginnt, sich zu teilen. Die aus der Teilung entstehenden Trophozoiten (Ø: 15–18µm) können sich entweder zu einer meist apathogenen, ausschliesslich im Darmlumen lebenden Minutaform oder zu einer Magnaform (Ø: bis zu 30µm) entwickeln, die mittels zytolytischer Enzyme in das Darmgewebe eindringt und eine Amöbenruhr verursacht, die durch blutig-schleimige Durchfälle gekennzeichnet ist. Wird die Amöbenruhr nicht behandelt, können die Magnaformen auch hämatogen in die Leber gelangen, wo sie Parenchymzellen zerstören und (ausgedehnte) Nekrosen verursachen, die (fälschlicherweise) als Amöbenleberabszess (ALA) bezeichnet werden. Der ALA ist ein lebensbedrohender Zustand mit ausgeprägtem Krankheitsgefühl, Schmerzen im rechten Oberbauch, Fieber und erhöhten Entzündungsparametern. Die Diagnose basiert auf der geografischen und Krankheitsanamnese sowie dem Einsatz bildgebender Verfahren und vor allem parasitologisch-serologischer Untersuchungen auf spezifische Antikörper. Als Therapeutikum der Wahl gilt noch immer Metronidazol (3x 10mg/kg/Tag [max. 3x 800mg] über 10 Tage), anschliessend Behandlung zur Zysteneradikation mit Paromomycin (3x 500mg/Tag über 9–10 Tage). Differenzialdiagnostisch muss ein ALA von einem pyogenen Abszess differenziert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1805_Weblinks_s66_abb1.jpg" alt="" width="1051" height="842" /></p> <h2>Fasciola hepatica und die Fasziolose</h2> <p>Der Grosse Leberegel ist ein weltweit verbreiteter Wurm, der zwar eher in gemässigten Regionen vorkommt, aber vor allem in Südamerika (hauptsächlich Peru, Bolivien, Chile) hochendemisch ist. F. hepatica ist ein 2,5cm langer und etwa 1cm breiter Saugwurm, der vornehmlich in herbivoren Tieren parasitiert. Der Mensch erwirbt die Infektion durch Konsum von Vegetabilien (z.B. Bärlauch, Salate, Wasserkresse), an deren Oberfläche Metazerkarien, das sind Larvenstadien des Leberegels, die das Endprodukt einer Metamorphose und Vermehrung in Zwischenwirtsschnecken darstellen, kleben.<br /><br /> Im Dünndarm des Menschen wird die Metazerkarienhülle aufgelöst und die Jungegel penetrieren die Dünndarmwand, halten sich kurzzeitig in der Bauchhöhle auf und durchwandern anschliessend das Leberparenchym, bis sie schliesslich in den Gallengängen zu adulten Würmern heranwachsen, wo diese (unbehandelt) viele Jahre leben können. Die Inkubationszeit beträgt meist nur 1–2 Wochen, die wichtigsten klinischen Symptome sind Oberbauchschmerzen, es können Fieber und Abgeschlagenheit auftreten. Nach dieser 2- bis 4-wöchigen Akutphase beginnt der chronische Teil der Fasziolose, die vor allem durch eine Hepatomegalie gekennzeichnet ist. Labordiagnostisch fallen immer eine (hohe) Eosinophilie und eine Erhöhung der Entzündungsparameter auf. Die Diagnostik der Fasziolose basiert auf der geografischen Anamnese (die Fasziolose ist auch in Mitteleuropa prävalent), der klinischen Symptomatik, einem pathologischen Blutbild sowie der Durchführung parasitologisch-serologischer Tests. Eine Untersuchung des Stuhls auf Wurmeier ist in der Akutphase nicht zielführend, Eier lassen sich erst 12 bis 14 Wochen nach dem Infektionszeitpunkt nachweisen; eine Therapie kann aber bereits nach Erhebung des Antikörperspiegels gestartet werden. Als Wirkstoffe stehen Triclabendazol (2x 10mg/kg KG/Tag, im zeitlichen Abstand von 12 Stunden) und Nitazoxanid (2x 500mg/Tag, 3 Tage) zur Verfügung.</p> <h2>Echinococcus granulosus und die zystische Echinokokkose</h2> <p>Der Hundebandwurm ist ein ubiquitär vorkommender Parasit, der sowohl in gemässigten Klimazonen (vor allem auch im Mittelmeergebiet) als auch in den Tropen und Subtropen vorkommt. Der Mensch infiziert sich durch orale Aufnahme der Bandwurmeier aus dem Kot angesteckter Hunde nach Kontakt mit kontaminierter Erde, Vegetabilien oder kontaminiertem Wasser oder durch Kontakt mit dem kontaminierten Fell streunender Hunde. Im Dünndarm schlüpft aus dem Ei eine Larve, die hämatogen in die Leber gelangt, wo sie in den meisten Fällen auch «hängen » bleibt. Gelegentlich werden die Larven aber auch in andere Organe, z.B. Lunge, Herz, Nieren, ZNS, transportiert. In der Leber wächst die Larve zu einer Zyste heran, die auch Fussballgrösse erreichen kann (Abb. 2). Durch das zystisch-expansive Wachstum kommt es meist nach vielen Monaten nach der Infektion zu Oberbauchbeschwerden, die den Patienten zum Arzt führen. Die Diagnose der zystischen Echinokokkose basiert auf der geografischen Anamnese, der klinischen Symptomatik (im Differenzialblutbild kann eine Eosinophilie feststellbar sein) sowie dem Einsatz bildgebender Verfahren (Abdomen- Ultraschall, CT, MRT) und parasitologisch- serologischer Tests, wobei diese nur in einem Labor mit hoher Expertise durchgeführt werden sollten. Die Behandlung kann chirurgisch durch Entfernung der Echinococcuszyste (unter dem Schutz des Antihelminthikums Albendazol) durchgeführt werden, darüber hinaus steht aber auch die PAIR-Technik (Punktion- Aspiration-Instillation-Reaspiration) zur Verfügung. Bei Inoperabilität kann auch eine rein antihelminthische Therapie mit Albendazol (2x 400mg/Tag, über viele Monate oder Jahre) erfolgen. Auch eine «Watch and wait»-Strategie ist bei Vorliegen «alter» Echinococcuszysten möglich. Jeder Therapie sollte aber ein umfassendes Staging vorausgehen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1805_Weblinks_s66_abb2.jpg" alt="" width="1051" height="842" /></p> <h2>Resümee</h2> <p>Bei Reisen in die warmen Klimazonen unserer Erde (Tropen, Subtropen, aber auch z.B. das Mittelmeergebiet) können neben viralen und bakteriellen Erregern auch Parasiten erworben werden, die sich in der Leber des Menschen lokalisieren und schwere Krankheiten (Parasitosen) hervorrufen können. Drei der wichtigsten stellen Entamoeba histolytica (Erreger der Amöbenruhr und des Amöbenleberabszesses/ ALA), Fasciola hepatica (Erreger der Fasziolose) und Echinococcus granulosus (dreigliedriger Hundebandwurm) dar.<br /> Labordiagnostisch können alle drei genannten Erreger in einem kompetenten und erfahrenen parasitologischen Labor leicht diagnostiziert und durch adäquate Therapien (z.B. mit Antiparasitika und auch durch chirurgisches Vorgehen) gut und erfolgversprechend behandelt werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass diese Leberparasitosen in die Differenzialdiagnose einbezogen und abgeklärt werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...