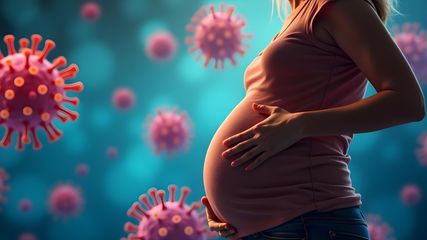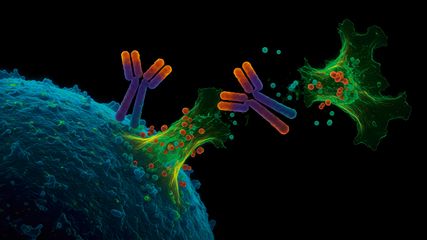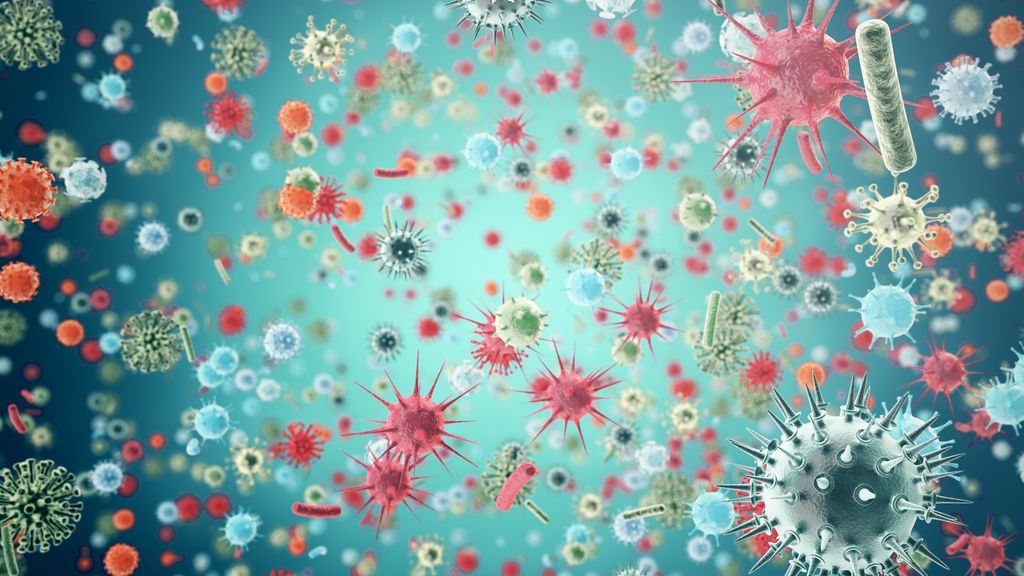
©
Getty Images/iStockphoto
Konsensus zur Legionellenpneumonie erschienen
Jatros
30
Min. Lesezeit
13.09.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das Problem der Legionellenpneumonie hat sich aus dem Krankenhausbereich, in dem es weitgehend eingedämmt werden konnte, in den ambulanten Bereich verlagert. Den aktuellen Stand zu diesem Thema gibt ein von der ÖGIT zusammen mit der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP) und der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) getragener Konsensus wieder. Im Folgenden die wichtigsten Punkte.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Steigende Inzidenz der Legionellenpneumonie zu verzeichnen, bei gleichzeitig sinkender Letalität; 97 % aller Fälle ambulant bzw. reiseassoziiert</li> <li>Wichtigste diagnostische Methoden: Kultur, PCR, Harnantigen- Test</li> <li>LP ist eine schwere, meldepflichtige Erkrankung, Letalität von 10 % ; hohes Fieber häufig, mögliche Symptomatik von Durchfall und Verwirrtheit</li> <li>Therapie primär mittels moderner Chinolone oder Makrolide; Tetrazykline als zweite Wahl; Therapiedauer von 7–10 Tagen</li> <li>Patientenspezifische Risikofaktoren: männliches Geschlecht, höheres Lebensalter, Rauchen, Komorbiditäten und Reisen</li> <li>Umweltbedingte Risikofaktoren: Whirlpools, Kühltürme mit offenen Wassersystemen, Autowaschanlagen etc.; aerosolisierte Legionellen können kilometerweit übertragen werden.</li> </ul> </div> <p>Legionellen sind strikt aerobe, keine Sporen bildende, bewegliche, gramnegative (aber in der Gramfärbung schlecht darstellbare) Stäbchen, die ein warmes, feuchtes Milieu bevorzugen. Sie kommen in der Natur in fast allen wässrigen bzw. feuchten Umgebungen vor und verursachen in ihrem natürlichen Ökosystem in der Regel keinerlei Probleme. Es ist vielmehr der Mensch, der durch bestimmte Einrichtungen, die dem gesteigerten Komfort dienen, wie Warmwassersysteme, offene Kühltürme, Whirlwannen und Ähnliches, die Vermehrung und Verbreitung begünstigt.<br /> Ausbrüche kommen vor; eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht zu befürchten.<br /> Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen zwischen 25 und 45°C; sie überleben aber auch 5°C und kurzfristig bis zu 60°C.<br /> Die Erreger besitzen ein duales Wirtssystem: Sie vermehren sich einerseits in frei lebenden Amöben, andererseits in menschlichen Makrophagen. Infizierte Amöben sind deshalb von Bedeutung, weil Legionellen spezielle Virulenzfaktoren, die sie für die Infektion des Menschen benötigen, erst bei intrazellulärer Vermehrung entwickeln.<br /> In Wasserverteilungssystemen bieten die stets vorhandenen Beläge und Biofilme Legionellen mit ihren speziellen Nährstoffansprüchen sowohl eine optimale Lebensgrundlage als auch einen gewissen Schutz vor chemischen Noxen wie Chlor. Ein spezielles Problem in älteren Gebäuden, das nicht immer kausal gelöst werden kann, können Totleitungen sein. In Aerosolen enthaltene Legionellen können sich über große Distanzen verbreiten.</p> <h2>Epidemiologie</h2> <p>Die Inzidenz der Legionellenpneumonie (LP) ist in Österreich und auch weltweit gestiegen. Im Gegensatz dazu ist jedoch die Letalität gesunken. Die Inzidenz nimmt mit dem Lebensalter zu, wobei Frauen in jedem Alter seltener betroffen sind als Männer.<br /> Tabelle 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Risikofaktoren.<br /> Der Grund für den Anstieg dürfte einerseits in einer vermehrten Diagnostik und neu eingeführter Meldepflicht liegen. Darüber hinaus könnte es auch einen Zusammenhang mit der Klimaveränderung geben. In besonders feuchten, warmen Sommern könnte das Durchfahren einer Pfütze genügen, um genügend Wasser für eine Ansteckung zu aerosolisieren.<br /> Der Anteil der nosokomialen LP-Fälle an der Gesamtzahl ist inzwischen durch gute Surveillance- und Hygienemaßnahmen auf 3 % gesunken. Der Anstieg betrifft ausschließlich den ambulanten und reiseassoziierten Bereich.</p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Der diagnostische Goldstandard ist nach wie vor die Kultur aus Sekret, das aus dem unteren Respirationstrakt gewonnen wird. Die Sensitivität variiert, die Spezifität liegt nahe bei 100 % , ebenso der positive prädiktive Wert. Eine negative Kultur schließt eine LP nicht sicher aus; sie muss in Zusammenschau mit dem Ergebnis eines Harnantigentests interpretiert werden.<br /> Die klassische Kultur kann bis zu zehn Tage dauern, in der Regel kommt es nach drei bis fünf Tagen zur Koloniebildung.<br /> PCR-basierte Verfahren haben den Vorteil, innerhalb von Stunden Ergebnisse zu liefern.<br /> Auch der Harnantigentest liefert rasche Ergebnisse und ist bei hoher Vortestwahrscheinlichkeit für LP das Testverfahren der ersten Wahl. Ein negativer Harnantigentest sollte stets in Zusammenschau mit Kultur und molekularen Untersuchungen interpretiert werden.<br /> Die Legionellenserologie ist für den klinischen Alltag kaum von Bedeutung.</p> <h2>Klinik</h2> <p>Das klinische Bild einer Legionelleninfektion reicht von gänzlich asymptomatischen Verläufen bis hin zu lebensgefährlichen Situationen. Das sogenannte Pontiac-Fieber ist eine akute, fieberhafte, durch Legionellen hervorgerufene Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen ohne Pneumonie.<br /> Die klassische Trias der LP besteht aus Pneumonie, Durchfall und Verwirrtheit; Durchfall tritt bei 25–50 % , Verwirrtheit bei 20–35 % der LP-Fälle auf. Die Inkubationszeit der LP liegt zwischen zwei und zehn Tagen. Neben Durchfall und Verwirrtheit (s. oben) treten häufig Fieber über 39°C und Husten auf. Die Letalität der LP liegt bei 10 % . Die Erkrankung ist in Österreich (wie auch in Deutschland und der Schweiz) meldepflichtig.<br /> Um die Wahrscheinlichkeit einer LP abzuschätzen, wurde ein Legionellen-CAPScore entwickelt. Er besteht aus folgenden Parametern (ein Punkt pro Parameter):</p> <ul> <li>Temperatur >39,4°C</li> <li>Kein Sputum</li> <li>Natrium <133mmol/l</li> <li>LDH >225U/l</li> <li>CRP >187mg/l</li> <li>Thrombozyten <171G/l</li> </ul> <p>In einer Studie hatten Patienten mit einem Score von 0 oder 1 nur in 3 % eine Legionellenpneumonie, Patienten mit einem Score ≥4 hingegen in 66 % . Eine Legionellendiagnostik ist vor allem ab einem Legionellen-CAP-Score ≥4 sinnvoll.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Als antimikrobielle Optionen kommen drei Substanzgruppen infrage: Chinolone, Makrolide und Tetrazykline. Betalaktame scheiden aus, da sie keine Wirkung auf intrazelluläre Erreger wie Legionella spp. entfalten. In einer deutschen S3-Leitlinie von 2016 werden Moxifloxacin und Levofloxacin als erste Wahl, Azithromycin oder Clarithromycin als Alternativen bezeichnet.<br /> Es ist festzuhalten, dass es keine prospektiven Therapiestudien gibt und die publizierten Daten meist aus retrospektiven Analysen von Legionellenausbrüchen stammen. Von einer Kombinationstherapie mit Rifampicin, wie sie früher üblich war, wird heute eher abgeraten, weil es andere gute Optionen gibt und Rifampicin ein hohes Interaktionspotenzial mit sich bringt.<br /> Tigecyclin und Doxycyclin können als zweite Wahl Verwendung finden, wenn sie ausreichend dosiert sind, d.h. in einer Tagesdosis von 200 bis 300mg.<br /> Resistenzen gegen Makrolide sind selten, aber beschrieben.<br /> Während früher eine Therapiedauer von drei Wochen gefordert wurde, geht man heute von sieben bis zehn Tagen aus.</p> <h2>Ausbruchsrisiken</h2> <p>Als „Rezept“ für Ausbrüche von Legionärskrankheit lässt sich das Zusammentreffen folgender Faktoren definieren: schlecht gewartete Wassersysteme – Aerosolisierung – Stamm mit hoher Virulenz – hohe Bakterienkonzentration – empfänglicher Wirt.<br /> Von den im Jahr 2016 in Österreich aufgetretenen 161 Fällen von Legionelleninfektionen waren 67 % ambulant erworben, 30 % in Beherbergungsbetrieben. Von den 108 ambulant erworbenen Fällen wurde bei 17 eine wahrscheinliche Infektionsquelle ausfindig gemacht. Dabei handelte es sich in erster Linie um Trinkwasser-Erwärmungsanlagen. Bei ausländischen Touristen traten 34 Fälle in Österreich auf; dies waren Personen, die sich während der Inkubationszeit in Hotels, auf Campingplätzen oder einem Schiff aufgehalten hatten. In all diesen Fällen wurde L. pneumophila Serogruppe (SG) 1 diagnostiziert. Diese Serogruppe zeigt weltweit die stärkste Häufigkeit und die höchste Virulenz. In einer europäischen Studie mit 1335 Fällen zeigten Legionellen SG 1, die positiv bezüglich eines virulenzassoziierten Epitops (MAb 3/1) waren, mit 67 % die größte Häufigkeit. Zu den Risikofaktoren siehe Tabelle 1.<br /> Die Ausbreitung von Legionellen in Aerosolen ist über beträchtliche Distanzen möglich, angegeben werden sieben bis zehn, in manchen Arbeiten sogar bis zu 20km Abstand – dies ist weiter als früher angenommen und natürlich für die Untersuchung von Ausbrüchen von erheblicher Bedeutung.<br /> Neben Kalt- und Warmwassersystemen von Gebäudeinstallationen sind mögliche Ausbruchsquellen auch offene Kühltürme oder Autowaschanlagen (hier gab es einen rezenten Fall in Österreich).<br /> Kühltürme stellen dann eine Gefahr für eine Emission von Legionellen dar, wenn sie ein offenes Wassersystem aufweisen. Auch Straßenreinigungsfahrzeuge, die mit Wasser arbeiten, können eine Ursache für Ausbrüche werden.<br /> Ebenso können auch Kläranlagen als Ausbruchsquellen infrage kommen. Es ist zu beachten, dass der Nachweis von Legionellen in einer Probe noch kein Beweis dafür ist, dass es sich hierbei um eine Ausbruchsquelle handelt. Dies kann nur mittels molekulargenetischer Vergleiche ermittelt werden. Ein Großteil der Legionelleninfektionen kann nicht auf eine spezifische Quelle zurückgeführt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1803_Weblinks_jatros_infekt_1803_s9_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="778" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Konsensusstatement „Legionellenpneumonie“, Medical
Dialogue, September 2018, abrufbar auf der Homepage
der ÖGIT unter http://www.oegit.eu/publikationen.htm
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...