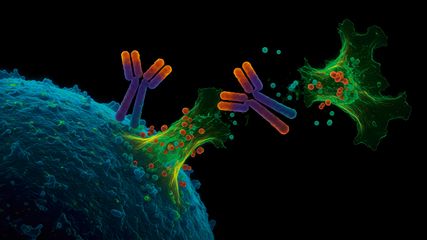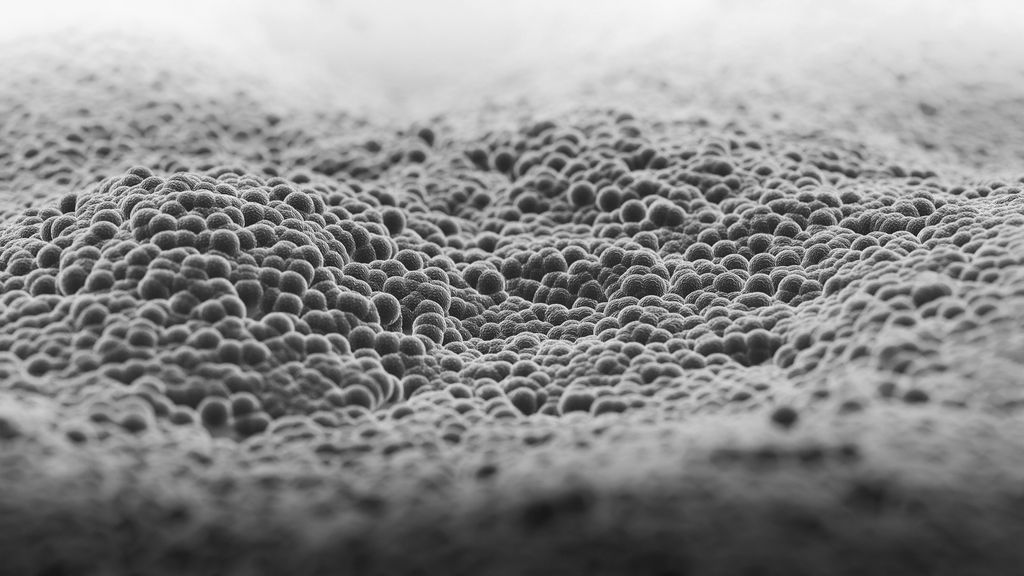
©
Getty Images/iStockphoto
„Infektkind“ und Immundefizienz
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Sebastian M. Schmidt
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin<br> Universitätsmedizin Greifswald<br> E-Mail: schmidt3@uni-greifswald.de
30
Min. Lesezeit
15.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Zum Ende der Schwangerschaft können Antikörper der Klasse IgG die Plazentaschranke passieren. So werden reif geborenen Kindern passiv humorale Abwehrstoffe ihrer Mütter übertragen. Mit diesem „Nestschutz“ sind Reifgeborene in den ersten Monaten ihres Lebens gegen die am Ende der Schwangerschaft durchgemachten mütterlichen Infektionskrankheiten weitgehend geschützt.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Eine physiologische Infektanfälligkeit ist Teil des normalen Reifungsprozesses des Immunsystems.</li> <li>Die 5 Leitsymptome für einen Immundefekt sind eine pathologische Infektanfälligkeit (Akronym „ELVIS“), die Immundysregulation (Akronym „GARFIELD“), eine Gedeihstörung, eine auffällige Familienanamnese und bestimmte Laborbefunde inkl. Genetik.</li> <li>Mittels immunologischer Basisdiagnostik (Blutbild mit Differenzierung, IgG, IgA und IgM) werden ca. 60–70 % der Erkrankungen erfasst.</li> <li>Chronische Erkrankungen, z. B. der Atmungsorgane, können einen Immundefekt vortäuschen, aber auch dessen Folge sein.</li> </ul> </div> <p>Frühgeborene kommen zur Welt, bevor nennenswerte Mengen der Abwehrstoffe übertragen werden können. Sie haben daher – in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der verfrühten Geburt – keinen so guten „Nestschutz“ erhalten und sind anfälliger für Infektionserkrankungen.<br /> Die passiv übertragenen IgG-Antikörper sind allerdings nach einigen Monaten nicht mehr ausreichend vorhanden. Das Kind muss bei Infektionen selbst Abwehrstoffe bilden. In Kenntnis der genetisch bedingten Vielfalt des Immunsystems wird klar, dass nicht jede Infektion gleich gut verarbeitet werden kann. Die individuell ausgeprägte HLA-Formel eines jeden Individuums impliziert auf immunologischer Ebene, dass TZell- Epitope und interagierende Moleküle der frühen Immunabwehr verschiedener Menschen die gleichen Antigene von Erregern nicht immer gleich gut verarbeiten können. Begleitende Dispositionen, z. B. Atopie oder chronische Erkrankungen, führen zu zusätzlichen Modifikationen. Es wird daher Kinder geben, die häufiger krank sind, und solche, die kaum krank werden. Oft wissen Eltern oder Großeltern, dass auch bei ihnen in der Kindheit eine solche Infektanfälligkeit vorlag und wie lange sie dauerte.</p> <h2>Immunologisches Gedächtnis</h2> <p>Es gibt mehrere Hundert Erreger bzw. Erregersubtypen, gegen die Abwehrstoffe gebildet werden müssen und ein immunologisches Gedächtnis erzeugt werden muss. Kommt es nur bei 10–20 % der Erstinfektionen zu einer manifesten Erkrankung, erscheint dies den Eltern als ein sehr häufiges Ereignis. Als Besonderheit kann bei bakteriellen Erregern mit einer Polysaccharidkapsel (z. B. Pneumo- und Meningokokken sowie <em>Haemophilus influenzae</em> Typ B) bis etwa zum 2. Geburtstag ein immunologisches Gedächtnis gegen diesen Bestandteil gar nicht erzeugt werden. Faktoren, die die Infektneigung unterstützen, sind u. a. der Kontakt mit Zigarettenrauch und mit kranken Kindern, wie er z. B. beim Besuch einer Kindertagesstätte häufig auftritt. Ist ein immunologisches Gedächtnis dann aber vorhanden, ist die schnellere Initiierung einer sehr spezifischen Immunantwort leichter und die Infektanfälligkeit lässt nach. Klinisch ist dieser Zeitpunkt meist mit etwa dem 4. Geburtstag erreicht.<br /> Untersuchungen an sonst gesunden Kindern ohne chronische Erkrankungen zeigen, dass in den ersten 4 Lebensjahren im Durchschnitt 5–6 respiratorische Erkrankungen (maximal 10–12, also monatliche (!) Erkrankungen, oft mit einer Häufung im Winter) normal sind. Erst im Schulalter verringert sich die Erkrankungsfrequenz deutlich.</p> <h2>Klinisch relevanter Immundefekt</h2> <p>Von der häufigen physiologischen Infektanfälligkeit abzugrenzen sind Patienten mit einem echten, klinisch relevanten Immundefekt (kumulative Häufigkeit aller Immundefekte ca. 1:5000) und solche mit chronischen respiratorischen Erkrankungen (z. B. Mukoviszidose). Sie weisen eine pathologische Infektanfälligkeit auf. Eine Diagnosestellung der Grunderkrankung muss möglichst bald erfolgen, da eine längere Krankheitsdauer ohne adäquate Behandlung mit dem Auftreten von nicht reversiblen, strukturellen Lungenschäden verbunden ist. Daher ist die Abgrenzung zur physiologischen Infektanfälligkeit notwendig. Kinder mit einer pathologischen Infektanfälligkeit haben mehr als 8 Minor- Infektionen pro Jahr von einem eher höheren Schweregrad bis zum Kleinkindesalter und darüber hinaus können Major-Infektionen auftreten. Der Verlauf ist rezidivierend oder chronisch und führt nicht immer zu einer Restitutio ad integrum. Rezidive mit demselben Erreger und opportunistische Infektionen werden beobachtet.<br /> Die pathologische Infektanfälligkeit ist ein Leitsymptom für primäre Immundefekte. Die klinischen Hinweiszeichen werden mit dem Akronym „ELVIS“ beschrieben (Tab. 1). Trotz fehlender Infektanfälligkeit kann ein primärer Immundefekt vorliegen. Ein anderes Leitsymptom ist die Immundysregulation, deren Zeichen mit dem Akronym „GARFIELD“ beschrieben werden (Tab. 2). Weitere Leitsymptome sind eine Gedeihstörung, eine auffällige Familienanamnese (z. B. mit Konsanguinität, Immundefekt und pathologischer Infektanfälligkeit) sowie bestimmte Laborbefunde (z. B. persistierende Lymphozytopenie, Neutrozytopenie, Hypogammaglobulinämie) inklusive eines genetischen Hinweises auf einen primären Immundefekt oder ein positives Neugeborenenscreening auf primäre Immundefekte.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1903_Weblinks_jatros_pneumo_1903_s20_tab1_schmidt.jpg" alt="" width="550" height="455" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1903_Weblinks_jatros_pneumo_1903_s21_tab2_schmidt.jpg" alt="" width="550" height="337" /></p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Bei den Laboruntersuchungen können mittels immunologischer Basisdiagnostik schon ca. 60–70 % der Erkrankungen erfasst werden. Zur Basisdiagnostik gehören die Bestimmung des Blutbildes mit Differenzierung sowie von IgG, IgA und IgM. Diese kann in jeder Sprechstunde durchgeführt werden und ist nicht teuer. Mittels weiterführender Diagnostik werden dann in der Spezialambulanz erkrankungsbezogen Befunde bestimmt (IgE, IgG-Subklassen, Impfantikörper, Komplement CH50 etc.). Die Bestimmung der IgG-Subklassen ist nur indiziert ab dem 3. Lebensjahr, bei normalem Gesamt-IgG, rezidivierenden bakteriellen Infektionen sowie Candida- Infektionen. Eine Labor-Spezialdiagnostik wird vorwiegend in Spezialambulanzen durchgeführt. Sie umfasst die Bestimmung der Phagozyten, B- und T-Zellen (Anzahl und Funktionstests) sowie ggf. von Einzelkomponenten des Komplements. Bei gezieltem Verdacht können weitere Untersuchungen in Speziallaboratorien notwendig werden.<br /> Neben immunologischen Krankheitsbildern können auch chronische Erkrankungen z. B. der Atmungsorgane einen Immundefekt vortäuschen. Sie können aber auch Folge des Immundefektes sein, insbesondere wenn er schon länger besteht oder nicht rechtzeitig diagnostiziert worden ist. Hier sind dann bildgebende Verfahren (initial Röntgenbild des Thorax) und z. B. ein Schweißtest zum Ausschluss einer Mukoviszidose indiziert. Im Einzelfall kann eine Bronchoskopie notwendig sein, etwa bei Verdacht auf Fremdkörperaspiration, Fehlbildung des Bronchialbaumes oder Infektionen mit speziellen Erregern.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> AWMF-Leitlinie „Diagnostik auf Vorliegen eines primären Immundefekts“</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...