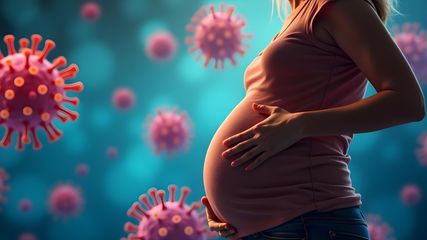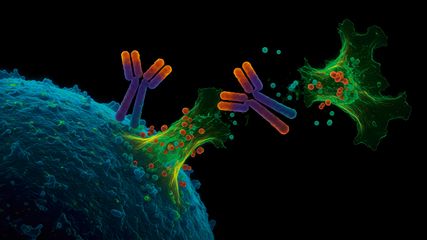Impfungen bei Erwachsenen
Leading Opinions
Autor:
PD Dr. med. Werner C. Albrich, MSCR
Leitender Arzt, <br>Klinik für Infektiologie/ Spitalhygiene<br> Kantonsspital St. Gallen<br> Rorschacher Strasse 95<br> 9007 St. Gallen<br> E-Mail: werner.albrich@kssg.ch
Autor:
Dr. med. Ana Steffen
30
Min. Lesezeit
12.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Impfberatung von Kindern, gesunden Erwachsenen, aber auch von besonderen Patientengruppen wie Schwangeren, Reisenden und Immunsupprimierten gehört zum Alltag in der Grundversorgerpraxis. Auch die Impfberatung von Migranten, bei denen der Impfstatus häufig unbekannt oder nur anamnestisch zu erfragen ist, ist eine Herausforderung für den betreuenden Hausarzt. Als Basis dient der jährlich aktualisierte Schweizerische Impfplan des Bundesamts für Gesundheit<sup>1</sup>, welcher neben den empfohlenen Basis- und Boosterimpfungen für Kinder und Erwachsene auch viele der oben erwähnten speziellen Impfsituationen abbildet. Im vorliegenden Artikel sollen die aktuellen Impfempfehlungen für Erwachsene mit und ohne besondere Risikofaktoren zusammengefasst werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Basis- und Nachholimpfungen bei Erwachsenen</h2> <p>Ausgehend von einer kompletten Grundimmunisierung in der Kindheit und Jugend, sieht der Schweizerische Impfplan regelmässige Auffrischimpfungen bei gesunden Erwachsenen vor. Bei fehlender oder unbekannter Grundimmunisierung sollen Nachholimpfungen, abhängig vom Erreger, in jedem Alter evaluiert werden. Als Grundregel sind Lebendimpfstoffe (MMR, Varizellen, Gelbfieber, Typhus) bei Schwangeren und Patienten mit Immunsuppression kontraindiziert. Zwei Lebendimpfstoffe sollten zur optimalen Impfantwort mit einem Abstand von mindestens 4 Wochen verabreicht werden. Alternativ ist auch die gleichzeitige Gabe von zwei Lebendimpfstoffen möglich mit leicht reduzierter Impfantwort.<br /> Die Kosten für die Basis- und Nachholimpfungen werden, abzüglich der Franchise, von der Krankenkasse übernommen. <br /><br /><strong>Diphtherie/Tetanus/Pertussis (dTp<sub>a</sub>)</strong><br /> Auffrischimpfungen werden im Alter zwischen 25 und 65 Jahren alle 20 Jahre (mit 25, 45 und 65 Jahren) empfohlen. Ab dem Alter von 65 Jahren gilt aufgrund der Immunoseneszenz wie auch bei immundefizienten oder -supprimierten Personen weiterhin die Empfehlung für die Auffrischung alle 10 Jahre. Zwischen 25 und 29 Jahren sollte im Hinblick auf die Familiengründung und den Säuglingsschutz eine dTp<sub>a</sub> (mindestens 2 Jahre nach letzter dT-Impfung) verabreicht werden. Knapp jede dritte Pertussisinfektion im Säuglingsalter kann auf eine Übertragung durch einen Erwachsenen zurückgeführt werden.<sup>2</sup> Daher sollten alle Erwachsenen mit regelmässigem beruflichem oder privatem Kontakt zu Säuglingen unter 6 Monaten alle 10 Jahre sowie in jeder Schwangerschaft (s.u.) den Impfschutz mit dTp<sub>a</sub> auffrischen.<br /><br /> <strong>Polio</strong><br /> Da die weltweite Polioeradikation noch nicht erreicht ist, werden Auffrischimpfungen vor Reisen in Risikogebiete alle 10 Jahre empfohlen.<br /><br /> <strong>Masern/Mumps/Röteln</strong><br /> Bei unvollständig geimpften oder ungeimpften, nach 1963 geborenen Erwachsenen werden je nach Anzahl früherer Dosen 1 bzw. 2 MMR-Nachholimpfungen im Abstand von mindestens 1 Monat empfohlen. Dies gilt auch für Personen mit anamnestisch durchgemachter Masernerkrankung sowie besonders für Frauen im gebärfähigen Alter vor einer Schwangerschaft und für beruflich exponierte Personen.<br /><br /> <strong>Varizellen</strong><br /> Aufgrund der höheren Komplikationsrate bei Primoinfektion im Erwachsenenalter werden bei Erwachsenen <40 Jahren, die anamnestisch keine Varizellen durchgemacht haben, zwei Nachholimpfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen empfohlen.<br /> <br /> <strong>Hepatitis B</strong><br /> Kann in jedem Alter als Nachholimpfung verabreicht werden, ausser wenn kein Expositionsrisiko vorliegt. Ab 16 Jahren sind drei Dosen im Abstand von 0, 1 und 6 Monaten indiziert. Eine serologische Erfolgskontrolle ist nur bei besonderen Risikosituationen notwendig, z.B. bei Beschäftigten im Gesundheitswesen.<br /><br /> <strong>HPV</strong><br /> Empfohlene ergänzende Impfung für Frauen im Alter zwischen 20 und 26 Jahren und Männern zwischen 15 und 26 Jahren, in Abhängigkeit vom individuellen Risiko. Die Basisimpfung wird bei Jugendlichen möglichst vor Beginn der sexuellen Aktivität empfohlen; es gibt aber zunehmend Daten, dass die Impfung auch nach erfolgter Infektion gegen Reinfektionen und Akquisition von anderen HPV-Typen schützt. Wird die 1. Dosis vor dem 15. Geburtstag gegeben, sind nur 2 Dosen im Abstand von mindestens 6 Monaten indiziert; ab dem 16. Lebensjahr werden 3 Dosen (0, 1–2 und 6 Monate) benötigt. Der quadrivalente Impfstoff Gardasil® ist für beide Geschlechter zugelassen; er wird wohl demnächst durch das 9-valente Gardasil 9® ersetzt. Sofern die 1. Impfung vor dem 27. Geburtstag bei einer registrierten Impfstelle erfolgt, werden die Kosten im Rahmen von kantonalen Impfprogrammen übernommen.<br /><br /> <strong>Influenza</strong><br /> Empfohlene Basisimpfung ab 65 Jahren, s. u.</p> <h2>Impfempfehlungen bei Migranten</h2> <p>Grundsätzlich sollten die Impfungen möglichst bald nach der Einreise durchgeführt werden. Serologien führen zu einem Zeitverlust, sind häufig schwierig zu interpretieren und sollten daher in der Regel vermieden werden. Im Zweifelsfall – bei fehlender Dokumentation und unsicherer Anamnese – kann die Person als ungeimpft betrachtet werden.<sup>3</sup> Bis auf die lokale Reaktion durch Hyperimmunisierung nach Tetanusimpfung müssen keine vermehrten Komplikationen durch «unnötige » Impfungen befürchtet werden. Hingegen zählt für den Impfschutz jede durchgeführte Impfung, unabhängig vom Zeitabstand; man muss nicht nochmals von vorne beginnen.<br /> Besonderes Augenmerk sollte auf die Varizellenimpfung gerichtet werden, da Migranten deutlich seltener eine Immunität durch eine natürliche Infektion in der Kindheit aufweisen als Schweizer. Das für die Praxis empfohlene Vorgehen ist in Tabelle 1 zusammengefasst.<br /> Ein bis zwei Monate nach der ersten dTp<sub>a</sub>-Impfung können die Tetanus-IgG bestimmt werden. Bei einem Resultat <0,1U/ ml sind für die Grundimmunisierung zwei weitere Impfungen nötig gemäss obigem Schema. Da viele Flüchtlinge aus Endemieländern stammen, sollten niederschwellig HBs-Ag und Anti-HBc-Antikörper gemessen werden. Die erste Hepatitis- B-Impfung sollte jedoch zeitgleich durchgeführt werden, ohne das Resultat abzuwarten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1803_Weblinks_s14_tab1.jpg" alt="" width="1433" height="495" /></p> <h2>Die jährliche Grippeimpfung</h2> <p>Die Influenza ist eine Erkrankung, deren Schweregrad und Auswirkungen von Gesundheitspersonal und Allgemeinbevölkerung unterschätzt werden. Beispielsweise zeigte eine aktuelle Studie ein deutlich erhöhtes Risiko für einen akuten Myokardinfarkt während eines gesamten Jahres nach bestätigter Influenzainfektion.<sup>4</sup> Die Impfung ist ausserdem bezüglich der Schutzwirkung und möglicher Nebenwirkungen deutlich besser als ihr Ruf. Die in der Hausarztpraxis (früher) häufig verwendete trivalente inaktivierte Vakzine zeigte in einer Metaanalyse bei 18- bis 64-Jährigen eine gepoolte Wirksamkeit von 59 % .<sup>5</sup> Der Impfschutz ist abhängig von saisonalem Antigen-Match, Alter und Immunstatus des Patienten. Wie die letzte Grippesaison eindrücklich gezeigt hat, kann der Antigen-Mismatch durch die Verwendung eines tetravalenten Impfstoffs, welcher beide Influenza-B-Stämme enthält, reduziert und damit die Anzahl der verhinderten Influenzafälle erhöht werden. Der trivalente adjuvantierte Impfstoff (Fluad®), welcher für Erwachsene ≥65 Jahre zugelassen ist, löst bei dieser Bevölkerungsgruppe eine etwas bessere Immunantwort aus, enthält jedoch nur einen B-Stamm.<br /> Die Influenzaimpfung reduziert bei Erwachsenen sowohl die Gesamtmortalität als auch die Rate an Hospitalisationen aufgrund von Pneumonie und Influenza.<sup>6, 7</sup><br /> Die Grippeimpfung wird in der Schweiz für alle Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko und solchen mit erhöhtem Übertragungsrisiko bzw. mit Kontakt zu Risikogruppen empfohlen (Tab. 2)</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1803_Weblinks_s14_tab2.jpg" alt="" width="1429" height="1030" /></p> <h2>Pneumokokkenimpfung</h2> <p>Die höchste Inzidenz von invasiven Pneumokokkenerkrankungen findet sich bei Kleinkindern sowie bei Senioren. Durch die Impfung von Säuglingen mit Pneumokokken-Konjugatimpfstoffen wird ein Herdenschutz gegenüber invasiven Pneumokokkenerkrankungen auch bei anderen Altersgruppen erreicht. Seit 2014 wird bei vorliegender Indikation auch im Erwachsenenalter eine einmalige Impfung mit dem 13-valenten Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (Prevenar®) empfohlen (Ausnahme: Transplantatempfänger). Dieser zeigt auch bei Erwachsenen einen guten Schutz vor invasiven Pneumokokkenerkrankungen und Pneumokokkenpneumonien8 und hat den 23-valenten Polysaccharidimpfstoff (Pneumovax®) ersetzt. Bei bereits mit Pneumovax® geimpften Patienten sollte der Abstand zur letzten Impfung mindestens 1 Jahr betragen. Der Abstand zwischen der Pneumokokkenund Influenzaimpfung sollte idealerweise mindestens 4 Wochen betragen, um eine optimale Immunogenität zu gewährleisten. Bei unsicherer Compliance des Patienten ist jedoch eine gleichzeitige Impfung möglich.<br /> Prevenar® ist in der Schweiz nur für Kinder <5 Jahren zugelassen (in anderen Ländern besteht keine Alterseinschränkung), weshalb eine Kostenübernahme bei Personen >5 Jahre durch die Grundversicherung nicht gesichert ist. Die Indikationen sind ähnlich wie bei der Influenzaimpfung, mit der Ausnahme, dass das Alter ≥65 Jahre ohne Komorbiditäten keine Indikation mehr darstellt. Die vollständige Auflistung der Impfindikationen ist auf der BAG-Homepage ersichtlich.<sup>9</sup></p> <h2>Impfung gegen Herpes zoster</h2> <p>Die Inzidenz des Herpes zoster mit der postherpetischen Neuralgie als möglicher Komplikation steigt altersabhängig an und hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. 10 Ein attenuierter Lebendimpfstoff (Zostavax®) ist seit 2007 verfügbar, wurde jedoch erst 2018 in den Impfplan aufgenommen. Er enthält eine ca. 14-mal höhere Antigenmenge als der Varizellenimpfstoff. Zostavax® führt zu einer relevanten Reduktion sowohl der Zosterepisoden (um 50–70 % ) als auch der postherpetischen Neuralgie (um ca. 66 % ), wobei die Wirkung nach etwa 7 bis 10 Jahren deutlich abnimmt.<sup>11, 12</sup> Neu wird eine einmalige Dosis für immunkompetente Erwachsene im Alter von 65 bis 79 Jahren empfohlen, unabhängig von der Anamnese einer allfällig durchgemachten Varizellen- Primoinfektion. Auch eine Varizellenserologie vor der Impfung ist nicht nötig.<br /> Zudem wird eine einmalige Zosterimpfung auch für eine definierte Gruppe von in naher Zukunft immungeschwächten Personen zwischen 50 und 79 Jahren empfohlen, welche aktuell noch nicht von einer Immunschwäche oder nur von einer leichten betroffen sind. Bei dieser Patientengruppe soll hingegen zunächst eine Varizellenanamnese erhoben und bei negativer oder unsicherer Anamnese eine Serologie durchgeführt werden. Bei negativer Anamnese und Serologie soll statt der Zosterimpfung eine Impfung gegen Varizellen (Varilrix®, 2 Dosen im Abstand von ≥4 Wochen) verabreicht werden. Der Abstand zwischen der Zosterimpfung und einer relevanten Immunsuppression sollte mindestens 4 Wochen betragen. Grundsätzlich ist immer zwischen dem Nutzen und den möglichen Risiken der Lebendimpfung abzuwägen. Die vollständige Liste der Indikationen und Vorsichtsmassnahmen findet sich im Schweizerischen Impfplan.<sup>1</sup><br /> Die Einführung eines inaktivierten Zosterimpfstoffs (Shingrix®) in der Schweiz wird erwartet, sie wird zu einer Anpassung der Empfehlungen führen. Bis anhin wird die Zosterimpfung nicht von den Krankenkassen übernommen.</p> <h2>Impfung gegen Frühsommer- Meningoenzephalitis (FSME)</h2> <p>Die Grundimmunisierung sowie Boosterimpfungen alle 10 Jahre werden für alle Personen ab 6 Jahren empfohlen, welche in den Risikogebieten wohnen oder sich zeitweise dort aufhalten. Die Karte der Risikogebiete wird vom BAG jährlich aktualisiert und kann unter map.geo.admin. ch abgerufen werden.<br /> Die Grundimmunisierung mit dem Impfstoff FSME immun®CC erfolgt zu den Zeitpunkten 0, 1 und 6 Monate; mit Encepur ® 0, 1 und 10 Monate. Für beide Impfstoffe ist auch ein Schnellschema verfügbar (FSME immun®CC: 0, 14 Tage, 6 Monate; Encepur®: 0, 7, 21 Tage; 12 Monate).<sup>13</sup> Beide Impfstoffe sind grundsätzlich gleichwertig.</p> <h2>Impfempfehlungen bei Schwangeren</h2> <p>Bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte idealerweise vor Eintritt einer Schwangerschaft der Impfstatus v.a. hinsichtlich Masern und Röteln überprüft werden. Bei fehlender Immunität sollen Nachholimpfungen gegen MMR (falls ≤1 Impfung) und Varizellen (falls keine Varizellenanamnese und ≤1 Impfung) mindestens 1 Monat vor der geplanten Schwangerschaft durchgeführt werden. Falls zu Schwangerschaftsbeginn 1–2 dokumentierte MMR-Impfungen vorliegen, ist eine Serologie (Röteln und Masern) nicht notwendig. Auch die Varizellenanamnese sollte erhoben und bei fehlender Anamnese serologisch überprüft werden.<br /> Das Impfen während der Schwangerschaft wurde aus Angst vor unerwünschten Auswirkungen auf Mutter und Kind lange Zeit vermieden. Impfungen in der Schwangerschaft haben jedoch 3 wichtige Funktionen: Schutz vor schweren Infektionen der schwangeren Mutter (z.B. Influenza!); Nestschutz des Kindes durch den Antikörpertransfer; Reduktion von postpartaler Transmission dieser Infektionen von Mutter auf Kind. Die Impfungen gegen Influenza und Pertussis sind daher für jede Schwangere indiziert und sollten den betroffenen Frauen nach entsprechender Aufklärung sowohl von Frauenärzten als auch von Grundversorgern empfohlen werden. Lebendimpfungen sind bei Schwangeren nach wie vor kontraindiziert, wobei eine versehentlich verabreichte Lebendimpfung keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch darstellt. <br /><br /><strong>Pertussis</strong><br /> Als Kombinationsimpfung mit Diphtherie und Tetanus (dTp<sub>a</sub>) wird die Impfung seit 2017 für jede Schwangere in jeder Schwangerschaft empfohlen, unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Pertussisimpfung oder -erkrankung. Auch eine kürzlich erfolgte Tetanusimpfung stellt keine Kontraindikation dar. Die Impfung erfolgt im Hinblick auf einen optimalen Antikörpertransfer zum Kind vorzugsweise im 2. Trimenon, kann jedoch im 3. Trimenon nachgeholt werden.<br /><br /> <strong>Influenza</strong><br /> Während der Grippesaison ist die Impfung jeder Schwangeren ab dem 1. Trimenon indiziert. Eine Influenza ist bei Schwangeren, aber auch bei Neugeborenen mit einer höheren Komplikationsrate und Mortalität vergesellschaftet, was in allen bisherigen Pandemien und mit besserer Surveillance ausserhalb von Pandemien (also jährlich!) beobachtet werden konnte.<sup>14</sup> Die Grippeimpfung in der Schwangerschaft ist sicher, effektiv und führt zu einer Reduktion der Totgeburtenrate.<sup>15</sup></p> <h2>Impfschutz bei Asplenie</h2> <p>Eine anatomische oder funktionelle Asplenie ist mit einem lebenslangen Risiko für schwere Infektionsverläufe durch bekapselte oder intrazelluläre Erreger verbunden. Die Prävention durch Impfungen – soweit möglich – ist hier besonders wichtig (Tab. 3), zumal viele Patienten über ihr Risiko nur ungenügend informiert sind. Mit Abstand am häufigsten sind lebensbedrohliche Infektionen mit <em>Streptococcus pneumoniae</em>. Daneben gehören Meningokokken zu den impfpräventablen Infektionen bei Asplenie. Falls möglich, sollte eine Primovakzination gegen Pneumokokken und Meningokokken bereits mindestens 2 Wochen vor der Splenektomie oder alternativ einige Tage postoperativ, jedoch möglichst vor Spitalaustritt, erfolgen. Wenn vorhanden, sollten Konjugatimpfstoffe (Prevenar® bzw. Menveo®) den Polysaccharidimpfstoffen vorgezogen werden, da sie eine bessere Impfantwort auslösen.</p> <h2>Impfstrategien bei Immunsupprimierten mit Autoimmunerkrankungen</h2> <p>Grundsätzlich überwiegen in dieser Patientenpopulation die Vorteile gegenüber den potenziellen Risiken der Impfungen, jedoch sollten folgende Prinzipien berücksichtigt werden:<sup>16–18</sup></p> <ul> <li>Patienten ohne Immunsuppressiva: Keine Kontraindikationen für Impfungen; die Auslösung von Autoimmunität muss nicht befürchtet werden.</li> <li>Patienten mit geplanter Immunsuppression: Der Impfstatus soll möglichst vor Beginn der Immunsuppression kontrolliert und ergänzt werden, ggf. sind serologische Kontrollen (Masern, Varizellen) sinnvoll. Nach Lebendimpfungen soll mindestens 4–6 Wochen mit der immunsuppressiven Therapie zugewartet werden.</li> <li>Personen unter Immunsuppression: Totimpfstoffe sollten möglichst in der Phase der geringsten Immunsuppression verabreicht werden. Die Immunogenität kann reduziert sein, Konjugatimpfstoffe sind den Polysaccharidimpfstoffen vorzuziehen (Meningokokken, Pneumokokken).</li> <li>Lebendimpfstoffe: Impfstoffe mit hohem Replikationspotenzial (z.B. Gelbfieber) sollten wegen der Gefahr einer invasiven Infektion unter Immunsuppression vermieden werden; solche mit niedrigem Replikationspotenzial (Varizellen, Herpes zoster, orale Typhusimpfung) können unter gewissen Umständen verwendet werden. Zwischen dem Absetzen des Immunsuppressivums und einer Lebendimpfung sollten in Abhängigkeit von der Substanz unterschiedliche Zeitabstände eingehalten werden:<br /> ➥ Nach ≤20mg Prednison: kein Abstand<br /> ➥ Nach ≥20mg Prednison über >2 Wochen: ≥1 Monat<br /> ➥ Nach TNF-α-Blockern: ≥3 Monate<br /> ➥ Nach Rituximab: ≥12 Monate<br /> ➥ Nach Leflunomid: ≥2 Jahre</li> <li>Serologische Kontrollen: Sofern ein Antikörpertiter als Korrelat verfügbar ist, können serologische Kontrollen v.a. nach einer erstmaligen Impfung sinnvoll sein (Tetanus, Pneumokokken, Varizellen, Masern, Hepatitis A und B etc.).</li> <li>Cocooning: Auch die Überprüfung und ggf. Vervollständigung des Impfstatus von engen Kontaktpersonen gehören zum Schutz der immunsupprimierten Patienten.</li> <li>Expositionsfall: Nach relevanter Exposition von ungeschützten Patienten gegenüber Personen mit einer Masernoder Varizellenerkrankung ist eine passive Immunisierung mittels spezifischer oder unspezifischer Immunglobuline möglich.</li> <li>Indizierte Impfungen:<br /> ➥ Influenza: jährlich<br /> ➥ Pneumokokken (Konjugatimpfstoff)<br /> ➥ HPV bei jungen Frauen und Männern<br /> ➥ Herpes zoster (siehe oben)</li> </ul></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/ i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/ schweizerischer-impfplan.pdf.download.pdf/schweizerischer- impfplan-de.pdf <strong>2</strong> Heininger U, Krapf R: Pertussis – eine Herausforderung in der täglichen Praxis. Swiss Med Forum 2014; 14: 127-30 <strong>3</strong> Tarr P et al.: Impfungen bei erwachsenen Flüchtlingen. Swiss Med Forum 2016; 16: 1075-9 <strong>4</strong> Kwong JC et al.: Acute myocardial infarction after laboratory-confirmed influenza infection. N Engl J Med 2018; 378: 345-53 <strong>5</strong> Osterholm MT et al.: Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Inf Dis 2012; 12: 36-44 <strong>6</strong> Baxter R et al.: Effect of influenza vaccination on hospitalizations in persons aged 50 years and older. Vaccine 2010; 28: 7267- 72 <strong>7</strong> Fireman B et al.: Influenza vaccination and mortality: differentiating vaccine effects from bias. Am J Epidemiol 2009; 170: 650-6 <strong>8</strong> Bonten MJ et al.: Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. N Engl J Med 2015; 372: 1114-25<strong> 9</strong> Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF): Pneumokokkenimpfung: Empfehlungen zur Verhinderung von invasiven Pneumokokkenerkrankungen bei Risikogruppen. BAG Bulletin 2014; (8): 129-41 <strong>10</strong> Kawai K et al.: Increasing incidence of Herpes zoster over a 60-year period from a population-based study. CID 2016; 63: 221-6 <strong>11</strong> Oxman MN et al.: A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med 2005; 352: 2271-84 <strong>12</strong> Morrison VA et al.: Long-term persistence of zoster vaccine efficacy. Clin Infect Dis 2015; 60: 900-9 <strong>13</strong> Krause M, Majer S: Aktiv impfen gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Ther Umschau 2016: 73: 253-6 <strong>14</strong> Neuzil KM et al.: The effect of influenza on hospitalizations, outpatient visits, and courses of antibiotics in children. N Engl J Med 2000; 342: 225-31 <strong>15</strong> Regan AK et al.: Seasonal trivalent influenza vaccination during pregnancy and the incidence of stillbirth: population-based retrospective cohort study. Clin Infect Dis 2016; 62: 1221-7 <strong>16</strong> Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF): Impfprinzipien und Empfehlungen für Personen mit autoimmun-entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. BAG Bulletin 2014; (8): 159-61 <strong>17</strong> Bühler S, Hatz C: Impfungen bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Ther Umschau 2016; 73: 275-80 <strong>18</strong> Stähelin C et al.: Impfungen bei Immunsupprimierten. Ther Umschau 2016; 73: 281-9</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...