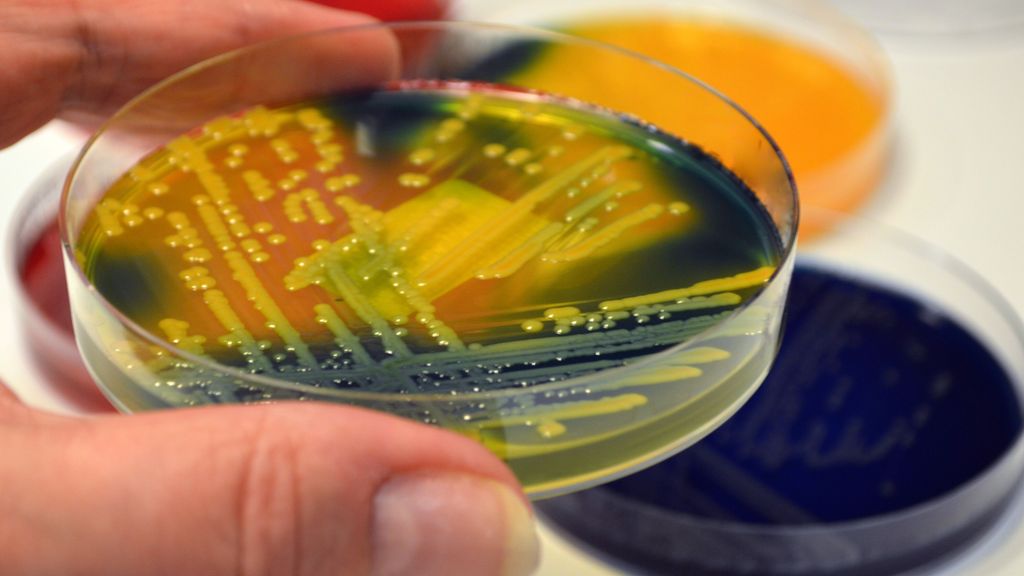
©
Getty Images/iStockphoto
Impfplan 2018: nationales Impfprogramm und Neuerungen
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Mag. Dr. Maria Paulke-Korinek, PhD
Leitung Abteilung III/7, Impfwesen<br> Bundesministerium für Arbeit, Soziales,<br> Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK)<br> E-Mail: maria.paulke-korinek@bmg.gv.at
30
Min. Lesezeit
05.04.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Impfplan 2018 wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) und Experten des Nationalen Impfgremiums erarbeitet und aktualisiert. Dabei wurden die Verfügbarkeit von Impfstoffen, neueste wissenschaftliche Daten und Erkenntnisse sowie epidemiologische Gegebenheiten berücksichtigt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Epidemiologie der Masern</h2> <p>Die Epidemiologie einer impfpräventablen Erkrankung beschäftigte Experten in letzter Zeit ganz besonders: der Masern. Die Masern sind eine der Infektionskrankheiten mit der höchsten Infektiosität, die wir kennen. Masern sind deutlich ansteckender als beispielsweise Influenza, Varizellen oder Ebola. Eine Person, die an Influenza erkrankt ist, steckt durchschnittlich 1–4 weitere Personen an. Im Gegensatz dazu steckt eine Person, die an Masern erkrankt ist, in der Regel 12–18 weitere Menschen in einer empfänglichen, nicht geimpften Population an. Man spricht hier auch von der Basisreproduktionsrate. Die Konsequenz dieser immens hohen Infektiosität ist, dass es schnell zu Masernausbrüchen kommen kann, sobald das Virus auf Gruppen von ungeschützten Personen trifft.<br /> Neben der akuten, fieberhaften Erkrankung mit Koplik’schen Flecken an der Wangenschleimhaut, charakteristischem makulopapulösem Exanthem und Konjunktivitis kann es im Rahmen von Masern zu Komplikationen wie Pneumonie oder Enzephalitis kommen. Durchschnittlich wird etwa ein Viertel der Erkrankten hospitalisiert, einer von 1000 Masernkranken verstirbt. Während der Erkrankung befällt das Masernvirus spezifische Gedächtniszellen, sie gehen dabei verloren. Das führt zu einer sogenannten „Immunamnesie“: Durch fehlende Immunität gegen vorangegangene Infekte ist das Risiko nicht nur für die Erkrankung an diesen Infekten, sondern sogar für den Tod durch andere Infektionskrankheiten für zwei bis drei Jahre nach der akuten Masernerkrankung signifikant erhöht. Sind die akuten Masern überstanden, so kann es außerdem Jahre später zur subakuten sklerosierenden Panenzephalitis (SSPE) kommen, die immer tödlich endet. Das Risiko für SSPE ist dabei mit 1:600 besonders hoch für Kinder unter einem Jahr, welche an Masern erkranken.<br /> Die Masern sind derzeit weltweit sehr aktiv. In Europa wurden besonders viele Masernfälle in Rumänien, Italien und Deutschland beobachtet, darunter auch bereits mehrere Todesfälle.<br /> In Österreich wurden 2017 95 Masernfälle registriert, wobei alle Bundesländer betroffen waren. Auffallend war, dass 19 % dieser Fälle „Healthcare-assoziiert“ waren, also entweder nosokomial erworben wurden und/oder bei Mitarbeitern des Gesundheitspersonals auftraten. Rund ein Viertel der Fälle betraf Kinder unter fünf Jahren und hier speziell auch Kinder unter einem Jahr, welche besonders auf einen indirekten Schutz durch ihr Umfeld angewiesen sind. Auffällig war auch, dass jeweils rund 30 % der betroffenen Personen 15–29 Jahre bzw. 30 Jahre und älter waren. Dies ist ein Beleg dafür, dass es bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach wie vor zahlreiche Impflücken gibt, und es bestätigt die Ergebnisse der Evaluierung der Masern-Durchimpfungsraten in Österreich: Kleinkinder müssen konsequenter und früher, entsprechend den Empfehlungen, mit zwei Dosen gegen Masern/ Mumps/Röteln geimpft werden. Zudem haben etwa eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher zwischen 15 und 30 Jahren noch keine zweite Impfung gegen Masern erhalten, auch hier ist ein Nachholbedarf gegeben.</p> <h2>Empfehlungen zur Masernimpfung</h2> <p>Die Masernimpfung ist in Kombination mit der Impfung gegen Mumps und Röteln für alle Kinder in Österreich ab dem vollendeten 9. Lebensmonat empfohlen. Wird die Erstimpfung im ersten Lebensjahr verabreicht, so sollte die zweite Impfung nach drei Monaten erfolgen – dies ist eine Neuerung der Empfehlungen 2018. Bei Erstimpfung nach dem ersten Lebensjahr sollte die zweite Impfung – wie gehabt – ehestmöglich, nach vier Wochen, verabreicht werden. Fehlende Impfungen gegen Masern/Mumps/Röteln sollen in jedem Lebensalter nachgeholt werden und sind derzeit in Österreich über die Gesundheitsbehörden für alle Altersgruppen kostenfrei erhältlich.<br /> Von Immunität gegen Masern kann man ausschließlich dann ausgehen, wenn zwei Lebendimpfungen dokumentiert sind oder ein positiver Antikörpernachweis vorliegt. Kommt es zu einem Masernausbruch, so können nicht ausreichend geimpfte bzw. nicht immune Kontaktpersonen von den Gesundheitsbehörden bis zu 21 Tage vom Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel Kindergarten oder Schule ausgeschlossen werden.</p> <h2>Influenza</h2> <p>Mittlerweile gibt es zahlreiche unterschiedliche Influenzaimpfstoffe, wie zum Beispiel trivalente oder tetravalente Totimpfstoffe oder den nasalen Lebendimpfstoff. Darum war es notwendig, hinsichtlich der Influenza-Impfempfehlungen eine neue Tabelle zu ergänzen, welche Angaben zu den Impfempfehlungen für die jeweilige Alters- und Personengruppe macht. Dabei wurde unter anderem berücksichtigt, dass z.B. bei Verwendung des nasalen Lebendimpfstoffs bei Erstimpfung ein besseres immunologisches Priming erfolgt oder dass bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens und Personen mit Kontakt zu vielen Risikopersonen die Verwendung eines tetravalenten Impfstoffes zu bevorzugen ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1801_Weblinks_s15_tab.jpg" alt="" width="2151" height="1042" /></p> <h2>Pertussis</h2> <p>Österreichweit werden steigende Fallzahlen von Keuchhusten registriert. Die Impfung ist für alle Personen empfohlen. Nach der Grundimmunisierung bei Säuglingen/ Kleinkindern und einer Auffrischungsimpfung bei Schulkindern sind Auffrischungsimpfungen alle 10 Jahre bzw. ab dem vollendeten 60. Lebensjahr alle 5 Jahre empfohlen. Dabei sollten Kombinationsimpfstoffe verwendet werden, die auch gegen Diphtherie, Tetanus und Polio schützen. Hinsichtlich Pertussis muss erneut auf die Wichtigkeit der Impfung von Schwangeren hingewiesen werden: Liegt die letzte Pertussisimpfung gerechnet vom Geburtstermin länger als 2 Jahre zurück, so soll ab dem 2. Trimenon, bevorzugt jedoch im 3. Trimenon, eine Pertussisimpfung erfolgen. Die Impfung ist nicht nur für den Schutz der Mutter, sondern insbesondere für den Schutz des Kindes vor Pertussis in den ersten 6 Lebensmonaten wichtig.</p> <h2>Allgemeine Anmerkungen und Neuerungen</h2> <p>Im allgemeinen Teil des Impfplans wurden mehrere Kapitel ergänzt und neu eingeführt.<br /> Im Kapitel zum Thema „off-label use“ wird erläutert, dass die Anwendung von Impfstoffen außerhalb der Indikation nicht verboten ist, solange sie evidenzbasiert erfolgt. Dabei sind erhöhte Sorgfaltspflicht und besondere Aufklärungspflicht gegeben. Off-Label-Anwendungen können für eine bestmögliche, evidenzbasierte Behandlung notwendig sein, wenn eine Zulassung für eine bestimmte Indikation nicht gegeben ist.<br /><br /> Neu im Impfplan 2018 ist auch ein Kapitel, welches sich mit den Inhaltsstoffen von Impfstoffen beschäftigt: Formaldehyd beispielsweise wird in den Herstellungsprozessen mancher Impfstoffe verwendet. Hier gibt es einen genau geregelten Grenzwert von 0,2mg/ml. Wichtig ist zu wissen, dass Formaldehyd jedoch auch ein natürliches Stoffwechselprodukt ist, das ständig im menschlichen Körper vorkommt. Mit der Nahrung werden täglich bis zu 14mg aufgenommen, besonders viel Formaldehyd ist in Obst und Gemüse enthalten. Bei der Herstellung mancher Impfstoffe werden Kanamycin und Neomycin gegen potenzielle bakterielle Vermehrung verwendet, niemals jedoch Penicillin oder Sulfonamide.<br /> Präzisiert wurde das Kapitel „Vorgehen bei versäumten Teilimpfungen/Auffrischungen“: Nach nur einer Impfung einer Impfserie im Schema 2+1 oder 3+1 muss bei Überschreiten des empfohlenen Impfintervalls um mehr als ein Jahr die Grundimmunisierung neu begonnen werden. Nach zwei oder mehr Impfungen einer Impfserie kann jede Impfung zum ehestmöglichen Termin nachgeholt werden. Nach Grundimmunisierung mit einem inaktivierten Impfstoff laut Fachinformation kann zu jedem späteren Zeitpunkt aufgefrischt werden, die Grundimmunisierung muss nicht wiederholt werden. Ausnahmen stellen hier Impfungen gegen Diphtherie und Tetanus dar: Hier sollte bei einem Impfintervall von 20 Jahren oder mehr eine Auffrischungsimpfung erfolgen, danach ist eine serologische Impferfolgsüberprüfung empfohlen.<br /> Im kostenfreien Impfkonzept des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherungsträger werden seit dem 1. Februar 2018 folgende Impfstoffe verwendet: Rotateq, Hexyon, Synflorix, MMR-Vax Pro, Nimenrix, Repevax, HB-Vax pro 5µg und Gardasil 9.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag
Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal die Conference on HIV Drug Therapy, kurz HIV Glasgow, statt. Eines der Highlights der Konferenz war die Vorstellung der ...
Best of CROI 2025
Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...


