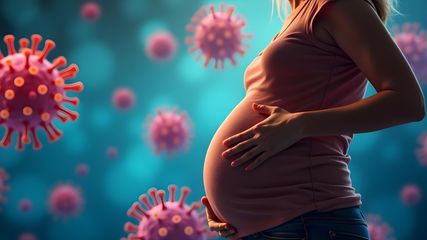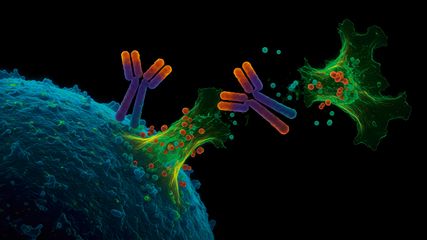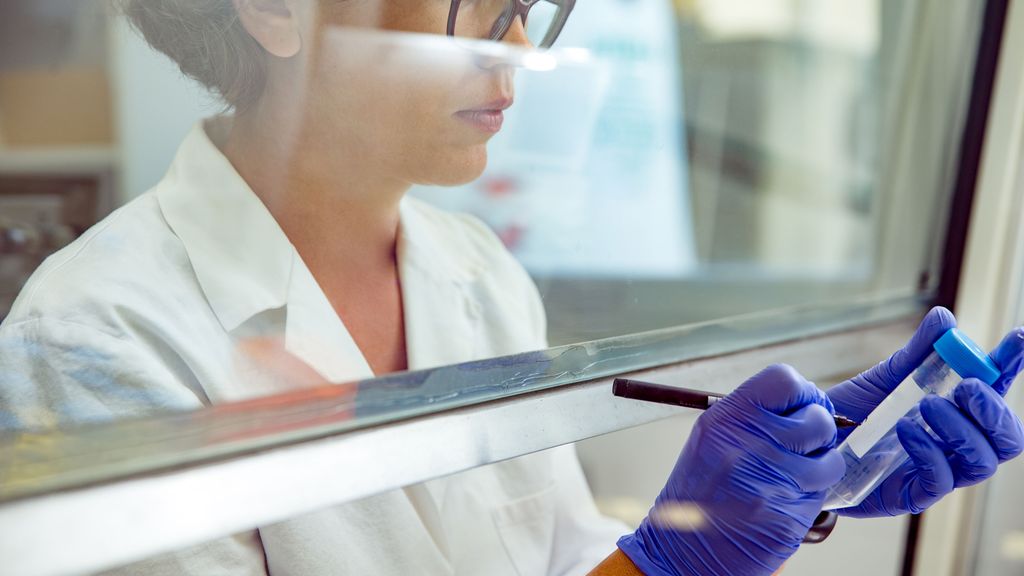
©
Getty Images
Geschichte der Antibiotika
Jatros
30
Min. Lesezeit
21.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Entwicklung von Antibiotika für die moderne Medizin begann eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg, doch erst nach 1945 setzten eine intensivere Forschung und Entwicklung ein. In den letzten Jahrzehnten wurden wiederum eher wenige neue Substanzen und Substanzklassen auf den Markt gebracht. Neue Therapieansätze gegen bakterielle Infektionen stehen aber vor der Tür.</p>
<hr />
<p class="article-quelle">Quelle: „Geschichte der Antibiotika“, Giftiger Dienstag mit Univ.-
Prof. Dr. Florian Thalhammer, 21. Februar 2017, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Ausreichend hohe Dosierungen schon von Fleming eingefordert</li> <li>Resistenzentwicklung ein stetes Problem</li> <li>Antibiotic Stewardship immer notwendig</li> <li>Neue Antibiotika mit sehr eingeschränktem Indikationsspektrum – „Off-label“-Problem</li> <li>Zukünftig neue Ansatzpunkte wie z.B. Antikörper</li> </ul> </div> <p>Die erste Antibiotikaanwendung fand wahrscheinlich schon 3000 vor unserer Zeitrechnung in China statt − es handelte sich um die Verabreichung verschimmelter Sojabohnen“, erläuterte Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Klinische Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin, MedUni Wien, bei einem „Giftigen Dienstag“. Die heilende Wirkung von Schimmelpilzen bei Geschwüren und Hautinfektionen wurde in der Folge in verschiedenen Regionen und Kulturen erkannt. Erwähnt wurde sie z.B. im alten Ägypten (2500 v. Chr.), im Talmud (100 n. Chr.) oder im „Lorscher Arzneibuch“ (800 n. Chr.).<br /> Die Verwendung von Schimmel als Heilmittel zieht sich durch die gesamte Geschichte der Medizin. Erste experimentelle Beweise zur antibakteriellen Wirkung von Pinselschimmel (Penicillium) wurden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesammelt.</p> <h2>Natur vs. Chemie</h2> <p>Dass auch bei modernen Antibiotika die Abstammung vieler Substanzen aus dem Reich der Pilze nicht zu leugnen ist, zeigt Tabelle 1. Selbst das Antimykotikum Amphotericin B wird von einem Pilz erzeugt. Nun lassen sich drei Ansätze unterscheiden: die Verwendung der unter kontrollierten biosynthetischen Bedingungen hergestellten, im Prinzip unveränderten Substanzen (z.B. Penicillin, Bacitracin oder Polymyxin), die halbsynthetische Herstellung (d.h. Substitution einer biosynthetischen Grundstruktur, wie etwa des Betalaktamrings, was verschiedene Penicilline oder Cephalosporine ergibt) oder die vollsynthetische Herstellung einer antimikrobiellen Substanz (z.B. Sulfonamide oder Chinolone).</p> <h2>Substanzklassen und ihre Entwicklung</h2> <p>Derzeit existieren zwölf Substanzklassen von Antibiotika, von denen fünf (Sulfonamide, Tetrazykline, Makrolide, Oxazolidinone und Chloramphenicol) bakteriostatisch und sieben (Betalaktame, Aminoglykoside, Glykopeptide, Ansamycine, Streptogramine, Chinolone und Lipopeptide) bakterizid wirken. Einige davon (Chloramphenicol, Sulfonamide) werden kaum noch oder gar nicht mehr eingesetzt.<br /> Auf der Zeitachse betrachtet, waren die Betalaktame die erste, die Lipopeptide die bisher letzte eingeführte Substanzklasse. In den letzten Jahrzehnten sind so gut wie keine neuen Substanzklassen dazugekommen. „Wir leiden hier an einer Entwicklungslücke“, mahnte Thalhammer. „Es sind einige neue Substanzen und Substanzklassen in der Pipeline, aber man wird erst sehen müssen, was davon wirklich auf den Markt kommt.“<br /> Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Arsenverbindung <em>Salvarsan</em> von Paul Ehrlich synthetisiert − im Jahr 1910 waren schon mehr als 10 000 Syphiliskranke damit behandelt worden.<br /> „Immerhin galten Salvarsan und Neosalvarsan bis 1940 als Therapiestandard und waren damit das erste moderne Chemotherapeutikum“, ergänzte der Infektiologe.<br /> Auch <em>Sulfonamide</em> wurden bereits vor 1910 synthetisiert − allerdings zunächst für die Tuchfärbung. Ihre antimikrobielle Wirkung wurde erst in den Dreißigerjahren erkannt − wofür der Entdecker, Gerhard Domagk, den Nobelpreis erhielt. Sulfonamide werden (in der Regel in Kombination mit Trimethoprim) in einzelnen Indikationen heute noch verwendet.<br /> Die Entdeckung von <em>Penicillin</em> durch Alexander Fleming erfolgte 1928 eher zufällig. Erst ein Jahrzehnt später gelang es, chemisch stabile Penicillinsalze herzustellen. Die erste Behandlung eines Patienten (mit einer S.-aureus-Infektion) mit Penicillin erfolgte 1941. Schon 1942 wurden erste penicillinresistente Stämme von <em>Staphylococcus</em> aureus beschrieben. Erst 1952 konnte − in Österreich − erstmals erfolgreich ein orales Penicillin hergestellt werden, das noch heute wie damals „Ospen<sup>®</sup>“ heißt.<br /> Karl Hermann Spitzy führte in Wien im Jahr 1962 die hoch dosierte Penicillintherapie ein. Die Möglichkeit, ab 1941 Wundund andere Infektionen mit Penicillin zu therapieren − bis zum Kriegsende nur auf alliierter Seite −, dürfte den Ausgang des Zweiten Weltkrieges mitbeeinflusst haben. Heute steht innerhalb der Penicilline eine Reihe von unterschiedlich substituierten Subgruppen zur Verfügung.<br /> 1943 wurde das <em>Aminoglykosid</em> Streptomycin aus <em>Streptomyces griseus</em> isoliert − es wird bis heute als Reservemittel bei Tuberkulose eingesetzt. Neuere Aminoglykoside sind bis heute (als Teil von Kombinationstherapien) in manchen Indikationen im Einsatz.<br /> Als erster Vertreter der <em>Makrolide</em> wurde Erythromycin aus Bodenproben isoliert und ab 1952 vermarktet. Erst 1981 gelang die Totalsynthese von Erythromycin.<br /> <em>Cephalosporin C</em> wurde 1945 entdeckt, seine chemische Struktur aber erst 1954 entschlüsselt. Und noch ein Jahrzehnt später, 1964, wurde Cephaloridin als erster Vertreter der Cephalosporin-Antibiotika (definitionsgemäß ein Cephalosporin der ersten Generation) eingeführt.<br /> Inzwischen sind fünf Cephalosporin- Generationen auf dem Markt, wobei die Substanzen der fünften Generation auch gegen <em>S. aureus</em> wirken.<br /> In der Folge wurden weitere wichtige Substanzklassen wie <em>Chinolone, Carbapeneme, Oxazolidinone</em> und <em>Lipopeptide</em> eingeführt.<br /> „Ein Problem, das wir mit den Zulassungen neuer Substanzen haben, besteht in der oft sehr eingeschränkten Indikation − z.B. nur für Haut- und Weichteilinfektionen“, kritisierte Thalhammer.<br /> Auch in der Infektiologie gibt es neue Ansätze, wie z.B. die Entwicklung monoklonaler Antikörper gegen Bakterientoxine oder auch den Einsatz von Phagen (eigentlich ein alter, in Vergessenheit geratener Ansatz).<br /> „Abschließend sei noch auf großartige Erfolge in der antiviralen Therapie verwiesen, nämlich die Entwicklung einer Vielzahl sehr wirksamer Medikamente gegen Hepatitis C und HIV“, schloss Thalhammer.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Infekt_1704_Weblinks_jatros_infekt_1704_s10_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="688" /></p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...
Globale Statistik zu HIV/Aids: Ein Ende der Epidemie ist nicht in Sicht
Im Juli 2025 wurde von UNAIDS die globale HIV/Aids-Statistik für das Vorjahr veröffentlicht. Die Daten zeigen den grossen Handlungsbedarf auf und veranschaulichen Versäumnisse, die in ...