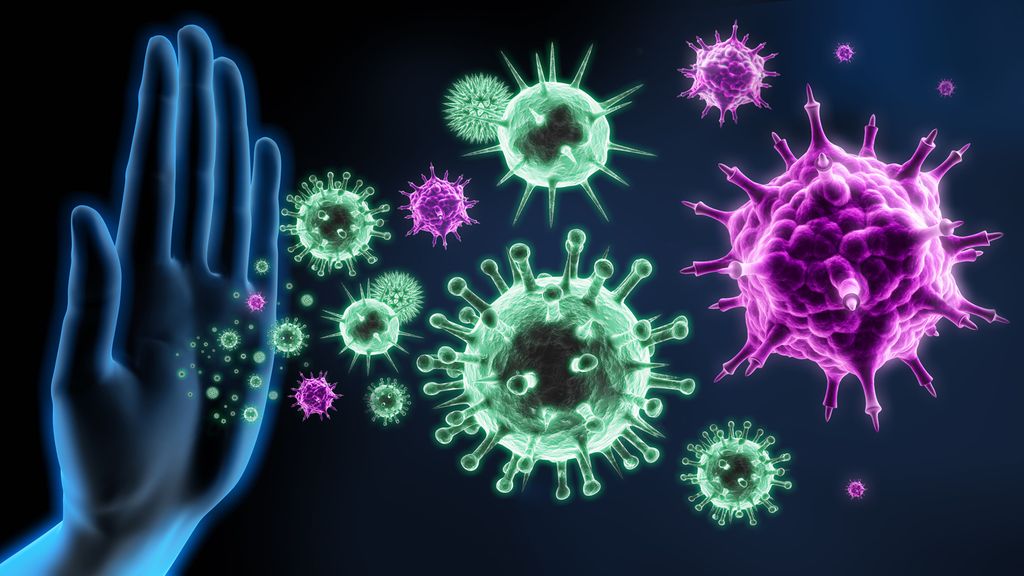
©
Getty Images/iStockphoto
Die Dosis macht das Gift – oder doch nicht?
Leading Opinions
Autor:
Dr. med. Stephanie Hametner
Oberärztin<br> Gastroenterologie & Hepatologie<br> Ordensklinikum Linz Elisabethinen<br> E-Mail: stephanie.hametner@ordensklinikum.at
30
Min. Lesezeit
20.12.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Eine medikamentös-toxische Hepatitis kann durch viele im medizinischen Alltag häufig eingesetzte Medikamente verursacht werden. Die Diagnose eines «drug-induced liver injury» (DILI) ist aufgrund des unterschiedlichen Erscheinungsbilds und der fehlenden standardisierten Tests oft schwierig zu stellen, die therapeutischen Optionen sind limitiert. Somit ist der Vermeidung eines DILI durch behutsame Medikamenteneinnahme oberste Priorität beizumessen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Viele Medikamente, vor allem Antibiotika, aber auch Nahrungsergänzungsmittel können ein DILI auslösen. Nähere Infos zur medikamentösen Toxizität finden Sie unter: www.livertox.nih.gov</li> <li>Die Diagnose eines DILI wird nach genauer Anamnese und Ausschluss anderer Lebererkrankungen gestellt.</li> <li>Die therapeutischen Möglichkeiten des DILI sind limitiert. Durch sorgsamen Umgang mit Medikamenten und deren Indikationsstellung kann die Entstehung einer DILI zum Teil vermieden werden.</li> </ul> </div> <p>In der westlichen Welt ist die medikamentös- toxische Hepatitis für ca. 30 % der akuten Hepatitisfälle verantwortlich und somit der häufigste Grund für ein akutes Leberversagen. Die Inzidenz des DILI liegt bei 14–19/100 000.</p> <h2>Pathophysiologie und Einteilung</h2> <p>Die Leber ist Hauptorgan für den Metabolismus körpereigener und körperfremder Stoffe. Verabreichte Medikamente oder ihre Komponenten gelangen über den enterohepatischen Kreislauf in die Leber und werden dort in mehreren Metabolisierungsschritten (Phase I–III) verändert. Katalysiert werden diese metabolischen Umbauprozesse durch die Cytochromkaskade. Durch chemische Prozesse auf zellulärer Ebene (Oxidation, Hydrolyse, Konjugation mit Glukuronaten/Sulfaten/Acetaten) werden die Wasserlöslichkeit und damit die Transportfähigkeit gesteigert und inaktive Metaboliten in aktive umgewandelt. Im Rahmen dieser chemischen Prozesse entstehen oft toxische Metaboliten, welche direkt oder indirekt hepatotoxisch wirken können. Im Wesentlichen werden zwei Arten von DILI unterschieden: ein intrinsisches und ein idiosynkratisches DILI.</p> <ul> <li>Bei dem intrinsischen DILI gilt die Regel: Die Dosis macht das Gift! Dabei kommt es zu einer dosisabhängigen Leberschädigung, die bei allen Menschen und Säugetieren ähnlich verläuft. Die Toxizität ist somit vorhersehbar und reproduzierbar. Durch die oben beschriebenen Metabolisierungsschritte entstehen toxische Metaboliten/freie Radikale, die die Leberzelle direkt schädigen oder über kovalente Bindung Zellorganellen in ihrer Funktion hemmen und somit zum Zelltod führen. Die Latenzzeit ist kurz (wenige Stunden bis Tage), es kommt zu einem deutlichen Transaminasenanstieg. Beispiele hierfür sind Acetaminophen, Alkohol und i.v. verabreichte Tetrazykline.</li> <li>Das idiosynkratische DILI ist die weitaus häufigere Form einer medikamentöstoxischen Leberschädigung. Hierbei besteht keine klare Dosisabhängigkeit zwischen Noxe und Leberschädigung. Ausmass und Muster der Leberschädigung sind individuell unterschiedlich und somit nicht reproduzierbar. Die Latenzzeit von der Exposition bis zum Auftreten eines DILI ist variabel und beträgt meist ein bis drei Monate. Bei dieser Art der Leberschädigung werden zwei Untergruppen voneinander unterschieden:<br /> <ul> <li>Bei dem nicht immunologischen idiosynkratischen DILI vermutet man genetisch determinierte Veränderungen des hepatischen Metabolismus (z.B. in der Cytochromkaskade), was zu einer Anhäufung reaktiver Metaboliten führt. Diese wiederum führen zu einer direkten Leberzellschädigung. Beispiele hierfür sind: Amiodaron, Diclofenac, Isoniazid.</li> <li>Die Pathogenese des immunmediierten idiosynkratischen DILI gleicht einer Hypersensitivitätsreaktion: Es entsteht eine kovalente Bindung zwischen dem reaktiven Metaboliten der Noxe/des Medikaments mit einem körpereigenen Protein (= Haptenisierung). Dieses Hapten fungiert als Neoantigen und stimuliert so das angeborene Immunsystem. Durch Stimulation von T-Zellen, B-Zellen und natürlichen Killerzellen wird Apoptose induziert. Beispiele hierfür sind: Amoxicillin/Clavulansäure, Fluorchinolone, Antikonvulsiva und Allopurinol.</li> </ul> </li> </ul> <p>Die Entstehung eines DILI ist meist multifaktoriell bedingt. Die Immunogenität des auslösenden Agens ist sicherlich hauptverantwortlich für die schädigende Wirkung. Die Immunantwort und Immuntoleranz des Organismus spielen aber ebenfalls eine wesentliche Rolle. Weitere Risikofaktoren, die die Entstehung eines DILI begünstigen, sind in Tabelle 1 aufgelistet. In Tabelle 2 sind die Top-10-Medikamente und -gruppen aufgelistet, die ein DILI verursachen können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1806_Weblinks_s73_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="1142" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1806_Weblinks_s73_tab2.jpg" alt="" width="1418" height="1080" /></p> <h2>Klinisches Bild</h2> <p>Klinisch präsentieren sich die Patienten meist asymptomatisch. Bei schweren Verlaufsformen wird über Oberbauchschmerzen, Inappetenz, Übelkeit, Erbrechen, Fatigue, Ikterus, Pruritus, acholische Stühle, Dunkelfärbung des Harns und Fieber berichtet. Bei immunmediierten Reaktionen zeigen sich oft extrahepatische Manifestationen im Sinne von Hautausschlag, Gesichtsödem, Lymphadenopathie, Myalgien und Arthralgien. Ein akutes Leberversagen mit Koagulopathie und Enzephalopathie tritt nur äusserst selten auf.<br /> Laborchemisch werden drei Formen von DILI beschrieben. Man beurteilt die Höhe der Transaminasen (GOT = AST und GPT = ALT), die Auslenkung der Cholestaseparameter (alkalische Phosphatase = Alk P, Gamma-GT, Bilirubin) und berechnet die R-Ratio = (ALT/ALT ULN) ÷ (Alk P/Alk P ULN); (ULN = «upper limit of normal»).</p> <ul> <li>Hepatozellulär/hepatitisch ist die häufigste Form. Es zeigt sich eine führende Transaminasenerhöhung, die R-Ratio beträgt >5 und die Cholestasewerte sind meist nicht oder nur geringgradig ausgelenkt.</li> <li>Cholestatisch: Hierbei kommt es zu einem merklichen Anstieg der alkalischen Phosphatase, der Gamma-GTWerte und des Bilirubins. Die Transaminasen sind normal bzw.</li> <li>Gemischt hepatitisch und cholestatisch: Bei dieser Form sind die Transaminasen >3xULN, die Cholestaseparameter >2xULN und die R-Ratio zwischen 2 und 5.</li> </ul> <h2>Diagnose</h2> <p>Die Diagnosefindung kann oft herausfordernd sein, da ein DILI beinahe jede Lebererkrankung imitieren kann. Ein DILI kann das klinische Erscheinungsbild einer Virushepatitis, einer Autoimmunhepatitis, einer langjährig bestehenden Zirrhose, einer akuten Fettlebererkrankung und einer Gallengangsobstruktion annehmen. Folgende sechs Eigenschaften helfen bei der Diagnosefindung und sind in der Berechnung des «Roussel Uclaf Causality Assessment Method»(RUCAM)-Scores beinhaltet.</p> <ul> <li>Latenzzeit (ab der ersten Medikamenteneinnahme): 5 Tage bis 3 Monate, auch Jahre möglich</li> <li>Zeit bis zur Genesung: Besserung meist nach 1–2 Wochen, Genesung nach 2–3 Monaten</li> <li>Klinisches Verhalten: hepatitisch, cholestatisch, gemischter Typ</li> <li>Ausschluss anderer Hepatopathien: Virushepatitis, Autoimmunhepatitis, primär biliäre Cholangitis (PBC), primär sklerosierende Cholangitis (PSC), nicht alkoholische und alkoholische Steatohepatitis (NASH bzw. ASH), vaskuläre Pathologien, biliäre Abflusshindernisse</li> <li>Medikament als Hepatotoxin bekannt: LiverTox (www.livertox.nih.gov)</li> <li>Verlauf nach Reexposition: nicht empfehlenswert</li> </ul> <h2>Therapie und Prognose</h2> <p>Das Absetzen der vermuteten auslösenden Noxe ist bei jedem Verdacht auf DILI angezeigt. Bei einzelnen Intoxikationen können medikamentöse Therapieansätze gestartet werden: Verabreichung von L-Carnitin bei Valproinsäurevergiftung oder N-Acetyl-Cystein bei Acetaminophenintoxikation, was den Abbau reaktiver Metaboliten beschleunigt. Klare Empfehlungen für den Einsatz von Glukokortikoiden als Therapie des DILI gibt es nicht. Bei immunmediiertem idiosynkratischem DILI oder bestehenden extrahepatischen Manifestationen können Glukokortikoide (z.B. Prednisolon 30mg/d) zur Besserung beitragen. Bei cholestatischem DILI kann der Zusatz von Ursodeoxycholsäure (15mg/kg Körpergewicht) zur Therapie zu einer rascheren Normalisierung der Laborwerte beitragen. Bei zusätzlich bestehender Pruritussymptomatik sollte eine symptomatische Therapie mit Cholestyramin, Phenobarbital, Rifampicin und Naltrexon bis hin zur Plasmapherese bei intraktablem Pruritus begonnen werden. Beim seltenen Verlauf eines akuten Leberversagens muss an eine Lebertransplantation gedacht werden.</p> <p>Prognostisch verläuft ein DILI in den meisten Fällen gutartig und die klinischen und laborchemischen Veränderungen bilden sich komplett zurück. Bei ca. 5–10 % stellt sich ein chronischer Verlauf ein, wobei eine chronische Leberschädigung bis hin zur Entstehung einer Leberzirrhose möglich ist. Ein cholestatisches DILI hat hinsichtlich kompletter Restitutio eine bessere Prognose als ein hepatitisches DILI; wobei Patienten mit hepatitischem DILI und Bilirubinerhöhung (Bilirubin >2xULN) ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung eines akuten Leberversagens haben («Hy’s law»).</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>• Chalasani N et al.: Gastroenterology 2015; 148: 1340-52 • Iorga A et al.: Int. J. Mol. Sci. 2017; 18: pii E1018 • Kullak- Ublick GA et al.: Gut 2017; 66: 1154-64 • Weiterführende Literatur bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag
Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal die Conference on HIV Drug Therapy, kurz HIV Glasgow, statt. Eines der Highlights der Konferenz war die Vorstellung der ...
Best of CROI 2025
Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...


