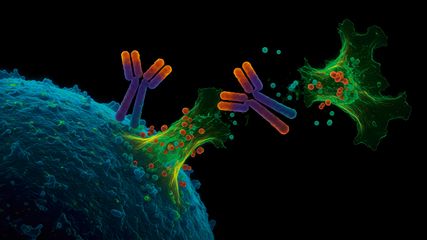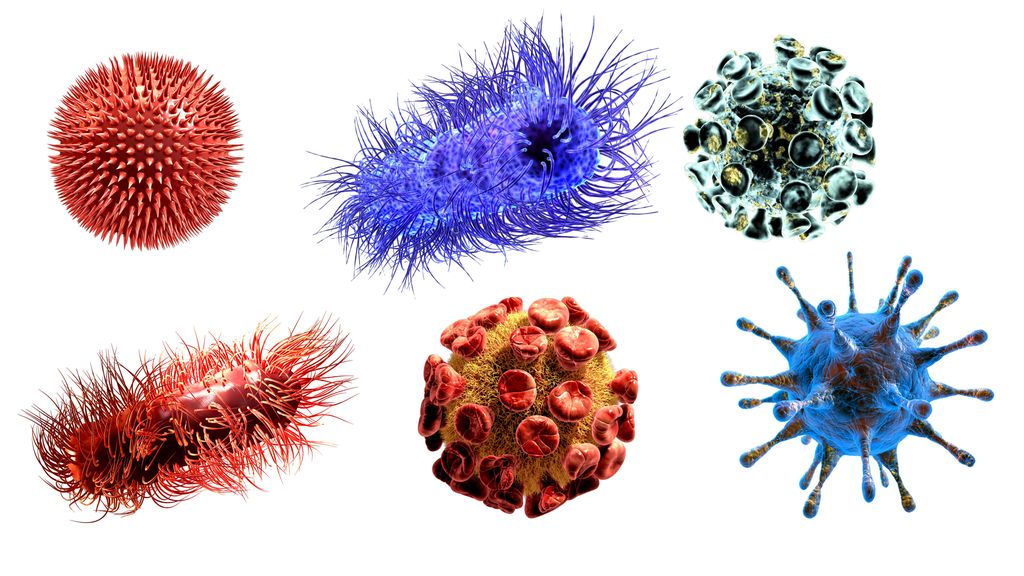
©
Getty Images/iStockphoto
Das familiäre Mittelmeerfieber
Jatros
30
Min. Lesezeit
05.04.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In manchen Populationen, wie in denen der Anrainerstaaten des Mittelmeeres, ist das familiäre Mittelmeerfieber eine relativ häufige Erkrankung. Die Diagnose erfolgt hauptsächlich aufgrund von Klinik und Anamnese. Gentests können, müssen aber nicht hilfreich sein. Therapie der Wahl ist Colchicin. Wird dieses nicht vertragen, so kommen vor allem Interleukin-1-Blocker infrage.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Das familiäre Mittelmeerfieber (FMF) ist eine genetisch determinierte, durch rezidivierende Fieberattacken und Serosa- Entzündungen charakterisierte Erkrankung.</p> <h2>Epidemiologie</h2> <p>Die höchsten FMF-Prävalenzen treten – wie der Name der Erkrankung schon sagt – in Bevölkerungsgruppen auf, die ursprünglich aus Anrainerstaaten des Mittelmeeres stammen, d.h. bei Türken, Armeniern, Nordafrikanern sowie Menschen jüdischer oder arabischer Abstammung. In diesen Gruppen beträgt die Carrier-Rate ca. 1:7, die Erkrankungsrate ca. 1:500. In der jüdischen Bevölkerung Israels werden je nach Herkunft Unterschiede in den Carrier-Raten beobachtet. Diese betragen bei Juden aschkenasischer Herkunft 1:8, bei Juden nordafrikanischer Herkunft 1:6 und bei Juden irakischer Herkunft 1:4.<br /> Das FMF kommt jedoch, allerdings in niedrigerer Prävalenz, auch in vielen anderen Populationen vor, z.B. in Griechenland, Italien, den USA und sogar in Japan. Ein Teil dieser Prävalenz ist allerdings wiederum durch Einwanderer aus den genannten Regionen zu erklären. So stammen die meisten FMF-Betroffenen in Deutschland und auch Österreich aus der Türkei, während sie in Frankreich eher zur aus Nordafrika stammenden Population zählen.<br /> In Mittelmeerländern, wie z.B. Italien, oder auch am Balkan gibt es bezüglich des FMF ein Süd-Nord-Gefälle.</p> <h2>Genetik</h2> <p>Die genetische Basis des FMF ist zumeist, aber nicht immer eine Mutation des MEFV-Gens, das am kurzen Arm des Chromosoms 16 liegt. Derzeit werden die Mutationen E148Q im Exon 2 sowie M680I, M694I, M694V und V726A im Exon 10 als die fünf Hauptmutationen (oder Gründer-Mutationen) angesehen. Der Erbgang ist zumeist autosomal-rezessiv, d.h., es müssen beide MEFV-Allele verändert sein. Personen mit nur einer MEFV-Mutation sind in 95 % der Fälle asymptomatisch. In seltenen Fällen können sie aber auch erkranken, weshalb man vermutet, dass es zusätzliche Manifestationsfaktoren für das FMF gibt. Studien haben gezeigt, dass das Vorhandensein eines mutierten MEFV-Allels das Risiko für die Manifestation eines FMF um den Faktor 6 bis 8 erhöht.<br /> Auch bei homozygoten Personen hängt der Schweregrad der Erkrankung davon ab, welche Mutation vorliegt.<br /> So zeigen Personen, die bezüglich der M694V-Mutation homozygot sind, ein besonders schweres Krankheitsbild. Diese genetische Konstellation kommt häufig bei aus Nordafrika stammenden Juden vor. Diese Patienten benötigen höhere Colchicin- Dosen, um Anfälle zu verhindern bzw. hatten – vor der Einführung von Colchicin als Therapeutikum – eine höhere Amyloidose- Rate.</p> <h2>Pathogenese</h2> <p>Das MEFV-Gen kodiert Pyrin, ein Protein aus 781 Aminosäuren, das vor allem im Zytoplasma von Zellen der myeloischen Reihe sowie synovialen Fibroblasten und dendritischen Zellen exprimiert wird. Pyrin spielt eine wichtige Rolle im angeborenen Immunsystem, indem es an der Aktivierung des sogenannten Inflammasoms,<br /> eines zytosolischen Proteinkomplexes in Makrophagen und neutrophilen Granulozyten, beteiligt ist. Zu dieser Aktivierung kommt es normalerweise infolge einer Infektion, z.B. mit Clostridium difficile, wobei Pyrin hier eine Art Sensorfunktion für die Aktivität bakterieller Toxine ausübt. Wird eine solche Toxinaktivität detektiert, so aktiviert Pyrin das Inflammasom. Die für das FMF verantwortlichen MEFV-Mutationen scheinen dazu zu führen, dass die veränderten Pyrin-Moleküle auch ohne infektiösen Stimulus das Inflammasom aktivieren können. Dies bedeutet, dass Entzündungsmediatioren wie Interleukin 1 (IL-1) oder 18 (IL-18) vermehrt gebildet werden, was wiederum zu einer Anlockung von neutrophilen Granulozyten führt und eine FMF-Attacke auslöst. Man spricht hier von einer „gain of function mutation“.<br /> Ein ähnlicher Mechanismus liegt auch anderen Erkrankungen, wie z.B. den Cryopyrin- assoziierten periodischen Syndromen (CAPS) oder dem „familial cold autoinflammatory syndrome“ (FCAS), zugrunde.</p> <h2>Klinik</h2> <p>Die beiden wesentlichen Symptome sind einerseits sporadische, aber meist rezidivierende Fieberanfälle (meist 38– 40°C), andererseits Serosa-Entzündungen, die sich je nach Lokalisation der Serositis (häufiger) als Bauch- oder (seltener) als Brustschmerzen äußern.<br /> Die Erstmanifestation erfolgt meist schon im Kindesalter; 65–90 % der Fälle manifestieren sich vor dem 20. Lebensjahr. Nur in seltenen Fällen erfolgt eine Erstmanifestation jenseits der 50.<br /> Die Anfälle dauern meist einen bis drei Tage, dazwischen sind die Patienten symptomfrei.<br /> Der Zeitraum, in dem die Anfälle auftreten, ist – selbst intraindividuell – äußerst variabel; es können Wochen, Monate oder auch Jahre sein.<br /> Auch ein konstanter Auslöser ist selten festzumachen. Allerdings sind starke körperliche Anstrengung, Kälteexposition, emotionaler Stress, Müdigkeit, chirurgische Eingriffe sowie Menstruation als Auslöser genannt worden.<br /> Der Verlauf eines FMF während der Schwangerschaft ist uneinheitlich: Etwa in einem Drittel der Fälle kommt es zu einer Besserung, in einem Drittel zu einer Verschlechterung und in einem Drittel zu keiner Veränderung.<br /> Weitere Symptome können Gelenksschmerzen, erysipeloide Hautveränderungen und selten auch Myalgien, Perikarditiden, Kopfschmerzen und aseptische Meningitiden sein.</p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Die Diagnose FMF sollte bei Personen mit rezidivierenden Fieberattacken, die von Peritonitis, Pleuritis, Synovitis oder rezidivierenden Erysipel-artigen Hauterscheinungen begleitet werden, vermutet werden.<br /> Die Diagnose FMF beruht letztlich auf einer Kombination der Anamnese (frühere klinische Symptome, ethnische Herkunft, Familienanamnese) mit der aktuellen Symptomatik.<br /> Selbst ein Gentest ergibt nicht immer konklusive Resultate – manchmal kann die Diagnose erst ex juvantibus, d.h. nach einigen Monaten Probetherapie, erfolgen. Tabelle 1 zeigt Diagnosekriterien und ihre Anwendung.<br /> Mögliche längerfristige Komplikationen des FMF sind sekundäre Amyloidose, Obstruktion des Dünndarms und Infertilität. Am häufigsten von der Amyloidablagerung betroffen ist die Niere, aber auch Milz, Leber, Gastrointestinaltrakt und später Herz, Schilddrüse und Hoden können betroffen sein.<br /> Die renale Amyloidose kann auch das erste und einzige Symptom eines FMF sein – in diesem Fall besteht eine asymptomatische Proteinurie.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1801_Weblinks_s9_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="1855" /></p> <h2>Therapie</h2> <p>Das Ziel der Therapie eines FMF ist die Verhinderung von Anfällen und die weitestmögliche Reduktion der subklinischen Entzündung im Intervall, weiters die Verhinderung der Entstehung bzw. Progression einer Amyloidose.<br /> Die Therapie der ersten Wahl, die allen FMF-Patienten empfohlen wird, ist Colchicin per os. Da die hoch dosierte Gabe von Colchicin nur während eines FMF-Anfalls nicht vor der subklinischen Entzündung und der daraus oft resultierenden Amyloidose schützt, ist eine Dauertherapie notwendig. Diese wird nach Alter und Körpergewicht dosiert.<br /> Die Adhärenz ist höher, wenn die Tagesdosis auf einmal und nicht in zwei Teildosen verabreicht wird.<br /> Ca. 5 bis 10 % der FMF-Patienten sprechen nicht auf Colchicin an, und 2 bis 5 % vertragen es nicht (meist wegen gastrointestinaler Nebenwirkungen). In diesem Fall kommt als Second-Line-Therapie eine IL-1-Blockade infrage. Neben dem IL- 1-Blocker Anakinra kommen auch der IL- 1-Betablocker Canakinumab sowie theoretisch Rilonacept (das jedoch nicht auf dem Markt ist) infrage. Eine Zulassung für die Therapie von FMF besitzt nur Canakinumab, das allerdings wesentlich teurer ist als Anakinra.<br /> Andere Substanzen, für die ein Ansprechen von FMF-Patienten berichtet wurde, sind Thalidomid, Etanercept, Adalimumab, Infliximab und Tocilizumab. Zu all diesen Substanzen fehlen jedoch kontrollierte Studien.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Giftiger Dienstag Spezial, „Fieber unbekannter Ursache“,
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Clemens Scheinecker, Universitätsklinik
für Innere Medizin III, MedUni Wien: „Familiäres
Mittelmeerfieber und seine Bedeutung in Österreich“,
19. Dezember. 2017, Gesellschaft der Ärzte, Wien
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...