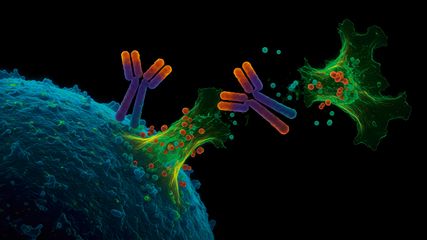CRAB und was man dagegen tun kann
Jatros
30
Min. Lesezeit
12.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">„CRAB“ steht für „Carbapenem-resistenten Acinetobacter baumannii“ – einen Erreger, der aufgrund seiner extrem hohen Resistenzraten von der WHO zu einem Pathogen erklärt wurde, dessen Bekämpfung höchste Dringlichkeit hat. Bisherige Therapieoptionen bergen meist Probleme bezüglich Toxizität und/oder niedriger Plasmaspiegel. Lesen Sie, wie man CRAB in naher Zukunft vielleicht behandeln wird.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Derzeit verfügbare Therapieoptionen gegen Carbapenemresistenten <em>Acinetobacter baumannii</em> (CRAB) umfassen Polymyxine, Tigecyclin, Minocyclin, Amikacin und Sulbactam.</li> <li>Als neue Therapieoptionen kommen u. a. Siderophore, neue Tetrazykline, neue Kombinationen von Betalaktamen und Betalaktamase-Inhibitoren, neue Betalaktam-Antibiotika und monoklonale Antikörper in Frage.</li> </ul> </div> <p>Der Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii, kurz CRAB, ist ein nosokomialer Erreger, der erhebliche Morbidität und Mortalität verursacht, wie es in einem rezenten Review heißt.<sup>1</sup> <em>A. baumannii</em> zeichnet sich durch große Widerstandskraft gegen Austrocknung, Desinfektionsmittel und eine breite Palette von Antibiotika aus. Dabei bedient sich der Erreger einer ganzen Reihe von Resistenzmechanismen. Ein beträchtlicher Anteil der Stämme von A. baumannii ist heute Carbapenem- resistent, was diese Stämme entweder „extensively drug-resistant“ (XDR) oder „pan-drug-resistant“ (PDR) macht. In manchen Regionen der Welt liegt die Rate der Carbapenem-Resistenz von A. baumannii bei über 90 %.<sup>2</sup><br /> Bei häufigen durch CRAB ausgelösten Infektionen, wie nosokomiale Pneumonie („hospital-acquired pneumonia“ – HAP) oder Sepsis, kann die Letalität 60 % erreichen – was signifikant höher ist als die Letalitätsraten bei Infektionen durch Carbapenem- empfindlichen A. baumannii.<sup>3, 4</sup></p> <h2>Derzeit verfügbare Therapieoptionen</h2> <p>Die aktuell verfügbaren Behandlungsoptionen für CRAB beschränken sich im Wesentlichen auf Polymyxine, Tetrazykline und Aminoglykoside.<br /> <strong>Polymyxine</strong> wurden in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts entdeckt und in den Achtzigerjahren im Wesentlichen verlassen, einerseits wegen ihrer hohen Toxizität und andererseits wegen der nunmehr vorhandenen Optionen wie Cephalosporine oder Carbapeneme. Aufgrund der dynamischen Resistenzentwicklungen im gramnegativen Bereich wurden jedoch Polymyxine, insbesondere Colistin, neuerlich eingesetzt. Polymyxine wirken in vitro sehr potent gegen<em> A. baumanni</em>i, es fehlen jedoch klinisch relevante Empfindlichkeits- Breakpoints, das therapeutische Spektrum ist sehr eng, und es besteht das Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen wie Neuro- und Nephrotoxizität.<sup>5</sup> Außerdem ist die optimale Dosierung schwierig, und es entstehen auch zunehmend Resistenzen von CRAB gegen Polymyxine.<br /> <strong>Tigecyclin</strong> wurde für die Behandlung multiresistenter Erreger entwickelt und wirkt in vitro auch gut gegen A. baumannii. Es wird seit 2006 gegen diesen Erreger eingesetzt.<sup>6</sup> Zwar ist die Substanz nur für komplizierte Infektionen des Abdomens, der Haut und Weichteile sowie für ambulant erworbene Pneumonie (CAP) zugelassen; sie wird jedoch auch gegen viele andere durch CRAB hervorgerufene Infektionen eingesetzt.<sup>7</sup> Aber Tigecyclin verursacht pharmakokinetische Probleme, wie etwa niedrige Plasmaspiegel, was seinen Einsatz bei Sepsis limitiert. Zudem gibt es eine Studie, die zeigte, dass Tigecyclin bei Beatmungs-assoziierter Pneumonie (VAP) einem Vergleichsregime aus Imipenem und Cilastatin unterlegen war.<sup>8</sup> Ein systematischer Review ergab, dass Tigecyclin in manchen Patientengruppen zu höherer Mortalität und niedrigeren Eradikationsraten führte als die Vergleichssubstanzen und dass CRAB zunehmend auch resistent gegen Tigecyclin wird.<sup>9</sup><br /> <strong>Minocyclin</strong> ist derzeit das einzige Antibiotikum gegen CRAB, das oral verabreicht werden kann. In einem Review wurden Minocyclin hohe Empfindlichkeitsraten und ein guter klinischer und mikrobiologischer Erfolg bescheinigt.<sup>10</sup> Allerdings beruhen diese Aussagen auf kleinen Patientenzahlen. 2015 ist eine intravenöse Formulierung auf den Markt gekommen. Die Verwendung von Minocyclin als Anti-CRAB-Substanz bedarf weiterer Evaluierung.<br /> <strong>Amikacin</strong> ist in vitro gegen manche CRAB-Stämme wirksam. Seine Nephrotoxizität und die hohen Resistenzraten limitieren jedoch seine Verwendung stark.<sup>2</sup><br /> <strong>Sulbactam</strong> ist ein BetalaktamaseInhibitor, der eine intrinsische Aktivität gegen A. baumannii hat. Deshalb wurde es als Anti-CRAB-Substanz vorgeschlagen.<sup>11</sup> In kleineren Studien wurde in höheren Dosen eine Wirksamkeit gegen CRAB erzielt, aber auch hier limitieren hohe Resistenzraten die Wirksamkeit.<sup>12, 13</sup><br /> Verschiedene Kombinationen der genannten Antibiotika wurden versucht, doch obwohl sie in manchen Fällen die mikrobiologischen Eradikationsraten verbesserten, zeigten sie keinen Vorteil bezüglich der klinischen Ergebnisse und der Verhinderung von Resistenzbildung.<br /> Von den Betalaktam-Betalaktamase- Kombinationen wie Ceftazidim/Avibactam, Ceftolozan/Tazobactam, Meropenem/ Vaborbactam sowie Imipenem/Relebactam weist keine eine klinisch sinnvolle Wirksamkeit gegen CRAB auf. Auch das neue Aminoglykosid Plazomicin wirkt nur gegen eine Minderheit der CRAB-Stämme.</p> <h2>Neue therapeutische Möglichkeiten</h2> <p><strong>Siderophore</strong> <br />Siderophore sind stark eisenbindende Oligopeptide, die über aktive Transportmechanismen in die Bakterienzelle eingeschleust werden. Die Verbindung eines Siderophors mit einem Antibiotikum ermöglicht hohe intrabakterielle Konzentrationen der antimikrobiellen Substanz.<br /> Hier ist vor allem Cefiderocol zu nennen, das aus einem neuen Cephalosporin in Kombination mit einem Catechol-Siderophor besteht und bereits zur Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde eingereicht wurde. In vitro ist Cefiderocol wirksam gegen die meisten CRAB-Stämme, die Carbapenemasen wie OXA-23, OXA-40, OXA-58, NDM oder IMP produzieren. Klinische Studien zu CRAB laufen. Weitere Siderophore sind in Entwicklung.</p> <p><strong>Tetrazykline</strong> <br />Eravacyclin ist ein neues Tetrazyklin, das um den Faktor 2 bis 8 niedrigere minimale Hemmkonzentrationen (MHK) als Tigecyclin aufweist.<sup>13</sup> Die bisherigen Phase-III-Studien mit diesem Medikament enthielten allerdings nur wenige CRAB-Stämme.<br /> Ein anderes neues Tetrazyklin, TP- 6076, zeigte sehr niedrige MHK gegen OXA-Carbapenemasen-produzierende CRAB-Stämme, darunter auch Colistin-resistente Stämme. Allerdings ist TP-6076 Substrat einer bestimmten Effluxpumpe. Derzeit ist die Substanz in Phase I.</p> <p><strong>Neue BL/BLI-Kombinationen</strong> <br />ETX-2514 ist ein Betalaktamase-Inhibitor (BLI) mit einer Diazabicyclooctan- Struktur, ähnlich wie Avibactam und Relebactam. Diese BLI zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen Betalaktamring enthalten. ETX-2514 deckt ein breites Spektrum von OXA-Carbapenemasen ab und wird in Kombination mit Sulbactam entwickelt. Diese Kombination erwies sich als wirksam gegen eine breite Palette von CRAB-Stämmen (von denen 91 % ein OXAEnzym aufwiesen) und wirkte auch gegen Colistin-resistente CRAB.<sup>14</sup> Die Substanz befindet sich in Phase II.<br /> Eine Reihe weiterer neuer BLI, die in Kombination mit zum Teil schon auf dem Markt befindlichen Antibiotika entwickelt werden, sind in klinischer Prüfung.</p> <p><strong>Neue Betalaktame<br /></strong> AIC-499 ist ein neues Betalaktam-Antibiotikum, das mit einem zurzeit noch nicht spezifizierten BLI zusammen entwickelt wird. Es soll Aktivität gegen multiresistente Stämme von <em>A. baumannii</em> und <em>Pseudomonas aeruginosa</em> haben und wird derzeit an der MedUni Wien in einer Phase-I-Studie untersucht.<br /> FSI-1671 gehört zu einer neuen Carbapenem- Klasse, die Aktivität gegen A. baumannii hat. Die Kombination FSI-1671/ Sulbactam war aktiv gegen 85 Isolate von <em>A. baumannii,</em> wobei die Anzahl der CRABStämme nicht angegeben war.<sup>15</sup></p> <p><strong>Phagen</strong> <br />Das Prinzip der Phagentherapie ist bereits hundert Jahre alt, aber bisher konnte sie sich im klinischen Alltag nicht durchsetzen, nicht zuletzt wegen einer Reihe unbeantworteter Fragen (z. B. Applikationsweg, Dosierungsintervalle). Die ersten Phagen gegen multiresistenten <em>A. baumannii</em> bzw. CRAB wurden erst 2010 bzw. 2013 charakterisiert.<br /> Bei Tieren wurden CRAB-Infektionen bereits erfolgreich mit Phagen behandelt. Daten zu menschlichen CRAB-Infektionen sind hingegen bisher nur sehr spärlich vorhanden. Eine Studie, in der Phagentherapie mit Antibiotika bei komplizierten Harnwegsinfektionen verglichen wurde, ist abgeschlossen, aber noch nicht publiziert.</p> <p><strong>Monoklonale Antikörper</strong><br /> Die Entwicklung monoklonaler Antikörper (mAB) zur antimikrobiellen Therapie ist aufgrund verschiedener Wirts- und Produkt-spezifischer Probleme schwierig. Vor Kurzem wurde ein mAB gegen XDR <em>A. baumannii</em>, C8, entwickelt, der, allein oder in Kombination mit Colistin, in vitro und in Mäusen gegen <em>A. baumannii</em> aktiv war und seine Aktivität auch nach Humanisierung behielt.<sup>16</sup> Ein weiterer, voll humaner mAB gegen <em>A. baumannii</em> ist in Entwicklung.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Isler B et al.: Antimicrob Agents Chemother 2019; 63: e01110-18 <strong>2</strong> World Health Organization: www.euro.who. int/__data/assets/pdf_file/0005/354434/WHO_CAESAR_ AnnualReport_2017.pdf. Zugriff am 25.7.2019 <strong>3</strong> Wong D et al.: Clin Microbiol Rev 2017; 30: 409-47 <strong>4</strong> Esterly JS et al.: Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: 4844-9 <strong>5</strong> Landman D et al.: Clin Microbiol Rev 2008; 21: 449-65<strong> 6</strong> Taccone FS et al.: Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006; 25: 257-60 <strong>7</strong> Curcio D: J Antimicrob Chemother 2009; 64: 1344-6 <strong>8</strong> Freire AT et al.: Diagn Microbiol Infect Dis 2010; 68: 140-51 <strong>9</strong> Ni W et al.: Int J Antimicrob Agents 2016; 47: 107-16 <strong>10</strong> Lashinsky JN et al.: Infect Dis Ther 2017; 6: 199-211 <strong>11</strong> Viehman JA et al.: Drugs 2014; 74: 1315-33 <strong>12</strong> Betrosian AP et al.: Scand J Infect Dis 2007; 39: 38-43 <strong>13</strong> Seifert H et al.: Int J Antimicrob Agents 2018; 51: 62-4 <strong>14</strong> Hackel M et al.: Poster 2243 präsentiert bei: ID Week, 26.–30. Oktober 2016, New Orleans/USA <strong>15</strong> Joo HY et al.: Abstract #F-1202 präsentiert bei: 53rd Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), 10.–13. September 2013, Denver/USA <strong>16</strong> Nielsen TB et al.: J Infect Dis 2017; 216: 489-501</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
HIV-Infektion im Alter: Was sind die Herausforderungen?
Dank des medizinischen Fortschritts ist HIV heute eine behandelbare chronische Erkrankung mit nahezu normaler Lebenserwartung. Immer mehr HIV-positive Menschen erreichen ein höheres ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...
Globale Statistik zu HIV/Aids: Ein Ende der Epidemie ist nicht in Sicht
Im Juli 2025 wurde von UNAIDS die globale HIV/Aids-Statistik für das Vorjahr veröffentlicht. Die Daten zeigen den grossen Handlungsbedarf auf und veranschaulichen Versäumnisse, die in ...