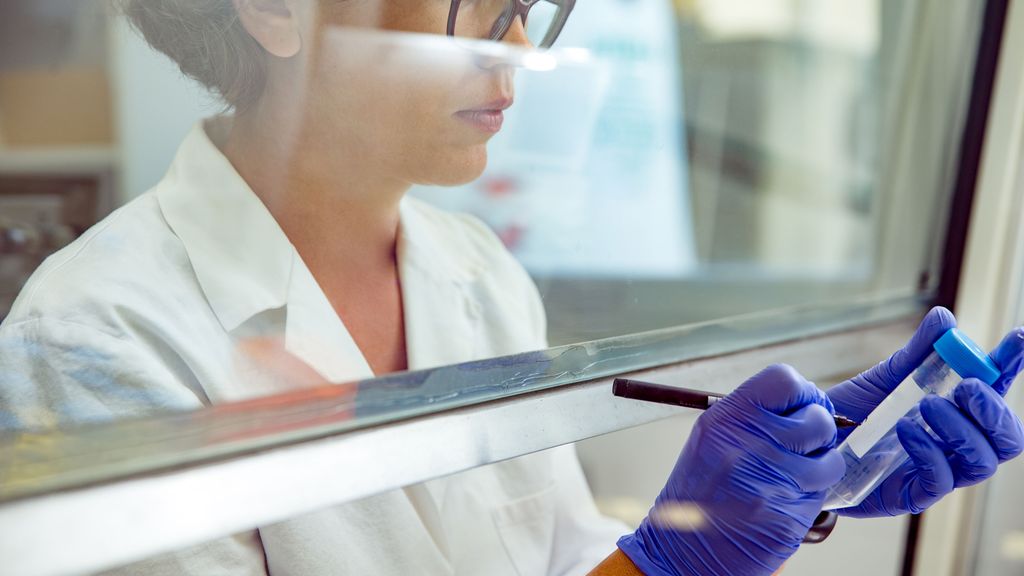
©
Getty Images
Breaking News
Jatros
30
Min. Lesezeit
12.06.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das letzte Symposium des 12. Österreichischen Infektionskongresses behandelte so unterschiedliche Themen wie parasitäre Würmer, die Rolle von Generika bei der Entstehung von Antibiotikaresistenzen und Neuigkeiten aus der Welt der humanpathogenen Viren.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Würmer in Österreich</h2> <p>„Es gibt ca. 340 Wurmspezies, die Parasiten des Menschen sein können“, berichtete Assoz.-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Julia Walochnik, Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, MedUni Wien. Die Symptomatik des Wurmbefalls ist oft unspezifisch, sie kann jedoch auch spezifisch sein, etwa im Fall der sogenannten Badedermatitis. Eine genaue Anamnese ist meist hilfreich. Im Labor findet sich – vor allem bei extraintestinal parasitierenden Würmern oder Wurmlarven – häufig eine Eosinophilie.</p> <p>Der in Österreich wohl häufigste parasitische Wurm ist der Madenwurm <em>(Enterobius vermicularis)</em>. Ein Weibchen kann bis zu 16 000 Eier legen, die mitunter 20 Tage infektiös bleiben. Etwa ein Drittel der Infestationen verläuft asymptomatisch (vor allem bei Erwachsenen). Mittel der Wahl ist Mebendazol, das auch auf die Wurmeier wirkt.</p> <p>Ebenfalls in Österreich sehr häufig ist der Hunde- bzw. Katzenspulwurm <em>(Toxocara canis/cati)</em>, der durchaus zu einer unspezifischen, aber unangenehmen Symptomatik führen kann. Bei Kindern kann es zu einer leichten, febrilen Erkrankung kommen, bei der unter anderem auch Husten, Schlafstörungen, Bauch- oder Kopfschmerzen und Verhaltensstörungen auftreten können. Die Migration der Larven durch innere Organe kann zu Symptomen wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Husten, Fieber, Pneumonie, Bronchospasmen, Bauch- und Kopfschmerzen, Exanthem und gelegentlich auch zu Krampfanfällen führen. Behandelt wird mit Albendazol.</p> <p>Hauptwirte der Vogelbilharzien (<em>Trichobilharzia spp.</em> und andere) sind Wasservögel, Schnecken sind Zwischenwirte. Die Zerkarien, die aus den Schnecken hervorgehen und Wasservögel befallen, können auch beim Menschen durch die Haut eindringen, was zu teilweise massiven Hautreaktionen mit starkem Juckreiz und Bläschenbildung führt. Eine spezifische Therapie gibt es nicht.</p> <p>Echinokokken sind die Erreger seltener, aber gefährlicher Parasitosen, wobei <em>E. granulosus</em> meist importiert wird (oft aus der Türkei). <em>E. multilocularis</em> kommt in Österreich vor – noch vor wenigen Jahren gab es hierzulande jährlich circa einen Fall, mittlerweile sind es jedoch zehn oder mehr (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1802_Weblinks_jatros_infekt_1802_s12_abb1.jpg" alt="" width="1474" height="1117" /></p> <h2>Führen Generika zu Resistenzen</h2> <p>„In der Humanmedizin werden in Österreich jährlich 71,6 Tonnen Antibiotika verwendet, davon 70 Prozent im niedergelassenen Bereich“, sagte Prim. Univ.- Prof. Dr. Petra Apfalter, Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin, Ordensklinikum Elisabethinen Linz. Generika machen hierzulande 50 % des generikafähigen Teilmarktes und 38 % des Gesamtmarktes an Arzneimitteln aus. „Es gibt auch schon Märkte mit bis zu 80 Prozent Generikaanteil“, so Apfalter.</p> <p>Die derzeit geltende Regelung zur Zulassung von Generika verlangt, dass Bioäquivalenz nachgewiesen wird. Dieser „Nachweis“ besteht darin, dass die aktive pharmazeutische Komponente hinsichtlich Potenz, Konzentration und Pharmakokinetik dem Original in einem bestimmten Toleranzbereich entspricht. Sicherheit und Wirksamkeit eines Generikums werden aber nicht geprüft, sondern aufgrund der derart ermittelten „Bioäquivalenz“ abgeleitet.</p> <p>„Es häufen sich experimentelle Beweise dafür, dass bioäquivalente generische Antibiotika in vivo dem Original unterlegen sind und zu klinischem und mikrobiologischem Versagen – Therapieversagen und Ausbildung von Resistenzen – führen können“, warnte Apfalter. Ein Faktor, der solche Unterschiede erklären könnte, ist die „dissolution“, d.h. jener Anteil einer Substanz, der unter definierten Bedingungen pro Zeiteinheit in Lösung geht. In einer Studie<sup>1</sup> mit Amoxicillin/Clavulansäure zeigten 54 % der untersuchten Generika ein signifikant anderes Löslichkeitsverhalten als das Original. Zudem fanden sich signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Chargen des gleichen Generikums und Unterschiede zwischen verschiedenen Generika desselben Herstellers.</p> <p>Trotz pharmazeutischer Äquivalenz sind große Effizienzunterschiede bei i.v. Verabreichung zwischen Original und Generika beschrieben für Vancomycin, Piperacillin/ Tazobactam, Oxacillin, Gentamicin, Meropenem, Lincomycin, Ampicillin und Penicillin. „Pharmazeutische Äquivalenz bedeutet also noch nicht eine therapeutische Äquivalenz in vivo im Tierversuch“, folgerte Apfalter. Mögliche Erklärungen neben den Unterschieden bei der Löslichkeit können Abbauprodukte, Inhibitoren, Verunreinigungen (antagonistische Effekte) und mangelnde Reinheit der Inhaltsstoffe sein. „Therapeutisch nicht äquivalente generische Antibiotika können resistente Subpopulation selektieren. Das wurde experimentell mehrfach eindeutig bewiesen. Demnach ist ein Wirkungs- und Äquivalenznachweis in vivo auch für Generika zu fordern“, schloss Apfalter.</p> <h2>Neue Viren, die man kennen sollte</h2> <p>„Das <em>West-Nil-Virus</em> wird von Mücken auf Vögel, Pferde, aber auch auf den Menschen übertragen“, erklärten Univ.-Prof. Dr. Norbert Nowotny, Institut für Virologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, Dubai. Der natürliche Übertragungszyklus des Virus findet zwischen Mücken und Vögeln statt, während Pferd und Mensch – eher zufällige – Endwirte darstellen (weil sie keine für eine Rückübertragung auf die Mücke ausreichende Anzahl von Viren im Blut erreichen).</p> <p>„Das <em>West-Nil-Virus</em> ist das weltweit am weitesten verbreitete Flavivirus, und es hat sich inzwischen auch in Mitteleuropa festgesetzt“, ergänzte Nowotny. „Und wo das <em>West-Nil-Virus</em> einmal ist, dort bleibt es auch.“ Zwar verlaufen circa drei Viertel der Infektionen asymptomatisch; diese sind aber dennoch problematisch, weil das Virus durch Blutspenden asymptomatisch infizierter Personen übertragen werden kann.</p> <p>Ein verwandtes Flavivirus mit geringerer Pathogenität ist das <em>Usutu-Virus</em>, das auch bereits in österreichischen Blutspenden gefunden wurde.</p> <p>Bei einem in Salzburg geschossenen Gamsbock wurde ein mit dem <em>FSME-Virus</em> verwandtes <em>Flavivirus</em> entdeckt, das zur „Louping ill“-Gruppe gehört. Dieses Virus ist vermutlich jedoch wenig bis gar nicht humanpathogen. „Dies ist das erste Mal, dass ein anderes Virus aus der FSMEGruppe in Mitteleuropa gefunden wurde“, kommentierte der Virologe.</p> <p>Das <em>Bornavirus</em> hat vor Kurzem erstmals drei menschliche Todesfälle verursacht. Zuvor waren nur Infektionen bei Tieren, vor allem bei Pferden und Schafen, bekannt, das allerdings bereits seit dem 18. Jahrhundert. Als Reservoir stellte sich die Feldspitzmaus heraus, die selbst lebenslang infiziert ist und das Virus ausscheidet. „Das Vorkommen des <em>Bornavirus</em> ist auf bestimmte Endemiegebiete beschränkt, z.B. in Sachsen-Anhalt und in Bayern, es gibt aber auch ein Ostschweizer Endemiegebiet, das außerdem Vorarlberg und wahrscheinlich Tirol umfasst“, so Nowotny. Vor Kurzem wurde auch in Oberösterreich ein Endemiegebiet identifiziert.</p> <p>Die humanen Infektionen traten in Deutschland bei Empfängern von Organen eines postmortalen Organspenders auf, der selbst nicht an einer <em>Bornavirus</em>-Infektion gestorben war. Bei zwei weiteren, voneinander unabhängigen Fällen von schwerer akuter Enzephalitis konnte der Übertragungsweg bisher noch nicht geklärt werden.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: „Breaking News“, Symposium 10 des 12. ÖIK, 14. April
2018, Saalfelden
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Al Ameri MN et al.: Results Pharma Sci 2011; 2: 1-8</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag
Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal die Conference on HIV Drug Therapy, kurz HIV Glasgow, statt. Eines der Highlights der Konferenz war die Vorstellung der ...
Best of CROI 2025
Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...


