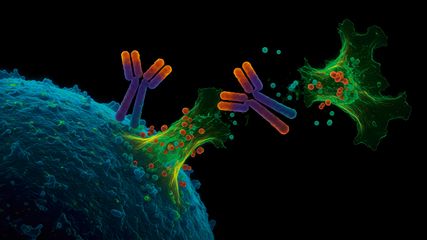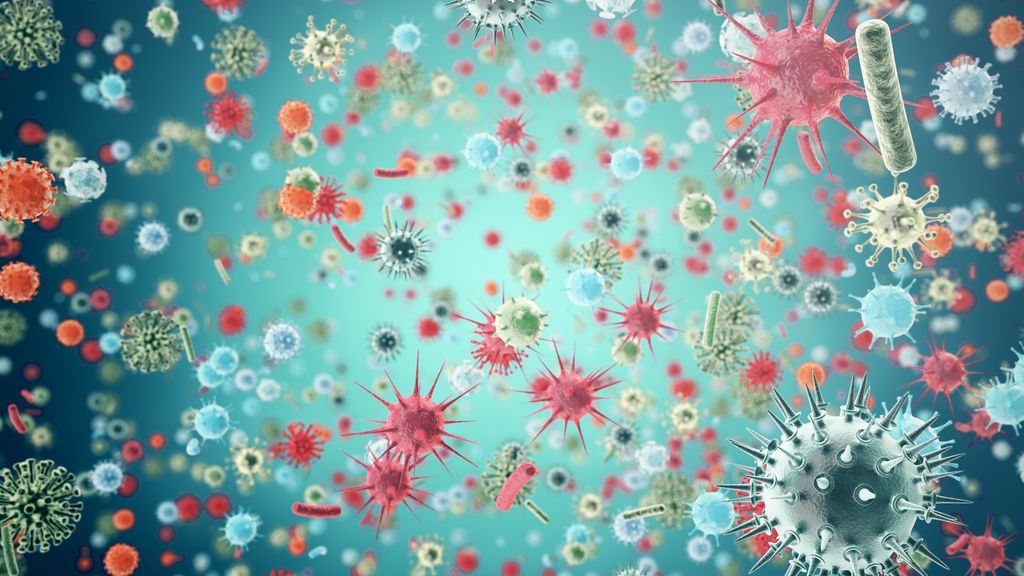
©
Getty Images/iStockphoto
Behandlung multiresistenter Enterobakterien
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer
Präsident der ÖGIT<br> Klinische Abteilung für Infektionen<br> und Tropenmedizin<br> MedUni Wien

Universitätsklinik für Urologie, Medizinische Universität Wien
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (OEGIT)
E-Mail: florian.thalhammer@meduniwien.ac.at
Web: infektiologie.co.at
30
Min. Lesezeit
05.04.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Gerade im gramnegativen Bereich steigen weltweit die Resistenzraten an. Vor allem multiresistente Enterobakterien machen den Infektiologen Sorgen, insbesondere dann, wenn auch eine Resistenz gegen Carbapeneme vorliegt. Therapieoptionen bestehen einerseits in der Verwendung alter Substanzen (z.B. Temocillin oder Colistin), andererseits in der Verwendung von Kombinationen aus Betalaktamen und neuartigen Betalaktamase- Inhibitoren.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Weltweit besteht ein Problem mit Antibiotikaresistenzen vor allem im gramnegativen Bereich. Das zeigt sich auch in den österreichischen Daten, etwa in den AURES-Berichten. Hier sind zwischen 2004 und 2015 die Raten an grampositiven Resistenzen (MRSA und VRE) mehr oder weniger gleich geblieben, während die Raten an ESBL-bildenden E. coli und K. pneumoniae von nahezu null im Jahr 2004 auf jeweils 30 bis 40 % im Jahr 2015 angestiegen sind.</p> <h2>Was sind MRGN?</h2> <p>Die Klassifikation von „multiresistenten gramnegativen Erregern“ (MRGN) ist übrigens keine mikrobiologische, sondern eine krankenhaushygienische. Sie beruht auf dem Verhalten der Erreger gegenüber vier Antibiotikaklassen, nämlich Acylaminopenicillinen, Cephalosporinen der dritten und vierten Generation, Chinolonen und Carbapenemen. Ist ein Erreger gegen drei dieser vier Klassen resistent, so wird er als 3MRGN klassifiziert (meist besteht hier noch Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen). Ist er gegen alle vier Klassen resistent, so wird er als 4MRGN bezeichnet.</p> <h2>Betalaktamasen</h2> <p>An der Sequenz der Aminosäuren der Betalaktamasen orientiert ist die Ambler- Klassifikation (Abb. 1).<br /> Sie unterteilt zunächst in Serin- und Metallobetalaktamasen. Innerhalb der Serinbetalaktamasen gibt es drei Klassen, nämlich A, C und D, während die Metallobetalaktamasen die Gruppe B bilden.<br /> Die Gruppe A hat drei Subgruppen, nämlich Breitspektrumbetalaktamasen (z.B. TEM-1), Extended-Spectrum-Betalaktamasen (ESBL; z.B. CTX-M-14/15 oder TEM-2) sowie Carbapenemasen (z.B. KPC).<br /> Klasse C sind Extended-Spectrum-Cephalosporinasen wie AmpC. Klasse D besteht aus Carbapenemasen wie z.B. OXA- 48 und Oxacillinasen wie z.B. OXA-11. Die Klasse B, die Metallobetalaktamasen, sind ebenfalls Carbapenemasen, wie z.B. NDM oder VIM.<br /><br /><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1801_Weblinks_s10_abb1.jpg" alt="" width="2150" height="1022" /></p> <h2>Therapieoptionen</h2> <p>Da die Neuentwicklung von Antibiotika mit der Dynamik der Resistenzentwicklung keineswegs Schritt hält, ist man gezwungen, immer mehr auf ältere, zum Teil fast in Vergessenheit geratene Substanzen zurückzugreifen. Gerade die Tatsache, dass manche dieser Substanzen jahrzehntelang kaum verwendet wurden, macht sie als Therapeutika attraktiv.<br /> Eine davon ist Temocillin, ein Betalaktamantibiotikum mit einem schmalen Wirkspektrum – es wirkt ausschließlich gegen gramnegative Enterobakterien. Temocillin ist stabil gegen ESBL und AmpC und – zumindest in vitro – auch gegen KPC. Keine Aktivität bzw. Stabilität zeigt es gegen OXA-48, Metallobetalaktamasen und generell gegen Pseudomonas aeruginosa. Temocillin wird dreimal täglich oder als kontinuierliche Infusion verabreicht, wobei die Dosis von der Nierenfunktion abhängig zu machen ist.<br /> Cefoxitin ist ein Cephemantibiotikum, das in den 1970er-Jahren erstmals synthetisiert wurde und mit den Cephalosporinen der zweiten Generation verwandt ist. Es ist stabil gegenüber Breitspektrumbetalaktamasen, ESBL und OXA-11. Die Maximaldosierung beträgt 3x 4g. Cefoxitin kann gegen ESBL-Bildner, aber auch gegen Anaerobier eingesetzt werden. Indikationen sind z.B. Harnwegsinfekt und Pyelonephritis – als Alternative zu Carbapenemen. Hier ist jedoch – wie bei allen Betalaktamantibiotika – darauf zu achten, dass die Zeit über der MHK möglichst lang ist. Daher sollte auch hier, wenn möglich, eine kontinuierliche Gabe überlegt werden. Vorsicht ist bei gleichzeitigem Einsatz von Antikoagulanzien geboten, da die Blutungsgefahr steigt.<br /> Eine weitere, zukunftsweisende Therapieoption besteht im Einsatz von Betalaktam- Antibiotika mit neuen Betalaktamase- Hemmern (Betalaktamase-Inhibitoren, BLI). Hier sind – neben den bereits älteren, bekannten BLI wie Clavulansäure, Sulbactam oder Tazobactam – vor allem drei Substanzen zu nennen: Avibactam, Relebactam und Vaborbactam.<sup>1</sup> Avibactam, Relebactam und Vaborbactam sind insofern von den anderen BLI abzugrenzen, als sie selbst keine Betalaktamstruktur aufweisen und daher nicht die Bildung von Betalaktamasen induzieren können. Die Zugabe eines dieser BLI kann dazu führen, die Aktivität von Ceftazidim und anderen Betalaktamantibiotika gegen Betalaktamasen der Klassen A, C und D wiederherzustellen.<br /> Für Avibactam wurde gezeigt, dass nur eine relativ niedrige Anzahl an BLI-Molekülen (für die meisten Betalaktamasen 1–5) notwendig ist, um ein Molekül Betalaktamase irreversibel zu hemmen – die meisten anderen BLI benötigen hierzu wesentlich größere Molekülzahlen.</p> <h2>Vier neue Kombinationen</h2> <p>Ceftolozan/Tazobactam ist in Österreich bereits erhältlich und ist stabil gegen Breitspektrumbetalaktamasen und ESBL, nicht jedoch gegen KPC und Metallobetalaktamasen. Die Kombination weist eine Staphylokokkenlücke auf. In klinischen Studien zeigte sich folgendes Wirkspektrum im gramnegativen Bereich: bei komplizierten intraabdominellen Infektionen – Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis und Pseudomonas aeruginosa; bei komplizierten Harnwegsinfektionen einschließlich Pyelonephritis – E. coli, K. pneumoniae und P. mirabilis.<br /> Ceftazidim/Avibactam ist ebenfalls bereits in Österreich erhältlich. Es wirkt gegen Betalaktamasen der Klassen A und C sowie gegen OXA-48 aus der Klasse D, nicht jedoch gegen Metallobetalaktamasen. Auch diese Kombination weist eine Staphylokokkenlücke auf. In klinischen Studien zeigte sich folgendes Wirkspektrum im gramnegativen Bereich: bei komplizierten intraabdominellen Infektionen – Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella oxytoca, K. pneumoniae und P. aeruginosa; bei komplizierten Harnwegsinfektionen – E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Enterobacter cloacae und P. aeruginosa.<br /> Die Kombination Meropenem/Vaborbactam (in den USA zugelassen, in der EU im Zulassungsverfahren) wirkt gegen Betalaktamasen der Ambler-Klassen A (einschließlich der Carbapenemase KPC) und C und kann auch gegen Carbapenem-resistente Bakterien wirken. Gerade diese Indikation könnte in Zukunft Standard werden.<br /> Eine Studie zeigte, dass Resistenzentwicklungen KPC-produzierender Stämme gegen diese Kombination nicht mit einer Veränderung des KPC-Enzyms, sondern mit anderen Resistenzmechanismen, wie z.B. Porin-Mutationen, zu tun haben und durch höhere Dosen von Meropenem/Vaborbactam unterdrückt werden können.<br /> Die Kombination Imipenem/Relebactam wird derzeit noch in Phase III untersucht. Sie wirkt gegen Betalaktamasen der Klassen A und C und erweist sich unter anderem bei Carbapenem-resistenten Pseudomonaden als wirksam. Das Wirkspektrum von Relebactam bezüglich Betalaktamasen ähnelt jenem von Vaborbactam.<br /> Sowohl Vaborbactam als auch Relebactam verbessern die Aktivität des jeweiligen Penems, mit dem sie gegeben werden, gegen die meisten Enterobakterien, nicht aber gegen Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia und die meisten Anaerobier.<br /> Einen Überblick über die Wirkspektren der erwähnten BL/BLI-Kombinationen im Vergleich mit dem Reserveantibiotikum Colistin und dem neuen Cephemantibiotikum Cefiderocol (derzeit Phase III) gibt Tabelle 1.<br /> Zu betonen ist, dass die neuen Kombinationen aus Cephalosporin/Betalaktamasehemmer nicht empirisch, sondern nur nach mikrobiologischer Austestung gegeben werden sollen, da die Empfindlichkeitsraten der wichtigsten Erreger – E. coli, Klebsiellen und Pseudomonaden – nur bei ca. 60 bis 70 % liegen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1801_Weblinks_s10_tab1.jpg" alt="" width="1444" height="1394" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Siehe dazu auch den Artikel „Neue Kombinationen und was sie können“ in JATROS Infektiologie & Gastroenterologie- Hepatologie 04/2017.</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...