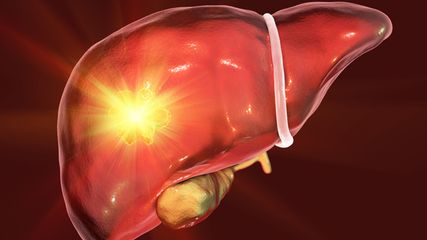©
Getty Images/iStockphoto
Management der Abstoßung nach Lebertransplantation – die Kunst des Minimalismus
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Vogel
Universitätsklinik für Innere Medizin II<br> Medizinische Universität Innsbruck<br> E-Mail: wolfgang.vogel@i-med.ac.at
30
Min. Lesezeit
29.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Lebertransplantation (LTx) bleibt bis auf Weiteres die einzige Möglichkeit zur Heilung bei akutem oder chronischem Leberversagen, von hepatozellulärem Karzinom, hilärem Cholangiokarzinom und bestimmten angeborenen Stoffwechseldefekten. Der Langzeiterfolg der LTx wird maßgeblich durch die Nebenwirkungen der notwendigen Medikation beeinflusst. Deshalb sollten Immunsuppressiva in so geringen Dosen wie möglich verordnet werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Grundsätzliche Empfehlung lebenslanger Immunsuppression nach LTx; Studien zufolge ist mehr als 10 Jahre nach Operation Beendigung immunsuppressiver Therapie in Einzelfällen möglich.</li> <li>Induktionsphase einer IS (30 Tage post LTx): 3-fach-Kombination aus Calci-­neurininhibitoren, Tacrolimus (in zweiter Linie Cyclosporin A), Proliferationshemmern + Kortikosteroiden in höheren Dosen.</li> <li>Erhaltungsphase einer IS (spätestens 6 Monate nach LTx): immunsuppressive Monotherapie mit Tacro­limus, alternativ Myco­phenolat-Mofetil oder mTOR-Inhibitoren.</li> <li>Histologischen und klinischen Befunden zufolge ­treten Abstoßungen innerhalb der ersten 90 Tage sehr häufig auf, jedoch zumeist mit selbst limitierendem ­Verlauf.</li> </ul> </div> <h2>Geschichte der Lebertransplantation</h2> <p>Nach ersten tierexperimentellen Studien führte Thomas Starzl 1963 die erste LTx am Menschen durch. Es dauerte dann allerdings bis zur Mitte der 1970er-Jahre, bis die chirurgischen Probleme, insbesondere die kritische Choledochusanastomose, so weit gelöst waren, dass unter Verwertung der Erfahrungen mit immunsuppressiver Therapie nach Nierentransplantation die LTx als Routineverfahren anzudenken war. Im Jahre 1983 hielt die erste <em>„NIH Consensus Development Conference on Liver Transplantation“</em> dazu fest: <em>„… liver transplantation is a therapeutic modality for end-stage liver disease that deserves broader application. However, in order for liver transplantation to gain its full therapeutic potential, the indications for and results of the procedure must be the object of comprehensive, coordinated, and ongoing evaluation in the years ahead. This can best be achieved by expansion of this technology to a limited number of centers where performance of liver transplantation can be carried out under optimal conditions.“</em> Mit diesem bis heute geltenden Auftrag hat sich die LTx zu einer der Erfolgsgeschichten der modernen Medizin entwickelt. Die erste LTx wurde in Innsbruck 1977 vom weltbekannten Pionier Univ.-Prof. Dr. Raimund Margreiter durchgeführt. Bis 1983 hatte er dort eine Infrastruktur entwickelt, um dem Programm eine kontinuierliche Entwicklung als Routineverfahren zu ermöglichen. Die Universitäten Innsbruck und Wien tragen mit jeweils ca. 70 Transplantationen pro Jahr die Hauptlast in Österreich.</p> <h2>Transplantationsbiologie der Leber</h2> <p>Die Leber genießt in der Transplantationsbiologie einen privilegierten Status. Dafür liegen zahlreiche klinische und experimentelle Befunde vor. So ist zwischen Spender und Empfänger kein HLA-Abgleich notwendig und eine hyperakute Abstoßung wird so gut wie nie beobachtet. Transplantationen von Lebern sind über Blutgruppengrenzen und bei positivem Cross-Match möglich. Dementsprechend sind die Langzeitergebnisse nach LTx die besten in der Transplantationsmedizin. Die zugrunde liegenden Mechanismen werden allerdings nur inkomplett verstanden. Zentral dürfte der rasche Austausch des retikulo-endothelialen Systems der transplantierten Leber durch Zellen des Empfängerknochenmarkes sein. Die für eine Alloreaktion wichtige Expression von HLA-Antigenen findet vornehmlich an diesen Zellen und den Zellen des Endothels der Gefäße sowie an den Gallengangsepithelien statt. Hepatozyten exprimieren kaum HLA-Klasse-II-Antigene, produzieren aber bis zu 90 % der Komplementfaktoren und induzieren mit mem­brangebundenen Pathogen-Recognition-Rezeptoren (PRR) Toleranz gegen Antigene. Physiologischerweise hat die Leber eine wichtige Funktion in der Suppression von immunologischen Reaktionen auf oral aufgenommene Antigene.<br /> Mechanistisch spielen neben den spenderspezifischen immunregulatorischen Effekten sowie dem hämatopoetischen Chimärismus zwischen Spender und Empfänger vor allem die klonale Elimination alloreaktiver Zellen und die Präsenz regulativer T-Zellen und dendritischer Zellen eine entscheidende Rolle. Die Inhibition von Alloantikörpern wurde bisher als so effektiv erachtet, dass eine humorale Form der Abstoßung als ausgeschlossen galt. Neuere Konzepte legen allerdings nahe, dass unter bestimmten Umständen spenderspezifische Antikörper nach Transplantation klinisch relevant werden können. Hierfür scheinen Lebern mit einem Präservationsschaden und solche von alten Spendern besonders anfällig zu sein. Ein weiteres neues Konzept könnte erklären, warum eine Untergruppe von Patienten doch zu klinisch problematischen Abstoßungen neigt. So konnte jüngst gezeigt werden, dass die genetisch determinierte starke Expression von PD-1-Liganden der Spender-Hepatozyten gemeinsam mit einer starken Expression von PD-1 durch die Empfänger-T-Zellen eine Abstoßung unterdrückt.</p> <h2>Immunsuppression nach LTx</h2> <p>Unabhängig von diesen Tatsachen gilt auch nach Lebertransplantation die grundsätzliche Empfehlung der lebenslangen Immunsuppression. Allerdings zeigen Studien, dass mehr als 10 Jahre nach der Operation eine Beendigung einer bis dahin in der Regel bereits minimalen immunsuppressiven Therapie in Einzelfällen möglich ist. Die immunsuppressive Therapie muss in Zusammensetzung und Dosierung auf den individuellen Patienten maßgeschneidert werden. Wir verfügen auch heute noch über keine Biomarker, anhand deren sich der konkrete Bedarf an immunsuppressiver Therapie bzw. das Ausmaß der erfolgten Immunsuppression ablesen ließe. Grundsätzlich gilt: so wenig wie möglich (um Nebenwirkungen zu vermeiden) und so viel wie notwendig (um normale Transaminasewerte sicherzustellen). Somit gibt es auch keine allgemein gültigen Zielspiegel für Serumkonzentrationen der Medikamente. Parallel zu den oben skizzierten zeitabhängigen immunologischen Interaktionen zwischen Empfänger und Spenderorgan nimmt auch der Bedarf an Immunsuppression ab – von der „Dreierkombination“ in den ersten Monaten nach einer LTx zur Monotherapie im Langzeitverlauf.<br /> <br /> Die initialen immunsuppressiven Probleme der LTx wurden mit Einführung der Calcineurininhibitoren (Cyclosporin A und Tacrolimus) in die Therapie weitgehend gelöst. Beide unterdrücken die Expression von CD25 und CD154 an T-Zellen sehr wirksam und verhindern so die für die Abstoßung wichtige T-Zell-Stimulation. Für viele Patienten sind diese beiden Medikamente in den ersten Jahren entscheidend für den Transplantationserfolg.<br /> <br /><strong> Induktionsphase</strong><br /> Die frühe Phase der Immunsuppression (Induktionsphase) soll innerhalb der ersten 30 Tage nach Transplantation Akzeptanz des Spenderorganes induzieren. In dieser Zeit ist in der Regel eine 3-fach-Kombination, bestehend aus Calcineurininhibitoren, Tacrolimus oder in zweiter Linie Cyclosporin A, in Kombination mit einem Proliferationshemmer und Korti­kosteroiden in höheren Dosen notwendig. Calcineurininhibitoren werden ausschließlich in dieser postoperativen Phase nach Serumzielspiegel dosiert. Für Kortikosteroide liegt die längste, in der Regel zentrumspezifische Erfahrung, aber die schlechteste Evidenz vor. Die hohen postoperativen Dosen von bis zu 1.000mg Methylprednisolon pro Tag werden rasch auf zweistellige Erhaltungsdosen zurückgesetzt, die nach 3 bis 6 Monaten ganz abgesetzt werden.<br /> <br /><strong> Erhaltungsphase</strong><br /> Die Aufrechterhaltung der Immun­suppression (IS), die spätestens nach 6 Monaten erreicht werden sollte, besteht aus einer immunsuppressiven Monotherapie (Abb. 1). Falls renale oder metabolische Nebenwirkungen keine Kontraindikation darstellen, wird eine Monotherapie mit Tacrolimus dosiert nach der Minimumdosis zur Gewährleistung normaler Transaminasewerte angestrebt. Alterna­tive Monotherapien sind mit Mycophenolat-Mofetil oder mit mTOR-Inhibitoren möglich.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Infekt_1603_Weblinks_seite28.jpg" alt="" width="734" height="667" /></p> <p><strong>Abstoßungsreaktionen</strong><br /> Eine Abstoßung ist kein „Alles oder nichts“-Phänomen, sondern eine dynamische Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem neuen Organ. In dieser Auseinandersetzung wird das Organ auch immunologisch in den neuen Organismus „eingebaut“ (toleriert). Histologische und klinische Befunde belegen, dass Abstoßungen innerhalb der ersten 90 Tage sehr häufig vorkommen, aber auch häufig selbstlimitiert verlaufen. Tatsächlich liegen zahlreiche Befunde vor, die belegen, dass die Intensität dieser frühen immunologischen Auseinandersetzung günstig für den Langzeitverlauf ist. Die Diagnose „akute zelluläre Abstoßung“, per definitionem eine histologische, lässt sich anhand klinischer Kriterien mit brauchbarer Zuverlässigkeit stellen. Fast regelhaft tritt sie unterschiedlich ausgeprägt innerhalb der ersten 14 Tage nach Operation auf und ist durch einen plötzlichen Anstieg der Serum-Glutamat-Pyruvat-Transferase (SGPT) charakterisiert. Die Häufigkeit nimmt innerhalb der ersten 90 Tage deutlich ab – vor allem im ersten Jahr ist allerdings immer mit einem solchen Ereignis zu rechnen. Sie ist bei Betroffenen unter 50 Jahren problematischer zu behandeln als bei älteren Patienten. In der Differenzialdiagnose müssen eine arterielle Durchblutungsstörung der Leber, eine Erkrankung der Gallenwege und ihrer Anastomose, virale (CMV, EBV, Hepatitis B oder C) oder bakterielle Infektionen ausgeschlossen worden sein.<br /> <br /> Aus Biopsiestudien ist bekannt, dass bis zu 30 % asymptomatisch und selbstlimitiert verlaufen. Die symptomatische Abstoßung wird mit Bolusgaben von Methylprednisolon entsprechend den zentrumsspezifischen Protokollen behandelt. Im Gegensatz zu diesen frühen Abstoßungen sind akute Abstoßungen jenseits der 90-Tage-Grenze prognostisch weniger günstig. Zu diesen Komplikationen neigen vor allem junge Patienten mit autoimmunen Vorerkrankungen.<br /> Die chronische Abstoßung wird mit einer Prävalenz von ca. 5 % beobachtet. Sie ist immunologisch unverstanden, klinisch durch ein Cholestasesyndrom gekennzeichnet und letztlich nur histologisch zu belegen. Bei der histologisch frühen Form sind die Veränderungen an Gallengängen, Arterien und Zentralvenen noch diskret. Das fortgeschrittene und irreversible Stadium ist durch obliterative Prozesse an diesen vaskulären Strukturen charakterisiert. Therapeutisch bleiben nur ein in etwa 50 % der Fälle erfolgreicher Versuch, die Immunsuppression qualitativ und quantitativ empirisch zu erweitern, sowie die Retransplantation.</p> <h2>Komplikationen nach LTx</h2> <p>Die Reaktivierung latenter Virusinfektionen – CMV, EBV, Hepatitis B aus anti-HBc-positiven Organen – ist eine Komplikation der frühen IS-Phase und verlangt neben antiviraler Therapie eine Reduktion der IS. Die Pneumocystis-carinii-Infektion wird vor allem nach Retransplantation und bei untypisch hohem IS-Bedarf beobachtet und verlangt eine prophylaktische Therapie. Gallenwegsinfektionen sind typisch nach endoskopischen Interventionen und häufig durch resistente Keime charakterisiert. Dementsprechend ist ein Erregermonitoring in der Galle bei solchen Eingriffen verpflichtend.<br /> <br /> Die fast regelhaften metabolischen Nebenwirkungen der IS werden im Langzeitverlauf nach LTx – nach 10 bis 30 Jahren und mehr – zum prognosebestimmenden Faktor. Deren frühes therapeutisches Management durch Minimierung und spezifische Interventionen vor allem zur Sicherung der Nierenfunktion und Vermeidung kardiovaskulärer Komplikation ist das Geheimnis eines normal langen Lebens nach Transplantation. Das absolute Risiko maligner Erkrankungen – ca. 22 % der ­Todesfälle – wird bis auf das Post-Transplantations-lymphoproliferative Syndrom durch die IS nicht erhöht, aber das relative. So treten Karzinome, verursacht durch Risikoverhalten wie Rauchen und Alkoholgenuss in der Vergangenheit, durch die IS häufiger und früher auf. Dementsprechend sollte eine allgemeine oder gezielte Vorsorgeuntersuchung alle 5 Jahre durchgeführt werden.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die Immunsuppression ist entscheidend für das kurz- und langfristige Ergebnis nach LTx und bis auf Einzelfälle lebenslang notwendig. Obwohl die Leber eine geringe transplantationsrelevante Immunogenität aufweist, ist in den ersten Monaten eine 3-fach-Kombination aus immunsuppressiven Medikamenten notwendig. Diese kann in der Regel nach 6 Monaten auf eine Minimaltherapie zur Mini­mierung der Nebenwirkungen reduziert werden. Die Häufigkeit und Schwere der akuten Abstoßung nimmt in den ersten 90 Tagen signifikant ab. Chronische Abstoßungen sind selten und in der Regel therapierefraktär. Der Langzeiterfolg der Transplantation wird vor allem durch Nebenwirkungen der Medikamente gefährdet. Dementsprechend muss das Ziel sein, mit einem minimalen Einsatz von Immunsuppressiva, die ja zum Teil mehrere Jahrzehnte lang genommen werden müssen, eine normale Leberfunktion sicherzu­stellen und Nebenwirkungen zu verhindern. Hierbei helfen Erfahrung und Histologie.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues aus der Welt der Hepatologie
Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...
Rückbildung der portalen Hypertension bei Leberzirrhose durch Alkoholabstinenz
Hepatische Rekompensation beschreibt ein neues Konzept, wonach eine erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie es Patient:innen mit dekompensierter Lebererkrankung ermöglicht ...
Tumoren der Leber und der Gallenwege
Fokale Leberläsionen sind nicht nur in der Gastroenterologie und Hepatologie, sondern auch in der internistischen und hausärztlichen Praxis ein häufiger Befund bei CT-, MRT- oder ...